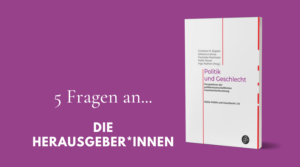Leseprobe zum Thema Fleischessen aus unserer Zeitschrift HiBiFo – Haushalt in Bildung & Forschung.
***
Fleischessen als komplexes Thema in der Ernährungs- und Verbraucherbildung
Corinna Neuthard & Angela Häußler
HiBiFo – Haushalt in Bildung & Forschung, Heft 2-2024, S. 71-84.
Fleisch und Fleischessen ist esskulturelle Selbstverständlichkeit und Normalität. Aufgrund der globalen Auswirkungen der ressourcenintensiven Fleischproduktion wird dies aber zunehmend in Frage gestellt. Eingebettet in soziale, kulturelle, ethische, ökologische und gesundheitliche Zusammenhänge bietet das Thema Fleisch und Fleischessen vielperspektivischen Bildungsgehalt für die schulische Ernährungs- und Verbraucherbildung.
Schlüsselwörter: Fleisch, Fleischessen, Fleischproduktion, Esskultur, Lebensweltperspektive
Meat eating as a complex topic in nutrition and consumer education
Meat and meat-eating are a matter of course and normality in food culture, but the global effects of resource-intensive meat production are increasingly calling this into question. Embedded in social, cultural, ethical, ecological and health-related contexts, the topic of meat and meat-eating offers a variety of educational opportunities for nutrition and consumer education at school.
Keywords: Meat, meat eating, meat production food culture, everyday-life perspective
1 Perspektiven auf Fleisch und Fleischessen
Kein anderes Lebensmittel löst so intensive und konträre Debatten aus wie Fleisch, sowohl auf medial-gesellschaftlicher Ebene als auch in privaten Kontexten. Auf der einen Seite des Diskurskontinuums steht die historisch gewachsene esskulturelle Verankerung von Fleisch als selbstverständlich verfügbarem Lebensmittel, auf der anderen Seite wissenschaftlich fundierte Argumentationslinien, die die derzeitigen Produktions- und Konsumweisen von Fleisch grundlegend problematisieren (Friedrichsen & Gärtner, 2020). Die Gemengelage der Diskurse ist dabei vielschichtig und komplex, zum einen entlang der globalen ökologischen, gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen des Fleischkonsums, zum anderen in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, in den Fleisch und Fleischessen als Ausdruck von Identität und Weltanschauung verhandelt wird.
Im vorliegenden Artikel soll zunächst ein Überblick über die komplexen Diskursstränge gegeben werden. Anschließend werden Schlussfolgerungen gezogen im Hinblick auf den Bildungsgehalt und die Exemplarität des Themas in der Ernährungs- und Verbraucherbildung.
1.1 Fleischessen – Esskulturelle Selbstverständlichkeit?
Fleisch ist ein Lebensmittel mit enormer Symbolkraft, über viele Jahrhunderte galt es als Ausdruck von Wohlstand und Stärke. Bis heute bleibt diese Symbolik und das positive Image daraus erhalten und Fleisch ist nach wie vor für viele der Inbegriff einer ‚richtigen‘ Mahlzeit. Im Zuge der Entwicklung zu industrialisierten Wohlstands- und Konsumgesellschaften ist Fleisch zu einem Massenprodukt geworden, es ist meist günstig zu haben und hat den Status eines Grundnahrungsmittels. Die große Mehrheit der Menschen konsumiert selbstverständlich Fleisch (Friedrichsen & Gärtner, 2020; Hirschfelder, 2021; Rückert-John & Kröger, 2019). Die Entwicklung zum Massenprodukt aus dem Supermarkt geht mit einer Entfremdung von der mit dem Fleischkonsum verbundenen Schlachtung/Tiertötung einher. Die küchenfertig vorbereiteten Fleischprodukte werden oft nicht direkt mit einem Tier in Verbindung gebracht (Neuthard, 2022).
Global betrachtet ist Fleischverzehr ein Indikator für Wohlstand. Bei Menschen aus Ländern mit höherem materiellem Wohlstand stammt ein höherer Anteil der Proteinzufuhr aus tierischen Produkten, besonders auch aus Fleisch (Friedrichsen & Gärtner, 2020). Das Essen von Fleisch und/oder Fisch ist ein Bestandteil wichtiger Traditionen wie z. B. bei Festtagsessen. Gerichte und Mahlzeiten werden in der Regel ausgehend von einer Fleisch- oder auch Fischkomponente gedacht, die pflanzlichen Komponenten werden als ‚Beilagen‘ in der Bedeutung dem Fleisch untergeordnet (Friedrichsen & Gärtner, 2020).
Durch das Wissen über und die Diskussionen um ökologische, gesundheitliche oder auch tierethische Problemlagen von Fleischproduktion und -konsum hat das positive Image von Fleisch und Fleischessen auch in Deutschland den vergangenen Jahrzehnten allerdings zunehmend Kratzer bekommen. Diese kritische Perspektive bildet sich nur sehr langsam im tatsächlichen Fleischkonsum ab. Von Beginn der Berechnungen im Jahr 1989 bis Mitte der 2010er Jahre lag der jährliche Fleischkonsum in Deutschland recht stabil bei etwa 60 kg pro Kopf. Seitdem geht er langsam zurück. Im Jahr 2022 waren es 52 kg pro Kopf und Jahr (BLE, 2023), was einem durchschnittlichen Pro Kopf-Konsum von 1 kg in der Woche entspricht. Damit liegt der Fleischkonsum immer noch um ein Vielfaches über der gesundheitlich und ökologisch ausgerichteten Empfehlung von maximal 300 g Fleisch und Wurst pro Woche (DGE, 2024; EAT Lancet, 2019).
Neben dem Konsum von Tierprodukten als Teil unserer Traditionen ist die Fleischindustrie in Ländern mit mittlerem und hohem Einkommen in einer Weise institutionalisiert, die einen exzessiven Konsum befördern. (Friedrichsen & Gärtner, 2020, S. 5)
Einen charakteristischen Ausdruck der gesellschaftlichen Normalität des Fleischessens sehen Vertreterinnen und Vertreter kritischer Positionen unter anderem auch darin, dass es ausdifferenzierte Bezeichnungen für verschiedene Varianten des Nicht- Fleischessens wie Vegetarismus und Veganismus gibt, aber keinen Begriff für das als normal, natürlich und notwendig empfundene Fleischessen (Pfeiler, 2018). Die Sozialpsychologin Melanie Joy schlägt dafür den Begriff „Karnismus“ vor. Karnismus bezeichnet eine Ernährungsweise, die in ein gesellschaftliches System, das Tierhaltung und -tötung zur Fleischgewinnung unterstützt, eingebettet ist und das Fleischkonsum als „natural“, „normal“, und „necessary“ erscheinen lässt (Joy, 2020).
Die konträr geführten öffentlichen Diskurse über das Fleischessen sind ein Ausdruck davon, dass die Modalitäten des Fleischkonsums gesellschaftlich neu ausgehandelt werden und sich die Normalitätsvorstellungen darüber verändern (Lessenich, 2022; Neuthard, 2022). Auch wenn Verteidiger des Fleischessens nach wie vor ein empfundenes Recht auf uneingeschränkten Fleischkonsum vertreten, sind auch in Dorfgasthäusern, Discountern und Supermärkten vegetarische Alternativen weitgehend selbstverständlich geworden (Hirschfelder, 2021). In vielen Debatten spiegelt sich ein gesellschaftliches Unbehagen über das Fleischessen bzw. über die Folgen der hochindustrialisierten Fleischproduktion bzw. Tierhaltung und -tötung wider.
1.2 Fleischessen – eine ökologisch, gesundheitlich und ethisch fragwürdige Praktik?
Vielmehr häufen sich inzwischen die Erschütterungen des vor kurzem noch Selbstverständlichen: Mittlerweile soll man nicht mehr rauchen, weil es tödlich ist, nicht mehr fliegen, weil es umweltschädlich, und kein Fleisch mehr essen, weil es beides ist. (Lessenich 2023)
Inzwischen zeigt sich eine gesellschaftlich weit geteilte Überzeugung, dass die Art und Weise der derzeit praktizierten Fleischproduktion aus tierethischer Perspektive nicht in Ordnung ist und dass die Konsummuster weder aus ökologischer Sicht noch aus gesundheitlicher Sicht vertretbar sind. Gleichzeitig besteht eine weit geteilte Überzeugung, dass es aber grundsätzlich in Ordnung und normal ist Fleisch zu essen, wichtig ist nur, dass es ‚gutes Fleisch‘ ist (Neuthard, 2022).
1.2.1 Ökologische Folgen des Fleischessens
Mit der ressourcenintensiven Fleischproduktion sind vielfältige ökologische Auswirkungen verbunden. Dass der Ernährungssektor bzw. die Landwirtschaft auf globaler Ebene nennenswert zum Überschreiten der planetaren Belastungsgrenzen beim Flächen- und Wasserverbrauch, dem Verlust der Biodiversität, den Störungen des Stickstoffkreislauf sowie den Treibhausgas-Emissionen beiträgt, ist vor allem der Fleischproduktion zuzurechnen (Willett et al., 2019).
• Da Tiere einen großen Teil der eingesetzten Lebens- bzw. Futtermittel für ihren Organismus verbrauchen (Veredelungsverluste) (Leitzmann & Keller, 2013; Parlasca. & Qaim, 2022), liegt die Konversionsrate bei der Nahrungsenergie von Fleisch durchschnittlich bei 11:1. Die Konversionsrate besagt wie viel Produktionsenergie in kcal aufgewendet werden muss, um eine Kcal Endprodukt zu erzeugen. Diese schwankt je nach Tierart, Futtermittel usw. (Leitzmann & Keller, 2013; von Koerber et al., 2012)
• Eingesetzte Ressourcen und entstehende Emissionen für die Produktion von Futtermitteln werden den tierischen Endprodukten zugerechnet, was die ökologische Auswirkung der tierischen Produkte vervielfacht (Leitzmann & Keller, 2013).
• Auch der Flächenverbrauch ist durch den Bedarf an Futtermitteln bei Fleisch und anderen tierischen Produkten hoch, etwa 70 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche weltweit ist für die Produktion von Fleisch belegt, diese decken aber weltweit nur 18 % des Kalorienbedarfs und 37 % des Proteinbedarfs (Friedrichsen & Gärtner, 2020; Fritz, 2011; Idel, 2012; Ladwig, 2021).
• Allerdings: Für die Tierhaltung können Flächen genutzt werden, die ansonsten nicht nutzbar wären. Durch Weidehaltung von Wiederkäuern ist es möglich, diese Flächen dennoch zur Nahrungsgewinnung einzusetzen, sie stehen in diesem Moment nicht in der Konkurrenz zu anderen Lebensmitteln (Fritz 2011; Idel, 2012; Parlasca. & Qaim, 2022). Zudem bindet Dauergrünland CO2 aus der Atmosphäre (Fritz, 2011; Idel, 2012).
• Derzeit werden 16 % der Treibhausgasemissionen durch Ernährung verursacht, davon wiederum fast zwei Drittel für tierische Produkte.
Ausgehend von den derzeit gesellschaftlich praktizierten Ernährungsweisen in Konsumgesellschaften hat eine deutliche Reduktion des Konsums von tierischen Produkten das größte Einsparpotenzial für die ökologischen Auswirkungen der Ernährung (Hanke et al., 2023).
1.2.2 Gesundheitliche Folgen des Fleischessens
Der übermäßige Konsum von tierischen Produkten, wie im Rahmen einer durchschnittlichen Ernährungsweise in Deutschland üblich, erhöht die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens Übergewicht und nicht-übertragbare Erkrankungen zu entwickeln (Friedrichsen & Gärtner, 2020; WCRF, 2018).
• Die Prävalenz von Übergewicht liegt in Deutschland seit vielen Jahren auf einem hohen Niveau, so sind 60 % der erwachsenen Männer und gut 45 % der Frauen übergewichtig, insgesamt 19 % der Erwachsenen sind adipös (Schienkiewitz et al., 2022).
• Studien identifizieren bei Vegetarierinnen und Vegetariern ein deutlich geringes Risiko für bestimmte Krankheiten, so z. B. ein um 41 % geringeres Risiko für Typ II Diabetes, eine um 20 % niedrigere Sterblichkeitsrate aufgrund koronarer Herzerkrankungen oder ein um 10 % niedrigeres Krebsrisiko (Tilman & Clark, 2014).
• Die biologische Wertigkeit von tierischem Protein ist in der Regel höher als die von pflanzlichem (Biesalksi & Grimm, 2011). Die geringere Wertigkeit der Aminosäure-Zusammensetzung pflanzlicher Proteine kann allerdings durch die Kombination mit anderen Lebensmitteln verbessert werden (Biesalksi & Grimm, 2011). So hält die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) eine vegetarische Ernährungsweise ohne Fleisch, so lange weiterhin andere tierische Produkte wie Eier, Milch und Milchprodukte verzehrt werden, für eine geeignete Dauerernährung bei gesunden Personen (Richter et al., 2020).
* * *
 Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist in Heft 2-2024 unserer Zeitschrift HiBiFo – Haushalt in Bildung & Forschung erschienen.
Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist in Heft 2-2024 unserer Zeitschrift HiBiFo – Haushalt in Bildung & Forschung erschienen.
Mehr Leseproben …
… finden Sie auf unserem Blog.
© Unsplash 2024, Foto: Sergey Kotenev