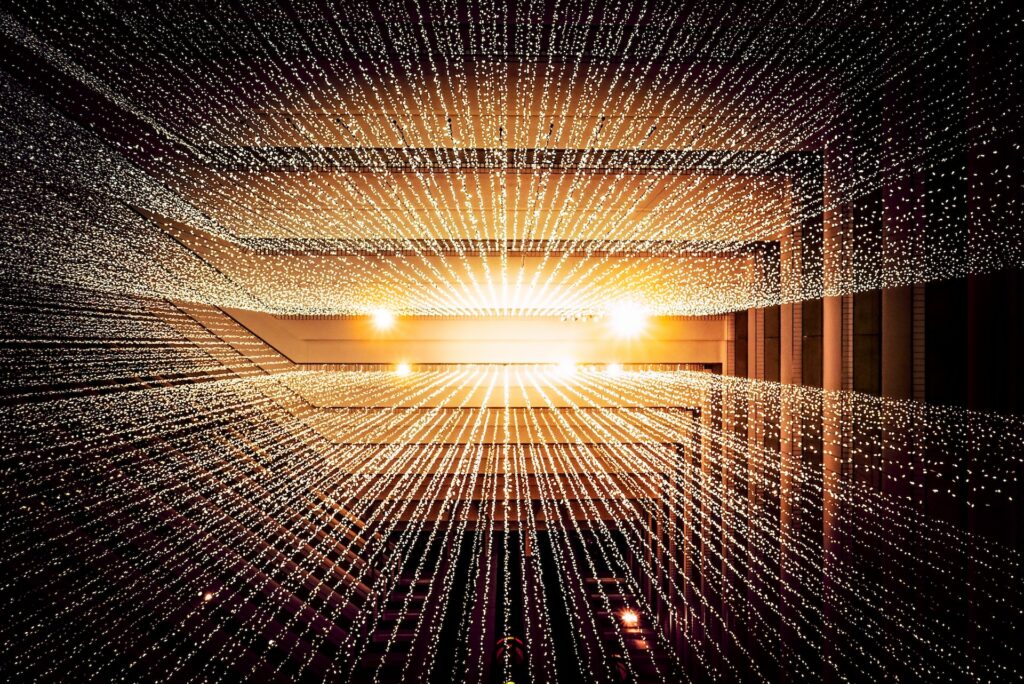Zwischen Realität und Realismus. Zum kritischen Umgang mit digitalen Technologien in der Demokratietheorie
Robert Brumme, Dennis Bastian Rudolf
ZPTh – Zeitschrift für Politische Theorie, Heft 1+2-2022, S. 133-153.
Schlüsselwörter: Demokratie, digitale Technologie, Autonomie, Realität, Realismus
Abstract: Die digitale Transformation schreitet unaufhaltsam voran. Im Spannungsverhältnis von kritischer Reflexion und technologischer Aktualität haben auch demokratietheoretische Debatten ihre deterministischen Tendenzen und technologischen Engführungen hinter sich gelassen. Während damit einerseits den Ambivalenzen und Affordanzen des Digitalen größere Beachtung geschenkt werden, drängen andererseits pragmatische Zugänge darauf, die Potentiale des Digitalen zur Lösung einer Krise der Demokratie in experimentellen Umgebungen zu erproben. Letztere betreiben die Transformation der Demokratie jedoch vorwiegend in reformatorischer Absicht und damit im Kielwasser machtvoller Erzählungen vor digitaler Demokratiemodelle. Sie orientieren sich weniger an der tatsächlichen Funktionalität des Digitalen als an eigenen Deutungen für die digitale Verwirklichung vordigitaler Versprechen. Gegenüber Vorstellungen einer digitalisierten Demokratie stellt der Beitrag daher die Bedeutung der Gemachtheit von digitaler Technik und Realität für eine realistische demokratische Theoriebildung ins Zentrum. Im Sinne eines normativen Maßstabes muss diese digital-demokratische Strukturen stärker dahingehend bewerten, ob sie tatsächlich zur Ermöglichung von Autonomie und Authentizität beitragen oder Teil einer Verschleierung von Macht und Deutung sind.
Abstract: The digital transformation is progressing incessantly. In the tension between critical reflection and technological actuality, democratic theory too has left behind its deterministic tendencies and technological narrowness. While, on the one hand, greater attention is being paid to ambivalences and affordances of the digital, on the other hand, pragmatic approaches are pushing to experimentally explore its potentials for a crisis of democracy. The latter, however, pursue the transformation of democracy primarily with reformatory intentions and consequently following powerful narratives of pre-digital models of democracy. They are less oriented to the actual functionality of the digital than to their own interpretations towards the digital realization of pre-digital promises. In contrast to notions of a digitized democracy, the article therefore focuses on the importance of the constructed nature of digital technology and reality for realistic democratic theorizing. For the purpose of a normative benchmark, theory needs to evaluate digital democratic structures more in terms of whether they contribute to enabling autonomy and authenticity or if they are part of a concealment of power and interpretation.
1. Einleitung
Dass die digitale Revolution unsere Gesellschaften stärker verändern wird als die industrielle Revolution, gilt heute als Allgemeinplatz in der sozialwissenschaftlichen Debatte. Während die diesbezüglichen Implikationen für die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse bereits intensiv diskutiert wurden, hat eine grundlegende Reflexion über die Entfaltung des Digitalen im Bereich der Politischen Theorie erst in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen (vgl. Jacob/Thiel 2017; Hofmann et al. 2019; Berg et al. 2020). Davon mitunter unabhängig diskutieren demokratietheoretische Debatten bereits seit geraumer Zeit die Potentiale des Digitalen zur Lösung vielfältiger Krisensymptome. Die damit verbundene Suche nach digitalen Möglichkeiten, den historischen Siegeszug der Demokratie und die Einlösung ihrer Versprechen fortzuschreiben, scheint gegenwärtig jedoch dadurch begrenzt, dass sich Konzepte digitaler Demokratie vielmehr an den jeweils eigenen Deutungen der Möglichkeiten und weniger an der tatsächlichen Funktionalität des Digitalen orientieren. Ein solcher Zugriff auf das Digitale, ausgehend von vordigitalen Krisen, Strömungen, Modellen und Paradigmen, birgt jedoch die Gefahr, neue und offene Perspektiven zu unterdrücken beziehungsweise alte machtvolle Demokratieerzählungen im Digitalen zu normalisieren. Was im Rahmen digitaler beziehungsweise digitalisierter Demokratien als normativ wünschenswert und realistisch gilt, entfaltet sich dann als selektive Deutung demokratischer und digitaler Realitäten, die kritisch zu hinterfragen sind.
Ziel des Beitrags ist es, die spezifischen Probleme herauszuarbeiten, die sich durch die Verquickung machtdurchzogener Erzählungen der Demokratie und des Digitalen ergeben. Bezüglich eines gegenwärtigen Realismus innerhalb der digitalen Demokratietheorie widmen wir uns in Kapitel 2 zunächst der prinzipiellen Umstrittenheit des Demokratiebegriffs von Seiten historischer Transformationsprozesse sowie aktueller, postdemokratischer und digitaler, Bedeutungsverschiebungen. Problematisch erscheint uns im Zuge einer zweiten Welle digitaler Demokratie ein pragmatischer Fokus, welcher einen ko-evolutionären Prozess zwischen Demokratie und Digitalisierung über vorgelagerte normative Modelle gestalten will. Daraus resultierend erkennt Kapitel 3 eine Imbalance im Spannungsverhältnis von kritischer Reflexion und technologischer Aktualität, weil gerade das pragmatische Nachdenken über die Demokratie im Digitalen, ausgehend von machtvollen Demokratiemodellen und deren Deutungen digitaler Möglichkeits- und Verwirklichungsräume, mitunter als unrealistisch gelten muss. Angesichts der Notwendigkeit theoretischer Instrumente zur Rechtfertigung realistischer Demokratieentwürfe schlagen wir hier vor, digital-demokratische Strukturen stärker hinsichtlich der tatsächlichen Einlösung ihrer Autonomieversprechen zu bewerten. Auf Grundlage einer techniksoziologischen Beschreibung des Digitalen problematisiert Kapitel 4 daher Aspekte der Konstruktion von Realität sowie die Menschengemachtheit und Kontingenz von Technik für die Theoriebildung. Zum einen, weil auch hier machtvolle Deutungen des Digitalen existieren, die im Zusammenspiel mit selektiven Demokratieerzählungen den Blick auf Theoriealternativen verstellen. Zum anderen, weil digitale Technologien selbst Fragen und Ambivalenzen bezüglich der Produktion von (verdeckten) Deutungen aufwerfen. Das Fazit hält fest, dass sich ein Realismus innerhalb der digitalen Demokratietheorie nicht aus der instrumentellen Logik des Umgangs mit diagnostizierten Demokratiedefekten oder einer deterministischen Sicht auf Technik ergibt, sondern aus der notwendigen Reflexion normativer Demokratiemodelle in Bezug auf die Gemachtheit digitaler Technik und der tatsächlichen Ermöglichung von Autonomie und Authentizität im politischen Prozess.
2. Von (vor-)digitalen Krisen, Versprechen und Transformationen der Demokratie
Folgt man der Annahme, dass der Demokratiebegriff überhaupt nur im Rahmen einer Krisengeschichte zu verstehen ist, weil es kaum Zeiten seiner unhinterfragten Selbstverständlichkeit gegeben hat (vgl. Nolte 2012: 226), erschließt sich ein moderner Siegeszug der Demokratie nur im Kontext einer dreifachen semantischen Transformation: Positivierung, Futurisierung und institutionelle Anreicherung überführen einen auf die Vergangenheit antiker Stadtstaaten bezogenen Negativbegriff in ein positives Zukunftsprojekt moderner Flächenstaaten. Wurden physische Präsenz, aktive Partizipation und autonomes Handeln in der griechischen Polis für die „Beratungen und Beschlüsse der allgemeinen Angelegenheiten und Gesetze“ (Hegel 1986, zit. nach Saage 2005: 40) voraussetzt, haben moderne Demokratien das Moment der direkten Beteiligung zugunsten liberaler Abwehrrechte und des Einbaus eines parlamentarischen Repräsentativsystems weitgehend aufgegeben (vgl. Buchstein 2013a: 105 f.). Einer Standardisierung demokratischen Systemwissens im Sinne eines relativ klar abgesteckten, liberalrepräsentativen Bedeutungskerns (vgl. Raschke 2020: 105) liegt insofern vor allem die erfolgreiche Adaption nationalstaatlicher Massendemokratien hinsichtlich veränderter Umwelt- und Kontextbedingungen zugrunde. Eng verbunden mit diesem ‚Triumph‘ einer hegemonialen „Einheitsvorstellung politischer Ordnungen“ (Brodocz 2015: 24) beziehungsweise der Wahrnehmung moderner Demokratien als Varianten ein und desselben Paradigmas (vgl. Colliot-Thélène 2018: 28) ist dann auch die Realisierung ihrer affirmativen Versprechen (Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Gleichheit, Partizipation, Wohlstand et cetera), an denen sie sich mitunter messen lassen müssen (Buchstein 2013b: 34).
Dass sich die Krise der Demokratie nach wie vor als ein ergiebiges Forschungsprogramm erweist (vgl. Ercan/Gagnon 2014; Przeworski 2019), zeigt sich jedoch weniger an gänzlich neuen Herausforderungen, sondern vielmehr an strukturellen Problemen und Schwachstellen, welche durch die postnationale Konstellation immer weiter offengelegt wurden (vgl. Habermas 1998). Als räumlich und zeitlich versetztes Symptom stellt damit auch der jüngste „populistische Schmerzensschrei“ (McCormick 2017: 41) kein gänzlich neues Phänomen dar, sondern muss als Hinweis auf multiple und interdependente ökonomische, politische und kulturelle Krisen der Demokratie verstanden werden (vgl. Brown 2019; Fukuyama 2018; Manow 2020). Er unterstreicht jedoch, inwiefern angesichts wirtschaftlicher Abstiegsängste, politischer Repräsentationslücken, sozialer Marginalisierung oder kultureller Identitätskonflikte eine umfängliche Einlösung demokratischer Versprechen weiter ausbleibt.
Abseits der fatalistischen Zurkenntnisnahme einer prinzipiellen Inkompatibilität von Spätmoderne und Demokratie sowie vielfältigen vordigitalen Vorschlägen zur Demokratieerweiterung (vgl. Geißel/Newton 2012), plädieren elitendemokratische Ansätze mit Verweis auf eine Gefahr für die Steuerungsfähigkeit moderner Demokratien mitunter erneut dafür, nicht mehr, sondern weniger Partizipation und Selbstbestimmung zu wagen (vgl. Körösényi 2005). Ein entsprechender Lösungsvorschlag ist jedoch nicht zuletzt Ausdruck einer neuerlichen semantischen Begriffstransformation, welche angesichts anhaltender postdemokratischer Diagnosen das Überleben der Demokratie über deren Rationalisierung und Effektivität zu sichern versucht (vgl. Buchstein/Jörke 2003: 471; Crouch 2021). Die partizipativen Momente „einer gleichen und möglichst unmittelbaren Teilhabe an den politischen Entscheidungen“ (Jörke 2011: 169) werden darin als vermeintlich irrationaler, ineffektiver und realitätsentrückter Ballast einer republikanischen Säule weitestgehend abgeschüttelt und die Demokratietheorie läuft hier im schlimmsten Fall Gefahr, sich der fatalistischen Unterordnung zugunsten einer alternativlosen Organisation, Verwaltung und Strukturierung von Politik fügen zu müssen (vgl. Buchstein/Jörke 2003: 476).
Gegenüber solchen Rationalitäts-, Effektivitäts- und Steuerungserwägungen der postnationalen Konstellation finden sich emanzipatorische Transformationsversuche der Demokratie heute vor allem im Rahmen der digitalen Konstellation (vgl. Berg et al. 2020). Aus historischer Perspektive ist eine demokratietheoretische Beschäftigung hier zwar keineswegs neu, angesichts hoher Veränderungs- und Ausbreitungsraten des Digitalen ist diese jedoch geprägt von unterschiedlichen Wellen und sich wandelnden Bildern einer digitalen beziehungsweise E-Demokratie. Dominierten während den 1980er und 1990er Jahren Perspektiven einer Tele- beziehungsweise virtuellen Demokratie, welche neue Visionen entwickelten, um die räumliche wie politische Trennung der Bürger:innen mit dem Ziel einer direkten Demokratie ohne vermittelnde Institutionen zu überwinden, hat die Forschung seit dem Jahrtausendwechsel weitgehend Abstand von stark utopischen beziehungsweise revolutionären Entwürfen genommen (vgl. Vedel 2006: 226 ff.). Im Fokus standen zunächst reformierende Absichten, welche eine möglichst breite Partizipation und gute Repräsentation unter dem Schlagwort Web 2.0 zu ermöglichen versuchten. Dagegen betonten Perspektiven einer Netzwerk-Demokratie diesbezüglich den formativen Einfluss digitaler Strukturen auf demokratische Institutionen (vgl. Deseriis 2020: 3; Berg/Hofmann 2021: 5).
Waren frühe Arbeiten zudem stark von einer dichotomen Gegenüberstellung zwischen Technikeuphorie und -pessimismus bestimmt (vgl. Norris 2001), trägt die neuere Forschung nicht nur den Ambivalenzen in der Ausbreitung digitaler Technik Rechnung (vgl. Kersting 2012; Fleuß et al. 2019), sondern bezieht auch das spezifische Wechselverhältnis von Digitalisierung und Demokratie stärker mit ein (vgl. Berg et al. 2020).
Ein verbindender Aspekt einer „second wave of digital democracy“ (Gerbaudo 2019: 106) findet sich jedoch in der Prämisse, dass bestehende Demokratien prinzipiell für veränderbar gehalten werden, das heißt, sich deren empirische Bedingungen, Institutionen und Praktiken mit Hilfe digitaler Technologien positiv beeinflussen lassen. Gegenüber den vorhandenen de-institutionalisierenden Aspekten, die vordigitale demokratische Institutionen und Prozesse unterlaufen, liegt somit ein pragmatischer Fokus auf den Potentialen digitaler Technologien, welche es – im Sinne der politischen Selbstbestimmung der Subjekte – in empirischen und experimentellen Umgebungen in die Praxis umzusetzen gilt (vgl. Berg/Hofmann: 7; Deseriis 2019: 2; Hofmann et al. 2019: 11 f.). Jedoch hat gerade die Anerkennung von Funktionslogiken im Rahmen einer „netzrealistischen Perspektive“ (Kneuer 2013: 8) und die spezifische Auseinandersetzung mit kleinteiligen Untersuchungsgegenständen (Beratungs- und Entscheidungssoftware, algorithmische Systeme et cetera) mitunter dazu geführt, „[that] the field as a whole seems to have missed […] a higher level of abstraction“ (Deseriis 2019: 2). Dies gilt bezüglich normativer Modelle und Kriterien einerseits, weil die aktuelle Dominanz deliberativer Strömungen die neuen experimentellen Praktiken und Institutionen bestimmt und andererseits, weil sich die Betonung eines ko-evolutionären Prozesses zwischen Demokratie und Digitalisierung (vgl. Hofmann 2019: 30) auf jene real-existierenden Demokratien stützt, deren hegemoniales, liberal-repräsentatives Paradigma trotz der „sehr wechselhaften Füllung des Demokratiebegriffs in der Geschichte der politischen Ideen“ auch im Digitalen „einen seltsam universalen Zug behauptet“ (Thiel 2019: 52; vgl. auch Schmitter 2017).
3. Zum Realismus einer digitalen Transformation der Demokratietheorie
Nicht zuletzt im Verweis auf eine pragmatische oder netzrealistische Perspektive wird deutlich, dass die Politische Theorie in der digitalen Konstellation vor einer prinzipiellen Herausforderung steht, weil sie in der Auseinandersetzung mit dem Digitalen die Wahrung ihrer bewussten, kritischen Distanz zum Ereignishaften und Konkreten zu einem gewissen Grad aufgeben muss (Jacob/Thiel 2017: 9). Dies gilt für die Demokratietheorie jedoch nicht nur in Bezug auf das Wechselverhältnis von Demokratie und Digitalisierung, sondern auch für die disziplinäre Debatte zwischen historischer Genese, normativer Begründung und empirischer Analyse. Fragen nach dem gegenwärtigen Realismus einer digitalen Transformation innerhalb der Demokratietheorie stellen sich daher nicht erst in Bezug auf das Funktionieren und Verständnis eines unscharfen Begriffes der digitalen Demokratie (vgl. Berg/Hofmann 2022: 2; Borucki et al. 2021: 360), sondern stets grundlegend für die Demokratie als umstrittenen Begriff an sich. Für Entwürfe demokratischer Zukunftsszenarien hat Benjamin Barber (1998: 585) daher treffend festgehalten, dass die Rolle digitaler Technologie nur dann angemessen in die Diskussion einfließen kann, wenn Klarheit hinsichtlich eines Demokratiebegriffs beziehungsweise allgemein anerkennenswerter Grundwerte und Geltungsansprüche besteht: „unless we are clear about what democracy means to us, and what kind of democracy we envision, technology is as likely to stunt as to enhance the civic polity“.
Eine politikphilosophische Debatte um Möglichkeiten realistischer Theoriebildung verweist hier aber zurecht auf die problematischen Vorbedingungen eines politischen Moralismus, der als high liberalism gerade auf die falsche Weise utopisch ist, weil er versucht, vermeintlich konsensfähige Modelle und Prinzipien zu verordnen. Demgegenüber steht ein politischer Realismus, welcher in der Politik die Autonomie der Moral vorlagern will, um nach jenen Umständen zu fragen, in denen akzeptable Antworten auf Ordnung, Macht und Legitimation gefunden werden können (vgl. Galston 2010: 287 ff.; Hall 2015: 294; Rossi/Sleat 2014: 654).1 In Bezug auf das wording ‚realistisch‘ könnten die Implikationen für eine Demokratie im Digitalen dann jedoch nicht unterschiedlicher sein. Setzt Ersterer für normative Modelle den robusten Test und die Berücksichtigung der politischen wie gesellschaftlichen Realitäten und digitaler Affordanzen voraus, weist Letzterer die Vorgabe idealer Modelle und moralischer Prinzipien beziehungsweise Versprechen als unrealistisch zurück. Politische Theorie kann vor allem dann als realistisch gelten, wenn sie nicht mit der Explikation moralischer Ideale und Konzepte beginnt, sondern mit einem interpretativen Verständnis der Praxis und Bedingungen von Politik selbst (vgl. Rossi/Sleat 2014: 690; Hall 2015: 284). Letzteres gilt für Fragen einer digitalen Transformation der Demokratie zum einen, weil das Digitale in Bezug auf die Strukturen des politischen Lebens und die Koordination von Freien und Gleichen zunehmend an Bedeutung gewinnt, und zum anderen, weil technisch geprägte Vorstellungen gesellschaftlicher Steuerung im modernen Verfassungsstaat prinzipiell mit der Autonomie der Subjekte konkurrieren (Schulz 2021).
1 Um angesichts des sich verändernden Charakters von Macht und Legitimation im Internetzeitalter willkürliche Grenzziehungen zwischen moralischer politischer Philosophie und realer Machtpolitik zu überwinden, hat bereits David Runciman einen realistischen Zugang eingefordert, der die neuen, guten wie schlechten, Möglichkeiten von Politik auslotet. Im Sinne von Bernard Williams basic legitimation demand ist eine Kritik an bestehenden Machtstrukturen demnach überall dort anzuwenden, wo rechenschaftsfreie Formen den Test ihrer Legitimität mit Verweis auf einen „pursuit of something better than messy politics“ (Runciman 2017: 17) verweigern. Wir beziehen uns hier jedoch stärker auf die Debatte zwischen politischem Realismus und nichtidealer Theorie, welche auf den Unterschied zwischen politischen und moralischen Werten bei der Begründung von politischer Ordnung abzielt und darüber versucht, der Politik, als Sphäre menschlichen Handelns, mehr Autonomie zu verleihen (Rossi/Sleat 2014).
* * *
 Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist im Open Access in Heft 1+2-2022 unserer ZPTh – Zeitschrift für Politische Theorie erschienen.
Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist im Open Access in Heft 1+2-2022 unserer ZPTh – Zeitschrift für Politische Theorie erschienen.
© Unsplash 2023, Foto: Joshua Sortino