Eine Leseprobe zum Thema Musik und Jugendkulturen aus unserer Zeitschrift Diskurs Kindheits- und Jugendforschung / Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research.
***
Bewegte Jugend – bewegende Musik? Ein Versuch über den Zusammenhang von Jugendkulturen und Szenen, Pop- und Rockmusik sowie sozialen (Jugend-)Bewegungen
Carsten Heinze
Diskurs Kindheits- und Jugendforschung / Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research, Heft 1-2023, S. 27-49.
Zusammenfassung
Der Beitrag wirft die Frage nach dem Zusammenhang von musikzentrierten Jugendkulturen und Szenen, Pop- und Rockmusik sowie sozialen (Jugend-)Bewegungen in Vergangenheit und Gegenwart auf. Popmusik und Rockmusik bildet in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine zentrale kulturelle Ausdrucksform in Jugendkulturen und Szenen. Desgleichen gehört jugendliches Protestverhalten zur soziokulturellen Praxis Jugendlicher. Daraus wird die Frage abgeleitet, ob und inwiefern spezifische Musik in musikzentrierten Jugendkulturen und Szenen mit sozialen (Jugend-)Bewegungen zusammengebracht werden kann. Es wird selektiv auf historische Entwicklungen der Popmusik und Rockmusik eingegangen. Mit dieser historischen Perspektive soll hinterfragt werden, ob überhaupt und welche Musik soziale (Jugend-)Bewegungen beeinflusst und geprägt hat, und nach belegbaren Beispielen dafür gesucht werden. Abschließend wird ein Blick auf aktuelle Zusammenhänge geworfen und auf Entwicklungen hinsichtlich rechter musikkultureller Erlebniswelten eingegangen.
Schlagwörter: Jugendbewegung, Protestbewegung, Soziale Bewegung, Jugendkultur, Szenen, Popmusik, Rockmusik
Moving youth through music? Youth culture, pop music and their relation to juvenile social movements
Abstract
The article raises the question of the connection between music-orientated youth cultures, pop music and juvenile social movements in the past and present. In the second half of the 20th century, pop music is a central form of cultural expression in youth cultures. Likewise, juvenile social protest behaviour is part of the socio-cultural practice of young people. From this, the question is derived as to whether and to what extent specific music can be brought together in music-orientated youth cultures with juvenile social movements. Historical developments in pop music are dealt with selectively. With the historical perspective, the aim is to question whether and which music has influenced and shaped juvenile social movements at all, and to look for verifiable examples of this. Finally, a look is taken at current connections and developments with regard to right-wing music worlds of experience are discussed.
Keywords: Pop music, juvenile social movements, youth culture, youth protest, history of pop music
1 Einleitung
Der folgende Beitrag möchte die Frage aufwerfen und zu einer Diskussion anregen, ob und inwieweit ein Zusammenhang zwischen musikzentrierten Jugendkulturen und Szenen sowie ihrer popmusikalischen und rockmusikalischen Ausdrucksformen und sozialen (Jugend-) Bewegungen besteht. Auch wenn ein solcher Zusammenhang naheliegt – historisch betrachtet gehen Pop- und Rockmusik aus musikzentrierten Jugendkulturen und Szenen hervor, obwohl heutzutage Popkultur im weitesten Sinne kein Privileg der Jugend mehr ist (Hecken & Kleiner, 2017, S. 4) –, muss die empirische Beweislast über sämtliche musikzentrierte Jugendkulturen und Szenen hinweg im Einzelnen mit Blick auf soziale (Jugend-)Bewegungen erst noch erbracht werden. Zweifellos entwickeln sich um die Musikkulturen des Metal, Punk, Rap, Techno, Gothic und anderen Musikgenres musikzentrierte Jugendkulturen und Szenen. Aus diesen und anderen musikalischen Bereichen ertönen ihre Songs auch in politisch orientierten, sozialen (Jugend-)Bewegungen, jedoch erscheint das Verhältnis zwischen diesen und den verschiedenen Musikkulturen volatil. So offensichtlich ein derartiger Zusammenhang auf den ersten Blick also erscheinen mag, muss doch bei genauerem Hinsehen gefragt werden, ob ästhetische Praktiken, die zur Erschaffung musikalischer Kunst-/Künstler*innen-Figuren führen und sich über verklanglichte Sprache und einen spezifischen, durchaus wandelbaren Habitus artikulieren, innerhalb der Popmusik und Rockmusik auf politische Proteste übertragbar sind (Roth & Rucht, 2000a)? Folgen musikalische Ausdrucksformen nicht vielmehr den Eigengesetzlichkeiten künstlerischer Praxis und engen die kommerziellen Bedingungen der Kulturproduktion politische Handlungsspielräume nicht eher ein oder verhindern diese gar (zu einer entsprechenden Kritik der Gegenkulturen, siehe Heath & Potter, 2011)? Und, so wäre zu ergänzen, welche spezifischen Pop- und Rockmusikkulturen lassen sich überhaupt mit sozialen (Jugend-)Bewegungen in Beziehung setzen und stehen mit diesen in einer nachweisbaren Verbindung? Zwar mögen der Sound und die Kultur Jugendlicher bzw. Junggebliebener den klanglichen Hintergrund sowie die identitäts- und gemeinschaftsbildende, affektiv aufgeladene und emotionalisierende Projektionsfläche sozialer (Jugend-)Bewegungen nach wie vor bilden und deren „Ästhetisierungen“ (Reckwitz, 2015, S. 13–52) eine Versinnlichung des Protests verstärken. Jedoch ist damit noch nicht belegt, ob die protestorientierte Aneignung und politische Bedeutungszuschreibung, die Popmusik und Rockmusik in sozialen (Jugend-)Bewegungen erfahren, tatsächlich auf deren künstlerische Absichten und Überzeugungen zurückgeführt werden können. Sind Musikkulturen, Bands und Musiker*innen für Protestformen überhaupt zu gebrauchen, politischer und ästhetischer Ausdruckswille miteinander vereinbar?
Offenbar lässt sich im Hinblick auf die Frage nach den Zusammenhängen von Popmusik und Rockmusik mit sozialen (Jugend-)Bewegungen sowie deren Vereinnahmung bzw. Nutzung in besondere Weise zwischen den Bedingungen der Kulturproduktion von Popmusik und Rockmusik sowie deren Rezeption als Zuschreibungspraxis unterscheiden. Zudem rückt das Verhältnis von musikzentrierten Jugendkulturen und Szenen sowie sozialen (Jugend-)Bewegungen in den Vordergrund. Den aufgeführten Fragen soll sich in diesem Beitrag angenähert werden.
Unüberhörbar ist Popmusik und Rockmusik, historisch betrachtet, ein klanglich-kultureller Hintergrund verschiedener sozialer (Jugend-)Bewegungen und soziale (Jugend-)Bewegungen greifen auf Musik zur Begleitung von Protesten und ihrer sinnlichen Erfahrbarkeit und Rhythmisierung zurück. Es kann zudem von einer Nähe zwischen musikzentrierten Jugendkulturen und Szenen sowie sozialen (Jugend-)Bewegungen ausgegangen werden, die sich nicht nur über Musik, sondern einen gemeinsam geteilten, soziokulturellen Habitus herstellen. Zwingend ist diese Nähe allerdings nicht und gilt sicherlich nicht pauschal, sondern vermutlich nur für spezifische Jugend- als Musikkulturen. Um Protesthaltung und Widerspenstigkeit, die sich über Musikkulturen nicht nur im engeren Sinne der Musik, sondern im erweiterten Sinne über einen über die Musik hinausgehenden soziokulturellen Habitus artikuliert, zu untersuchen, ist daher ein kursorischer Blick in die historische Entwicklung der Popmusik und Rockmusik (nach dem 2. Weltkrieg) zu werfen und deren Alterungsprozess nachzuzeichnen – denn mit dem Altern von musikzentrierten Jugendkulturen und Szenen verändert sich auch deren kulturelle Bedeutung und mündet in eine altersoffene Entgrenzung von musikzentrierten Jugendkulturen und Szenen, in der die unterhaltende Eventisierung von Action-Szenen über den politischen Protest die Oberhand zu gewinnen scheint (siehe die Unterscheidungen in Baacke, 2007, S. 18–39). Roland Roth und Dieter Rucht (2000b) stellen im Übergang zum 21. Jahrhundert fest, dass von der Aufbruchstimmung der 1960er Jahre, in der soziale (Jugend-)Bewegungen und Jugendkulturen und Szenen noch enger miteinander verknüpft waren, jedenfalls nicht mehr viel übriggeblieben ist: „Dass von dieser Vision zu Beginn des 21. Jahrhunderts in der breiten Öffentlichkeit nur noch wenig zu spüren ist, bestätigt indirekt die Vermutung, dass die jugendbewegte Hoffnung, mit der nachwachsenden Generation breche eine neue Zeit an, wenn man ihr die dafür nötigen Freiräume schafft, nicht mehr überzeugen kann“ (S. 12). Woran kann diese Entpolitisierung liegen? Die Veränderungen von Bedeutungszuschreibungen und Bedeutungsproduktionen innerhalb der Popmusik und Rockmusik ist auf einen soziokulturellen Wandel zurückzuführen. Jugendkulturen und Szenen werden mittlerweile ästhetisch hinsichtlich ihrer materialen und medialen Inszenierungen untersucht (Böder et al., 2019), nicht auf ihr Widerstands- und Protestpotential. Aber kann darin Popmusik und Rockmusik als kulturelles Element unter ästhetisch-materialen Gesichtspunkten noch politische Botschaften vermitteln, kann sie politische und kollektivierende Protest-Wirkungen entfalten? Es ist zu bedenken, dass gesellschaftliche Kontexte und soziale Konflikte in einem jeweiligen Spannungsverhältnis zu musikzentrierten Jugendkulturen und Szenen stehen und maßgeblich in deren Entstehung und Veränderung sowie ihren pop- und rockmusikalischen Ausdruck hineinwirken. Es lässt sich fragen, ob diese Konflikte noch über Popmusik und Rockmusik ausgetragen werden können? So kann der historische Bedeutungswandel der Popmusik und Rockmusik möglicherweise auch auf einen Alterungsprozess zurückgeführt werden, in dessen Zuge sich Generationenkonflikte (die in der Tat lange Zeit auch über die Musik ausgetragen wurden) abmildern oder ganz verschwinden. Zeichnet sich aber vor dem Hintergrund einer beobachtbaren Zunahme von regionalen und globalen Krisenphänomenen in der Welt und neuen Polarisierungen innerhalb der Gesellschaft ein Wiedererwachen des politischen Bewusstseins in Popmusik und Rockmusik ab, welches anschlussfähig an soziale (Jugend-)Bewegungen in der Gegenwart ist?
2 Musikorientierte Jugendkulturen und Szenen
Der Begriff Jugendkulturen und Szenen wird häufig gleichbedeutend verwendet. Während die Bezeichnung Jugendkulturen oder Jugend(sub)kulturen ursprünglich auf die Kulturgeschichte der Jugend und ihre performativen, mitunter subkulturellen, abweichenden Selbstinszenierungen verweist (Ferchhoff et al., 1995; Baacke, 2007; Ferchhoff, 2007) und als Bezeichnung bereits in der Jugendbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts verwendet wurde (Rüegg, 1974), bis er dann im Rahmen der britischen Cultural Studies in den 1970er Jahren empirisch auf verschiedene Jugend(sub)kulturen erfolgreich Anwendung fand (Clarke et al., 1979; Willis, 1981), wurde alternativ und in Abgrenzung zu devianten Vorstellungen jugendkultureller Praxis der Begriff der „Szene“ als „posttraditionale, juvenile Vergemeinschaftung“ vorgeschlagen (Hitzler & Niederbacher, 2010). Unter „Szenen“ verstehen Hitzler und Niederbacher (2010, S. 15–16) „lockere Netzwerke“ mit „unbestimmt vielen beteiligten Personen“, die themenzentriert (z. B. Musik) ihre Interessen verfolgen und sowohl lokal als auch global geprägt und aktiv sind. Szenen werden jugendsoziologisch vor allem unter individualisierungs- und modernisierungstheoretischen Gesichtspunkten relevant, so dass gesellschaftliche Differenzierungsprozesse auf die Entwicklungen von Szenen zurückwirken, die dadurch partikularer und schnelllebiger werden, wozu auch der beschleunigte Prozess der Mediatisierung beiträgt. Ein besonderes Merkmal von Szenen ist ihre spezifische Offenheit und Unverbindlichkeit, so dass man problemlos ein- und wieder austreten kann oder sogar Angehörige*r mehrerer Szenen sein kann. Szenen haben ihre jeweils eigene Kultur, die themenzentriert szenespezifische Praktiken orientiert (Hitzler & Niederbacher, 2010, S. 18). Im Szene-Begriff ist zumindest latent die angesprochene Altersentgrenzung enthalten, da anzunehmen ist, dass „Ex-Punk-/Ex-Rocker-/Ex-Technodasein über ihre Träger zumindest in Teilen in späteres Leben einfließt“ (Hietzge, 2019, S. 253), was den sozialstrukturellen Rahmen der Teilhabe an Szenen von der Jugendkultur offenbar unterscheidet.
Zum älteren Begriff der Jugend(sub)kultur1 gibt es Überschneidungen, aber auch Unterschiede. Schon der Bezug zur „Jugend“, der diese Kulturen offenbar auf eine Altersphase begrenzt, wirft angesichts heutiger Alterungsprozesse Fragen auf. Jugendkulturen, so Maase (2003, S. 40), setzen sich von der „Normalkultur“ ab und kennzeichnen „Verhaltensformen, Präsentationsstile und Richtungen der Populärkultur“, wobei nach Maase drei Merkmale unstrittig zu sein scheinen. Erstens sind Jugendkulturen nicht „zufällig“ oder „harmlos“, sie grenzen sich bewusst zur Erwachsenenwelt ab. Ihre Objekte und Praktiken haben zweitens einen kommerziellen Charakter und sind „kapitalistische Waren“, die von Jugendlichen in der kulturellen Praxis eigensinnig angeeignet und gedeutet werden. Und drittens wird davon ausgegangen, dass praktisch alle Jugendlichen auf die eine oder andere Art und Weise Jugendkulturen im Prozess der Sozialisation durchlaufen und jugendkulturelle Erfahrungsbildung zur „Normalbiografie“ gehören. Sie bilden aus Sicht der historischen Sozialisationsforschung (Gestrich, 1999) einen relevanten Erfahrungsraum Jugendlicher, so dass unterstellt werden kann, dass alle Generationen nach 1945 auf die eine oder andere Art und Weise von unterschiedlichen Jugendkulturen beeinflusst wurden und in Berührung mit verschiedenen Formen der Popmusik und Rockmusik gekommen sind. Jugendkulturen vereinen in sich „Widerstand und Kommerzialisierung“ (Maase, 2003, S. 41), was einerseits auf ihr kritisches und transformatorisches Potential der kulturellen Innovation verweist, andererseits aber die kapitalistisch organisierte „Kulturindustrie“ (Horkheimer & Adorno, 1969) am Laufen hält, und damit kulturelle Innovation und Transformation nur in einem begrenzten Rahmen, der die Gesellschaft als Ganzes nicht zu berühren in der Lage ist, erlaubt.
Auch wenn der Szene-Begriff die Alterung miteinschließt und weniger festgelegt zu sein scheint, so spricht für die Verwendung des Begriffs der Jugendkulturen, dass gerade im Jugendalter die Auseinandersetzung mit Szenen und kulturellem Szenewissen in erhöhtem Maße stattfindet, was allerdings nicht bedeutet, dass die zur Partizipation zugehörenden Praktiken in Jugendkulturen nur von Jugendlichen ausgeübt werden. Der Zugang zu, der Eintritt in und das Interesse an Jugendkulturen beginnt aber in aller Regel im Jugendalter und in dieser Lebensphase ist das Eintauchen in die kulturellen Angebote hoch. Szenen entstehen aus Jugendkulturen im Prozess ihrer Differenzierungen. Auch Popmusik und Rockmusik als kulturelle Praxis sind nicht zwingend an das Jugendalter gebunden, dennoch ist auch hier die Lebensphase Jugend als Alterseinstieg in eine Band oder die ersten Entwicklungsschritte als Musiker*in über sämtliche Musikkulturen hinweg vorherrschend. Umgekehrt scheint es eher ungewöhnlich zu sein, erst im späteren Alter ohne vorherige Erfahrungen in musikzentrierte Jugendkulturen einzusteigen oder gar eine pop- und rockmusikalische Band zu gründen.
Für die Frage nach dem Bedeutungswandel und dem Alterungsprozess von musikzentrierten Jugendkulturen und Szenen und deren Verhältnis zu sozialen (Jugend-)Bewegungen ist festzuhalten, dass alle Jugendkulturen in einem gewissen Sinne „alt“ sind (Farin, 2010, S. 3–8) und somit eine eigene Geschichte und Genealogie haben, deren Erfolg sich ab den 1950er Jahren vor allem in musikzentrierten Jugendkulturen und Szenen entfaltet, auch wenn die Geschichte der populären Musik noch weiter zurückreicht (Wicke, 2001) und Popmusik (etwa Hoyer et al., 2017) und Rockmusik (Wicke, 1987) kulturhistorisch in ihren Entwicklungen jeweils unterschiedlich zu betrachten und einzuordnen sind. Diese musikzentrierten Jugendkulturen stehen kulturhistorisch – das verdeutlichen aktuell unzählige Aufarbeitungen über Musiker*innen, Bands und Szenen – in einem komplexen Zusammenhang mit regionaler und globaler Gesellschaftsgeschichte, in der soziale (Jugend-) Bewegungen eine nicht unerhebliche Rolle spielen.
___
1 Es kann hier nicht weiter der Unterschied zwischen Jugendkulturen und Subkulturen und der Begriffskonstruktion der Jugend(sub)kultur diskutiert werden, mit deren Differenzierung Tendenzen der Subversion und des Mainstreamings gleichermaßen auf den Begriff gebracht werden sollen.
* * *
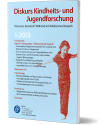 Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist in Heft 1-2023 unserer Zeitschrift Diskurs Kindheits- und Jugendforschung / Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research erschienen.
Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist in Heft 1-2023 unserer Zeitschrift Diskurs Kindheits- und Jugendforschung / Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research erschienen.
Der Autor
Prof. Dr. Carsten Heinze ist Universitätsprofessor für Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Technischen Universität Dresden.
Mehr Leseproben …
… finden Sie auf unserem Blog.
© Unsplash 2023, Foto: bumblebib


