Politisierung der Ressortforschungseinrichtungen in Deutschland
Sylvia Veit, Falk Ebinger
dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management, Heft 2-2024, S. 301-335.
Zusammenfassung: In Deutschland greifen die Bundesministerien für wichtige Aufgaben in Forschung, Beratung und Vollzug auf ein breites Arsenal an Ressortforschungseinrichtungen zurück. Diese Einrichtungen unterscheiden sich deutlich in Rechtsform, Aufgabenportfolio und öffentlicher Sichtbarkeit. Gemeinsam ist ihnen ihre Zwitterstellung zwischen Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung. Sie sind wissenschaftlichen Grundsätzen verpflichtet, unterliegen jedoch auch dem Einfluss „ihrer“ Ministerien, was Fragen nach der Unabhängigkeit ihrer Arbeit aufwirft. Der vorliegende Beitrag charakterisiert diese weithin unbekannten Einrichtungen. Er fragt, wie sich Ressortforschungseinrichtungen heute im wissenschaftlichen Feld verorten, in welchem Ausmaß sie politisch gesteuert werden und wie ausgeprägt die funktionale Politisierung des Leitungspersonals dieser Einrichtungen im Vergleich zu Bundesoberbehörden und Bundesministerien ist. Datenbasis ist der PAE-Survey 2021.
Schlagworte: Ressortforschung, Politisierung der Verwaltung, Verwaltungseliten, Spitzenbeamte, Bundesoberbehörden
Politicization of Governmental Research Agencies in Germany
Abstract: In Germany, federal ministries rely heavily on an arsenal of governmental research agencies for a wide range of research, policy advice, and implementation tasks. These institutions vary considerably in terms of their legal form, portfolio of tasks, and public visibility. What they have in common, however, is their hybrid position between science and public administration. They are committed to scientific principles, but they are also subject to the influence of “their” ministries. This could compromise the independence of their work. This article characterises these largely unknown institutions. The article examines how governmental research agencies position themselves in the scientific field today, to what extent they are politically controlled and how pronounced the functional politicisation of the management staff of these institutions is in comparison to both other federal agencies and federal ministries. The data is based on the PAE Survey 2021.
Keywords: governmental research agencies, politicization of bureaucracy, administrative elite, top civil servants, executive agencies
1 Einleitung
Dass Ressortforschungseinrichtungen wichtige Akteure im politischen Prozess sein können, war vielen Menschen lange nicht bewusst. Während der Corona-Pandemie hat sich dies geändert: In dieser Zeit war das Robert-Koch-Institut (RKI), eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums, so präsent, dass Name und Profil der Einrichtung mittlerweile in breiten Bevölkerungsschichten bekannt sein dürften (zur Beratungsrolle des RKI siehe z. B. Böcher et al., 2021). Am Mauerblümchen-Dasein der Ressortforschungseinrichtungen in der verwaltungswissenschaftlichen Forschung hat das jedoch wenig geändert. Während Ministerien, zentralstaatliche Vollzugsbehörden und insbesondere die Kommunen vergleichsweise intensiv beforscht werden, gibt es zu Ressortforschungseinrichtungen kaum verwaltungswissenschaftliche Arbeiten (siehe auch Galanti & Lippi, 2023). Einer der wenigen Verwaltungswissenschaftler aus dem deutschsprachigen Raum, der zu Ressortforschungseinrichtungen gearbeitet hat, ist Marian Döhler. Ihm ist dieser Beitrag gewidmet.
Marian Döhlers Forschungsarbeiten zu Ressortforschungseinrichtungen (bzw. Wissenschaftsbehörden) sind zu einer Zeit entstanden, als die Positionierung von Ressortforschungseinrichtungen im wissenschaftlichen Feld zunehmend umstritten war. Hintergrund war eine Evaluation der Ressortforschungseinrichtungen des Bundes durch den Wissenschaftsrat, die 2010 abgeschlossen wurde. In verschiedenen soziologischen Forschungsarbeiten jener Zeit wurde herausgearbeitet, wie sich die Ressortforschungseinrichtungen im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Politik positionieren und mit den unterschiedlichen Handlungsorientierungen des politischen und des wissenschaftlichen Feldes umgehen (z. B. Barlösius, 2011; Bonacker, 2016). Marian Döhler interessierte sich vor allem für die organisationale Positionierung und Rollenzuweisung der Ressortforschungseinrichtungen als multifunktionale Organisationen (Bach & Döhler, 2012). Schwerpunkte seiner Forschung liegen auf Fragen der politischen Steuerung der Verwaltung sowie auf der Frage, innerhalb welcher Strukturen und Prozesse und durch welche Akteure entscheidungsrelevantes Wissen in den Policy-Prozess eingespeist wird (Döhler, 2012, 2007, 2022).
Der vorliegende Beitrag greift auf neue Befragungsdaten zu den Ressortforschungseinrichtungen des Bundes in Deutschland zurück, die im Rahmen des Politisch-Administrative-Elite Surveys (kurz: PAE) 2021 erhoben wurden. PAE ist eine Befragungsstudie des administrativen Spitzenpersonals in Deutschland, die seit 2005 regelmäßig im Jahr der Bundestagswahl durchgeführt wird. Fokussierte sich PAE ab 2005 zunächst nur auf die Bundesministerien (Schwanke & Ebinger 2006), kamen 2013 erstmals die Bundesoberbehörden, Ressortforschungseinrichtungen und Landesministerien hinzu (Beneke et al., 2023; Ebinger et al., 2018).
Da bisher das Feld der Ressortforschungseinrichtungen nicht systematisch auf Basis quantitativer Befragungsdaten aufbereitet wurde, wird in diesem Beitrag ein explorativer Ansatz zur ersten Vermessung des Feldes gewählt. Drei Fragen stehen im Zentrum des Erkenntnisinteresses dieses Artikels: 1) Wie verorten sich Ressortforschungseinrichtungen heute im wissenschaftlichen Feld? 2) In welchem Ausmaß werden Ressortforschungseinrichtungen politisch gesteuert? 3) Inwiefern ist das Leitungspersonal in Ressortforschungseinrichtungen funktional politisiert?
Zur Diskussion der drei Forschungsfragen wird insbesondere auf die Daten von PAE 2021 für Ressortforschungseinrichtungen (PAE 2021 RFE) zurückgegriffen. Um die institutionellen Effekte der unterschiedlichen Organisationsformen und Aufgaben zu verdeutlichen, werden an einigen Stellen die Teildatensätze von PAE 2021 für Bundesoberbehörden (PAE 2021 BOB) und Bundesministerien (PAE 2021 BMin) zum Vergleich herangezogen. Es ist bekannt, dass die Intensität politischer Steuerung zwischen den Ressortforschungseinrichtungen variiert (Barlösius, 2016). Grund kann insb. die variierende politische Salienz des bearbeiteten Themas sein. Ziel der vorliegenden Betrachtung ist es jedoch nicht, vertieft auf die Varianz innerhalb dieser heterogenen Gruppe einzugehen. Stattdessen soll der Vergleich mit den Referenzgruppen der Bundesministerien und der Bundesoberbehörden in den Mittelpunkt gestellt werden.
Nachfolgend wird zunächst der bisherige Forschungsstand zu Ressortforschungseinrichtungen umrissen. Ausgehend davon werden theoretische Erwartungen zu den drei forschungsleitenden Fragestellungen formuliert. Anschließend erfolgt eine detaillierte Beschreibung der Datengrundlage, bevor die oben genannten Forschungsfragen in drei getrennten Abschnitten auf Basis der PAE-Daten vertieft erörtert werden. Der Artikel endet mit einer abschließenden Diskussion, an deren Ende zukünftige Forschungsbedarfe aufgezeigt werden.
2 Ressortforschungseinrichtungen in der verwaltungswissenschaftlichen Forschung
Während Ministerialverwaltungen lange Zeit als die zentralen Beratungsinstitutionen der Regierungen bzw. der Minister:innen demokratischer Staaten in inhaltlichen Fragen galten, ist deren herausgehobene Stellung und Rolle zunehmend umstritten (Hustedt & Veit, 2017; Peters & Savoie, 2024; Döhler, 2020). Unter Stichworten wie Externalisierung, Politisierung oder Pluralisierung wird in der internationalen Literatur darauf hingewiesen, dass außerhalb und innerhalb des politisch-administrativen Systems neue Akteure hinzugekommen sind, die das Policy-Beratungsmonopol der Ministerialverwaltungen zunehmend in Frage stellen oder dieses – möglicherweise – längst zum Verschwinden gebracht haben (van den Berg, 2017; Craft & Howlett, 2013; Galanti & Lippi, 2023). Egal wie man die Stellung der Ministerien genau bewertet und unabhängig von den unzweifelhaft vorhandenen politikfeldspezifischen Unterschieden (Beneke und Döhler, 2021) – Fakt ist, dass es vielfältige interne und externe Beratungsanbieter gibt, auf die Regierungen zurückgreifen können, um sich in Fragen der Politikgestaltung beraten zu lassen oder ihre Entscheidungen zu legitimieren. Zu Ersteren gehören neben den Ministerien auch nachgeordnete Behörden (Agencies) (Bach & Verhoest, 2012), Ressortforschungseinrichtungen (Veit et al., 2017) sowie ministerielle Kabinette oder sogenannte ministerial advisers (auch: political advisers) (siehe z. B. Shaw, 2023; Craft, 2013). Zu Zweiteren zählen unter anderem kommerzielle Beratungsunternehmen, Think Tanks und externe Forschungseinrichtungen (Hustedt et al., 2010; Laage‐Thomsen, 2022; Howlett & Migone, 2013). Hinzu kommen Akteure, die weder eindeutig intern noch klar extern zu verorten sind. Hierzu gehören beispielsweise von der Regierung eingesetzte Kommissionen, aber auch Sachverständigenräte oder wissenschaftliche Beiräte von Ministerien (Veit et al., 2017; Christensen & Holst, 2017; Hesstvedt & Christiansen, 2022).
Das policy advisory system der deutschen Bundesregierung ist im Einklang mit diesen internationalen Entwicklungen ebenfalls durch eine komplexe Akteursvielfalt gekennzeichnet (Veit et al., 2017; Beneke und Döhler, 2021). Allerdings stellen die Ressortforschungseinrichtungen des Bundes durchaus ein Spezifikum des deutschen Falls dar, sichern sie doch ein im Vergleich zu vielen anderen Ländern besonders stabiles internes wissenschaftliches Beratungsangebot ab (Philipps, 2011; Hustedt et al., 2010). Laut dem aktuellsten „Bundesbericht Forschung und Innovation“ aus dem Jahr 2024 gibt es auf Bundesebene derzeit 49 Ressortforschungseinrichtungen. 42 davon sind dort als „Bundeseinrichtungen mit Aufgaben im Bereich von Forschung und Entwicklung“ (FuE-Aufgaben) klassifiziert und sieben als „außeruniversitäre FuE-Einrichtungen in kontinuierlicher Zusammenarbeit“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2024)1. Die Ressortforschungseinrichtungen haben unterschiedliche Rechtsformen (häufig als nicht rechtsfähige Anstalten öffentlichen Rechts, teils aber auch als Bundesoberbehörden, gemeinnützige GmbH, Stiftung oder Verein), sie verbindet der Fokus auf FuE-Aufgaben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Einrichtungen ausschließlich selbst Forschung betreiben. Sie treten darüber hinaus als Auftraggeber für Forschungen Dritter auf und übernehmen zum Teil auch zahlreiche andere Aufgaben (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2024, S. 58). Dazu gehören unter anderem Beratungsleistungen für politische Entscheidungsträger:innen, Regulierungs-, Prüf- und Vollzugsaufgaben, Dienstleistungen für Dritte, Koordinationsaufgaben im europäischen Mehrebenensystem und unterstützende Aufgaben im Rechtsetzungsprozess (Hohn und Schimank, 1990; Wissenschaftsrat, 2010; Barlösius, 2016). Der tatsächliche Umfang und die Gewichtung dieser Aufgaben variiert zwischen den Ressortforschungseinrichtungen erheblich, Barlösius beziffert den Forschungsanteil auf zwischen fünf und 90 Prozent (Barlösius, 2016). Auch variiert, in welchem Umfang die Ressortforschungseinrichtungen Grundlagenforschung oder Auftragsforschung betreiben.
Bei der Erfüllung ihrer zahlreichen Aufgaben sind die Ressortforschungseinrichtungen unterschiedlichen (und teils auch widersprüchlichen) externen Erwartungen ausgesetzt, die ihre Legitimität in Frage stellen können (Barlösius, 2009, S. 348). Einerseits haben sie den expliziten Auftrag, politische Entscheidungen vorzubereiten, zu unterstützen und umzusetzen (BMBF, 2007, S. 3). Sie können beispielsweise angehalten sein, Zuarbeiten für die Ausarbeitung neuer Gesetze zu liefern oder regelmäßig Monitoringdaten zu erheben und aufzuarbeiten. In dieser Funktion unterstehen die Ressortforschungseinrichtungen der ministeriellen Rechts-, Dienst- und Fachaufsicht. Hierarchische – also ministerielle – Eingriffe in die Arbeit der Ressortforschungseinrichtungen mit Auswirkungen auf den operativen Entscheidungsprozess sind in diesem Kontext möglich (Bach&Döhler, 2012, S. 2), schließlich gehören die Ressortforschungseinrichtungen als Teil der Bundesverwaltung zum Geschäftsbereich eines Ressorts.2 Andererseits sind die Ressortforschungseinrichtungen Teil des wissenschaftlichen Feldes und den dortigen Gütekriterien verpflichtet (Barlösius, 2009). Eine Voreingenommenheit oder selektive Betrachtung in eine bestimmte Richtung sollte hier indiskutabel sein.
Diese Konfrontation mit (potenziell) widersprüchlichen Paradigmen kann zu Konflikten und Kritik führen. So kann beispielsweise die Frage gestellt werden, ob die Zugehörigkeit der Ressortforschungseinrichtungen zur Exekutive und deren hierarchische Unterordnung zu einem Bundesministerium zu Defiziten in der wissenschaftlichen Qualität oder zur Einschränkung der wissenschaftlichen Freiheit, etwa bezüglich der Publikation von Forschungsergebnissen, führt. Dieses Spannungsfeld und die damit verbundenen Fragen waren Ausgangspunkt für die Evaluation der Ressortforschungseinrichtungen des Bundes durch den Wissenschaftsrat, die 2004 von der damaligen Bundesregierung initiiert und 2010 mit der Verabschiedung von Empfehlungen durch den Wissenschaftsrat abgeschlossen wurde (Wissenschaftsrat, 2010).
1 Letztere sind die Stiftung Wissenschaft und Politik, das Deutsche Zentrum für Altersfragen, das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, das Deutsche Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit, das German Institute of Development and Sustainability, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit sowie das Deutsche Jugendinstitut.
2 Die meisten, jedoch nicht alle Ressortforschungseinrichtungen unterliegen der Fachaufsicht eines Ministeriums, Ausnahmen bilden die als Privatrechtssubjekte geführten Einrichtungen.
* * *
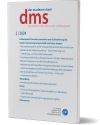 Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist im Open Access in Heft 2-2024 unserer Zeitschrift dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management erschienen.
Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist im Open Access in Heft 2-2024 unserer Zeitschrift dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management erschienen.
Mehr Leseproben …
… finden Sie auf unserem Blog.
© Unsplash 2025, Foto: Pawel Chu


