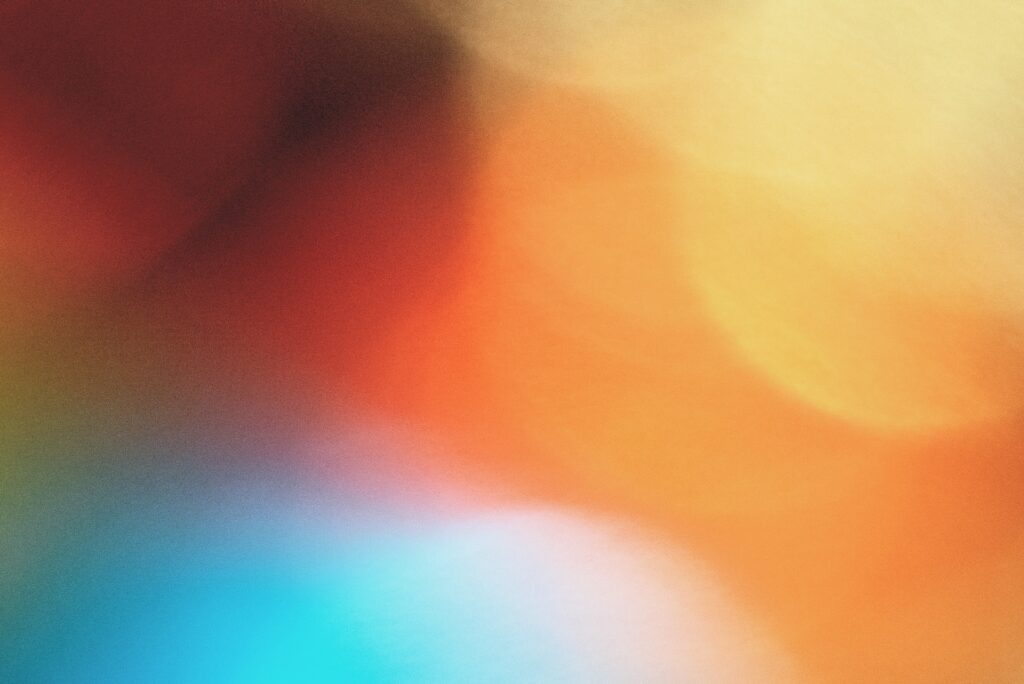Verhaltenslehren der Wärme. Polarisierung durch Identitätspolitiken?
Hannah Lindner
Soziologiemagazin, Heft 2-2022, S. 7-24.
Zusammenfassung
Unter dem Schlagwort Identitätspolitiken finden gegenwärtig Auseinandersetzungen über aufgeheizte politische Diskussionskultur statt. Eine gängige Kritik an Identitätspolitiken bezieht sich dabei auf deren angeblich vergemeinschaftende und polarisierende Tendenzen. Der vorliegende Text untersucht, inwiefern diese Kritik tatsächlich zutrifft und zieht dafür die Argumentationslinie zur Gegenüberstellung von warmer Gemeinschaft und kalter Gesellschaft heran, die von Helmuth Plessner formuliert wurde. Es wird die These aufgestellt, dass mit Polarisierung argumentierende Kritik an Identitätspolitiken sowohl bei deren Bewertung als vergemeinschaftend als auch in der Entwicklung eines scheinbar „gesellschaftlichen“ politischen Gegenmodells ihr Ziel verfehlt: Während einerseits verkannt wird, dass Identitätspolitiken zwar polarisierende Hitze entwickeln können, diese in ihrem Kernanliegen aber gerade nicht beinhalten, wird andererseits die Polarisierungsgefahr des eigenen Demokratieverständnisses übersehen. Zwischen kalter Gesellschaft und warmer Gemeinschaft plädiert der Text schließlich für eine politische Gemeinschaft der gemäßigten Temperatur.
Schlagwörter
Identitätspolitiken; Polarisierung; warme Gemeinschaft; kalte Gesellschaft
Kalte Nation, warme Identität? Zur Temperatur politischer Philosophien
Dem Kulturwissenschaftler Helmuth Lethen, Autor der „Verhaltenslehren der Kälte“ (1994) und Spezialist für die „Entfremdungs-Kälte der Gesellschaft“ (Lethen, 1994, S. 9), ist es zu warm: „Abkühlung täte not“ (Lethen, 2021), diagnostiziert er bei den allgegenwärtigen Debatten um Identitätspolitiken. Dort, wo eigentlich „maßvolle Distanz“ angemessen sei, würden „heiße Zonen der Nähe“ konstruiert (Lethen, 2010). Erhitzung aber mache Differenzierung und Austausch unmöglich (Lethen, 2021). Damit stellt Lethen sich auf die Seite einer Kritik an Identitätspolitiken, die diesen eine gefährliche Tendenz zu Vergemeinschaftung und Polarisierung unterstellt und stattdessen für eine gesellschaftliche Abkühlung plädiert. Diese Argumentationslinie ist es, die ich in diesem Text genauer untersuchen werde.
Dafür werde ich zunächst die theoretische Grundlage dieser Kritik auf die Gegenüberstellung einer warmen Gemeinschaft, die als politisches Ideal abgelehnt wird, und einer kalten Gesellschaft, die als politisches Ideal affirmiert wird, zurückführen. Daraufhin werde ich argumentieren, dass diese Gegenüberstellung die Gemeinschaftskritik reformuliert, die Helmuth Plessner 1924 in „Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalismus“ als Anthropologie und Sozialethik entwickelt und Christian Graf von Krockow dann 1983 in „Gewalt für den Frieden? Die politische Kultur des Konflikts“ auf Demokratietheorie übertragen hat. Anschließend werde ich zeigen, dass die Anwendung des Plessner’schen Gegensatz auf Identitätspolitiken an deren Kern vorbeigeht und die daran anschließenden politischen Gegenkonzeptionen ebenfalls falsch eingeordnet werden.
Der Begriff der Identitätspolitiken ist, wie Silke van Dyk richtig bemerkt, ebenso „schillernd wie schwammig“ (van Dyk, 2019, S. 27). Ursprünglich in den 70er Jahren im Zuge des Emanzipationskampfes schwarzer, lesbischer Frauen geprägt (Combahee River Collective, 1979), wird er seit den 90er Jahren zunehmend auch in
Debatten um Queerfeminismus und Critical Whiteness verwendet. Während unter ersterem ein vor allem auf die Dekonstruktion von Genderkategorien ausgerichteter Feminismus verstanden wird, der die diskriminierenden Aspekte von Sprache betont (Kastner & Susemichel, 2019), richtet sich letzterer gegen rassistische Praktiken und stellt dabei statt den diskriminierten Gruppen die Position der Privilegierten in den Fokus der Analyse (Karakayali et al., 2013). Das zentrale Anliegen der Identitätspolitiken, Diskriminierung von Angehörigen bestimmter sozialer Gruppen zu bekämpfen, kam jedoch nicht erst mit dem konkreten Begriff auf. Bereits im Rahmen der Neuen Sozialen Bewegungen der 60er-Jahre wurde Antidiskriminierung zu einem Schwerpunkt der politischen Linken, die sich bis dahin vor allem auf die Überwindung der Klassenverhältnisse fokussiert hatte (Kastner & Susemichel, 2020). Was genau jedoch im aktuellen Diskurs mit dem Begriff der Identitätspolitiken gemeint oder nicht gemeint wird, gilt es später noch zu untersuchen.
Auch die Einwände gegen Identitätspolitiken lassen sich nur schwer auf einen gemeinsamen Nenner bringen: Gegner*innen bedienen sich nicht nur unterschiedlicher Argumentationslinien, sondern lassen sich auch in nahezu allen politischen Lagern finden. ,Die‘ Kritik an Identitätspolitiken gibt es somit nicht. Während manche eine angeblich neoliberale Ausrichtung, die materielle soziale Ungleichheit vernachlässigt, beanstanden, lässt sich gleichzeitig eine Argumentation aus liberaler Richtung beobachten, die den Fokus der Identitätspolitiken auf Kollektive statt Individuen ablehnt. Unter Linken, Liberalen, Konservativen, Republikaner*innen und anderen politischen Lagern lassen sich überall Fraktionen finden, die ihr Unbehagen mit Identitätspolitiken ausdrücken und sich dabei teilweise auch unerwartet einig sind.1 Die Kritik an Identitätspolitiken, die hier betrachtet wird, zeichnet sich dadurch aus, dass sie vor allem den Vorwurf der Polarisierung erhebt und dagegen eine starke Konzeption staatsbürgerlicher Beteiligung stellt. Die Autoren, auf die ich meine Analyse gemeinschaftsskeptischer Kritik an Identitätspolitiken stütze, sind die beiden US-amerikanischen Politikwissenschaftler Mark Lilla und Francis Fukuyama sowie, für den deutschen Sprachraum, der Historiker und FAZ-Feuilletonist Simon Strauß, der sich auf die beiden beruft. Während Fukuyama aus neokonservativen Kreisen stammt und Strauß‘ erstes Buch sogar dem Rechtskonservatismus verdächtigt wurde (Pofalla, 2019), ließe sich Lilla wohl eher im liberalen Spektrum verorten. Die Auswahl der genannten Autoren erhebt nicht den Anspruch, die mit dem Gegensatz Gemeinschaft – Gesellschaft argumentierende Kritik an Identitätspolitiken vollständig abzudecken, versucht aber, Debattenbeiträge aufzugreifen, die – teilweise auch mit Verweis auf die jeweils anderen – breit rezipiert werden.2 Dass diese aus unterschiedlichen politischen Richtungen stammen, zeigt, dass Polarisierungsvorwürfe an Identitätspolitiken kein Nischenphänomen sind, sondern lagerübergreifend mit gesellschaftlicher Anschlussfähigkeit rechnen können.
Authentizität als Zumutung. Gemeinschaftsskeptische Kritik an Identitätspolitiken und ihre Grundlagen bei Helmuth Plessner
Die Gegenüberstellung von Gemeinschaft und Gesellschaft geht auf das 1887 erschienene Hauptwerk von Ferdinand Tönnies zurück, in dem er die beiden Begriffe als sich gegenüberstehende Formen menschlichen Zusammenlebens beschreibt. Die Natürlichkeit gemeinschaftlicher Verbundenheit, die sich exemplarisch in der Familie zeigt, wird mit der Künstlichkeit gesellschaftlicher Ordnungen kontrastiert, die typisch für kapitalistische Tauschbeziehungen ist (Tönnies, 2012). Obwohl Tönnies seine Abhandlung als ‚reine‘ Soziologie verstanden hat, lässt sie sich jedoch auch als Plädoyer für eine an Gemeinschaftlichkeit orientierte soziale Ordnung (miss)verstehen, was sich an der fatalen und von Tönnies mehr als ungewollten Rezeption des Textes im Nationalsozialismus zeigt. Gleichzeitig wird Tönnies‘ Gemeinschafts- und Gesellschaftskonzeption auch von marxistischer Seite affirmativ aufgegriffen, so zum Beispiel in Georg Lukács (1923) gemeinschaftsbejahender Schrift „Geschichte und Klassenbewusstsein“. Ein Jahr später erscheint schließlich in einem „challenge-response-Verhältnis“ (Fischer, 2014, S. 410, Herv. im Orig.) zu Lukács Helmuth Plessners Buch „Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalismus“, das in scharfer Opposition zu Lukács und Tönnies steht.
Plessner, der als Hauptvertreter der philosophischen Anthropologie den Menschen gerade durch seine „natürliche Künstlichkeit“ charakterisiert, entwirft hier eine „Verhaltenslehre für die Kühle der Gesellschaft‘“ (Lethen, 1994, S. 76), in der er den Begriff der Gemeinschaft dem Wärmepol, den der Gesellschaft dem Kältepol zuordnet. Ausgehend von einer „Kritik des sozialen Radikalismus“ argumentiert Plessner, dass jede Gemeinschaft auf Gesellschaft als übergeordnetes Prinzip angewiesen sei, da diese im Gegensatz zu Gemeinschaften keinen totalitären Anspruch auf das Individuum ausübe (Plessner, 2002). Gesellschaft zeichnet sich nicht durch emotionale oder wertebezogene Nähe aus, sondern ist eine „Sphäre der permanenten Trennungen“ (Lethen, 1994, S. 77), ein „offenes System des Verkehrs zwischen den Menschen“ (Plessner, 2002, S. 80). Plessner behauptet dabei nicht, dass die Nähe der Gemeinschaft an sich abzulehnen ist, sondern dass zwischen ihr und der Distanz der Gesellschaft – beide zwei gleich ursprüngliche menschliche Bedürfnisse – ein Ausgleich hergestellt werden muss (Plessner, 2002). Gesellschaft verlangt „Höflichkeit“, „Reserviertheit“ (Plessner, 2002, S. 80) und eine „Gedämpftheit im Ausdruck“ (Plessner, 2002, S. 110), entscheidend sind dort „Fingerspitzen“, „Biegsamkeit“ und „Mäßigung“ (Plessner, 2002, S. 15).
Nur die Kälte der Gesellschaft ist es, die nach Plessner persönliche Freiheit garantieren kann, da die Enge der Gemeinschaft den Menschen immer auch festlege. Das Charakteristische der menschlichen Seele aber liege im „Werden“ (Plessner, 2002, S. 62-63). Neben der Möglichkeit persönlicher Entfaltung bietet die Kälte der Gesellschaft aber auch Schutz vor Verletzungen, die in der Enge der Gemeinschaft zwangsläufig auftreten. Das Tragen einer „Maske“ gewährleistet „bei einem Maximum an seelischem Beziehungsreichtum zwischen den Menschen ein Maximum an gegenseitigem Schutz voreinander“ (Plessner, 2002, S. 79). Mit der Maske, die gleichzeitig offenbart und verbirgt, begibt sich der Mensch nun frei und geschützt in die Öffentlichkeit, die gleichzeitig Spiel- und Kampffeld ist (Plessner, 2002). Es beginnt ein Duell, das sich durch „tänzerischen Geist, das Ethos der Grazie“ (Plessner, 2002, S. 80) auszeichnet und Authentizität als „Spielverderberei“ verurteilt (Plessner, 2002, S. 83).
Während Plessner die unterschiedlichen Pole vor allem auf der anthropologischen bzw. individualethischen Ebene ausführt, überträgt sein in derselben Tradition argumentierender Schüler Christian Graf von Krockow die Gemeinschaftskritik auf eine politiktheoretische Ebene: Die Vorteile einer kalten Gesellschaft gegenüber einer warmen Gemeinschaft werden hier mit den Voraussetzungen einer stabilen Demokratie begründet. Die „Sehnsucht und Suche nach der verlorenen Geborgenheit“ (von Krockow, 1983, S. 37), die das Gemeinschaftsstreben ausdrücke, führe zur Vermeidung von Konflikten, die aber unabdingbar seien und gewaltsam enden würden, wenn sie zu lange unterdrückt werden (von Krockow, 1983). Da Gemeinschaften „Kompromißfähigkeit [sic]“ verhindern und „mit der Absolutsetzung des eigenen Standpunktes dem Andersdenkenden die Legitimität zu abweichenden Meinungen abgesprochen wird“ (von Krockow, 1983, S. 22-23), enden sie in Freund-Feind-Polarisierung und schließlich im „Bürgerkrieg“ (von Krockow, 1983, S. 19). Nach von Krockow ist es damit die „absolute Ethik des Rechthabens“ (von Krockow, 1983, S. 51), in der die Problematik der Gemeinschaft begründet liegt: „Wo immer die Identitätsbildung […] moralisch ins ,Letzte‘ […] gerückt wird, da lauert schon die Katastrophe“ (von Krockow, 1983, S. 25), denn „einzig im Absoluten“ werde „das Komplexe simpel“ (von Krockow, 1983, S. 51).
Demokratien sind für von Krockow nicht auf Authentizität, sondern auf Formalität angewiesen, denn auf „Formalisierung jedes einzelnen zum Menschen und zum Bürger“ beruhe „das Gleichheits- und Toleranzprinzip unserer Freiheit“ (von Krockow, 1983, S. 67). Formen fungieren als „Schranke“, die verlangsamend wirken und damit „Zeit zur Besinnung“ geben (von Krockow, 1983, S. 51-52). Außerdem ermöglichen sie Freiheit, indem sie eine Vielzahl gesellschaftlicher Rollen produzieren, die einander relativieren (von Krockow, 1983). Die Festlegung einer Person auf eine bestimmte Rolle sei dagegen „ein Signal der Intoleranz, der verweigerten Freiheit“ (von Krockow, 1983, S. 67). Gemeinschaften mangele es an dieser Relativierung durch Pluralität, die für eine Demokratie aber eine Grundvoraussetzung darstellt (von Krockow, 1983). Fehlt die Distanz, „wird unvermeidbar jede Sachdifferenz zur Kränkung, zum Widerhaken, der Wunden reißt“ (von Krockow, 1983, S. 82). Der Illusion gesamtgesellschaftlicher „Gemeinschaft und Geborgenheit“ (von Krockow, 1983, S. 23) nicht zu erliegen, bedeute, zu erkennen, dass jeder Verweis auf das Allgemeinwohl eigentlich selbst Interessenspolitik sei. Möglich und wünschenswert sei alleine eine „nüchterne und offene Interessenvertretung“ (von Krockow, 1983, S. 91).
Obwohl Plessner und von Krockow also unterschiedlich stark Individual- und Kollektivebene betonen, übernimmt von Krockow Plessners Kritik an den Polarisierungstendenzen der ,radikalen‘ Gemeinschaft, der die liberale, auf Selbstdistanzierung beruhende Gesellschaft gegenübergestellt wird. Die „Entfremdungs-Kälte der Gesellschaft“ wird zum „Lebenselixier“ (Lethen, 1994, S. 9), die „Affektwerte höchsten Grades“ der Gemeinschaft zur Gefahr (Plessner, 2002, S. 45).
1 Siehe beispielsweise die Kritik am Essentialismus von linker und konservativer Seite (u.a. Kastner & Susemichel, 2020; Strauß, 2019).
2 Z. B. Hammelehle, 2019; Orzessek, 2019; Simon, 2019.
* * *

© Unsplash 2022, Foto: Craig Melville