von Ute Schaich
Über das Buch
Wie gestalten sich Genderprozesse in Kinderkrippen, also in der Arbeit mit Kindern in den ersten drei Jahren? Während zu geschlechtsbezogenen Themen in frühpädagogischen Kontexten mit über dreijährigen Kindern etliche Untersuchungen vorliegen, ist Gender in Krippen ein Forschungsfeld, das bisher wenig bearbeitet wurde. Das Buch bietet einen Einblick, wie unterschiedlich Geschlecht in den alltäglichen Interaktionen zwischen Kindern, Eltern und Fachkräften relevant gemacht wird, wie sich Verknüpfungen zu weiteren Differenzlinien darstellen und welche Bedeutung die Materialausstattung hat. Es werden Perspektiven für eine genderreflektierte Pädagogik und Forschung diskutiert.
Leseprobe aus den Seiten 113 bis 116
***
5) Interviews mit den Fachkräften
Ergänzend zu den teilnehmenden Beobachtungen wurden mit neun beteiligten Fachkräften (sieben Frauen, zwei Männer) und ebenso mit den Eltern ethnographische Einzelinterviews durchgeführt und orientiert am „themenzentriert-komparativen Verfahren“ von Karl Lenz (2001: 62ff.) ausgewertet (siehe Kapitel 2.4). Die Auswertung berücksichtigt manifeste und latente Sinngehalte. Ziel der Interviews mit den Fachkräften war es herauszufinden, wie sie ihr Handeln in Bezug auf Gender reflektieren. Im Folgenden werden die grundlegenden Aussagen und Muster vorgestellt und durch Zitate beispielhaft veranschaulicht.
5.1 Konstruktion moderner Mutter- und Vaterbilder durch die Fachkräfte
Die zitierten Ausschnitte entstammen der Impulsfrage, was den Fachkräften einfalle, wenn sie an die Mütter oder Väter der Kinder in ihrer Einrichtung denken.
Charlotte: Also, als allererstes in den Sinn kommt mir Druck und Stress. Also ich/ Also im Großen und Ganzen, finde ich, haben wir, klingt zwar doof, aber wir haben super Familien. Also, wir haben wirklich, habe ich den Eindruck, ein total gutes Verhältnis zu den Familien, zu den Eltern, zu den Müttern. Und ich habe aber oft den Eindruck, dass die ganz schön unter Druck stehen. Also, dass sie VIEL19 zu bewältigen haben, dass sie Vieles GUT machen wollen, bisweilen perfekt machen wollen. Manchmal der eigene Anspruch so HOCH ist, dass er nicht zu erreichen ist eigentlich. Und diese Mutter-Rolle/Also ich glaube, im Moment ist es auch schwierig, Mutter zu sein mit diesen verschiedenen Strömungen: attachment parenting, also so dieses absolute/ Also wir arbeiten ja auch bedürfnisorientiert und schreiben uns das immer ganz groß auf. Und ich glaube, für viele ist bedürfnisorientiert aber, die eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht mehr wahrzunehmen, sondern die Bedürfnisse des Kindes sind das einzige Zentrale, worum sich alles drehen muss. Und das führt zu einer Überforderung, die wir spüren manchmal. So. Dieses, dass es vielleicht so eine Interpretation von Bindung ist oder so, die für viele Mütter bedeutet, dass sie sich selber völlig zurückstellen oder ihre eigenen Bedürfnisse und quasi die des eben Arbeitgebers natürlich erfüllen oder des Studiums erfüllen. Je nachdem eben, in welcher Phase sie gerade sind. Und dann eben die Bedürfnisse des Kindes erfüllen. Und ich manchmal denke: „Wo, wann macht ihr eigentlich was für euch selber?“ (lacht) So. Also, ich habe das Gefühl, es ist schon viel, ein hoher Druck da, ja.
Charlotte bringt ihre Wahrnehmung zum Ausdruck, dass insbesondere Mütter unter Druck stünden, weil sie sich hohen Anforderungen gegenübersähen und sich einen Perfektionsanspruch auferlegten. Sie stellten eigene Bedürfnisse zurück, in dem Bestreben, den Idealen eines im pädagogischen Mainstream verhandelten bindungsfördernden Elternverhaltens zu genügen und zugleich den Ansprüchen des Arbeitgebers oder des Studiums gerecht zu werden. Im Gegensatz dazu nimmt sie Väter als entspannter wahr.
Charlotte: Entspannter. (lacht) Ich, ja, also wir haben viele Kinder, die von den Vätern gebracht und geholt werden. Also, es ist nicht so, dass die nicht präsent wären. Wir haben sehr präsente Väter in der Einrichtung, die sich, die auch sich um ihre Kinder kümmern und an der Erziehung beteiligt sind und jetzt nicht so Feierabend- und Wochenende-Bespaßungspapa oder so. Und trotzdem scheint es mir, dass Väter anders in der Lage sind, sich selber noch wichtig zu nehmen oder so. Oder vielleicht äußere Ansprüche nicht so erfüllen zu müssen. Oder irgendwie so was vielleicht. Also, die kommen dann auch eher mal in Jogginghose und Kapuzenpulli zum Beispiel. Jetzt als so ganz blödes Beispiel, aber halt so: „Ja, die Nacht war irgendwie schwierig und es war anstrengend. Und jetzt sehe ich halt aus, wie ich aussehe.“ Und ich glaube, ich kenne keine Mutter, die so irgendwie ihr Kind wegbringen würde. (lacht)
Väter werden von ihr so erlebt, dass sie im Erziehungsalltag zwar anwesend sind, aber auch auf sich und ihre Bedürfnisse achten und sich nicht so sehr äußeren Anforderungen unterwerfen, sich also mehr abgrenzen als Mütter. Ihre Kollegin Kathrin benutzt für Mütter den Ausdruck „Workaholics“ und beschreibt sie als „Arbeitsmamis“, die „adrett“ und „gestylt“ aussähen.
Kathrin: Irgendwie alle Workaholics. (lacht)
Interviewerin: Okay.
Kathrin: Oder was heißt alle? Aber wirklich viele. Gestylt, schöne Klamotten, also legen auch häufig Wert auf das äußerliche Erscheinungsbild. Nicht hundert Prozent alle, also da sind zwei/ Wobei eine, die fällt da so ein bisschen aus dem Raster, die ist eher so ein bisschen alternativer unterwegs. Aber sonst sind es schon so Arbeitsmamis, die immer adrett aussehen und die auch, glaube ich, Wert darauf legen, dass ihre Kinder da auch reinpassen.
Die Bezeichnung „Workaholics“ hat einen pathologisierenden Charakter. Die Wortwahl legt nahe, dass Kathrin Mütter als Burnout-gefährdet erlebt. Der Ausdruck „Arbeitsmamis“ beschreibt die Wahrnehmung, dass die Mütter stark auf die berufliche Karriere ausgerichtet sind und die Erwartung haben, die Kinder hätten entsprechende Anpassungsleistungen zu erbringen. Die Vätererscheinen dagegen „sanft“, „zart“ und „kuschelig“, und sie überließen den Frauen die Führungsrolle:
Kathrin: Ja. Also, wir haben schon wirklich sanftmütige Väter. Ja. Ist jetzt keiner, der so diesen typischen, weiß ich nicht, Magazin-Mann entsprechen würde. Weiß ich nicht. Es gibt ja immer so dieses typische Mann-Bild und ich würde sagen: Keiner der Männer passt dort rein. Also, sie sind alle sanft und, ja, so Kuschel-Papas haben wir. Zarte Kuschel-Papas. (lacht) Ich glaube, bei uns sind die Frauen eher die, die die dominantere Rolle in den Beziehungen auch übernehmen.
Ähnliche Aussagen finden sich in anderen Interviews:
Aaron: Ja, es ist (lachend) bei manchen Vätern. Also, man vergisst mal, eine Mütze mitzunehmen, und die sind auch total ehrlich, die sagen: Ja, meine Frau kriegt das besserhin und morgens auch, das ist ja mit dem Aufstehen, Anziehen, Zähneputzen, da sind die ja fix und fertig. Und (lachend) ich hatte auch in der alten Einrichtung einen Vater, der hat/ was für mich ihn total sympathisch gemacht hat, er kam einmal, so zwei-, dreimal, kam er, hat sie abgegeben und dann wollten wir in den Garten und hat er die Schuhe vergessen. Sie kam ohne Schuhe. Und er meinte so auch so: Aaron, ich kann das nicht. Meine Frau macht das besser, die ist viel organisierter. Aber nachmittags holt er sie gerne ab, weil da hat er auch die Zeit, da muss er nicht mehr ins Büro gehen oder generell auch, dann ist das Kind auch viel entspannter, er muss nicht durch die ganze Wohnung rumrennen, um nur Zähne zu putzen, hat er mir auch ganz ehrlich und offen erzählt. Ja, aber der gibt sich Mühe und das macht auch den Menschen so sympathisch.
Interviewerin: Ja, aber das erlebst du bei Müttern jetzt nicht? Oder erlebst du die Mütter auch so überfordert morgens?
Aaron: Nein, die Mütter nicht. Die sind da (lachend) total entspannt. Klar gibt es mal Situationen, wo es morgens nicht klappt oder so, aber nein. Die sind total entspannt.
In Aarons Aussagen kommt zum Ausdruck, dass er Mütter als gut organisiert und souverän erlebt, einige Väter hingegen als unstrukturiert und überfordert, wenn sie die Kinder morgens bringen, aber auch sympathisch. Die angeführte Bemerkung eines Vaters, dass seine Frau organisierter sei als er, impliziert, dass er sich aus der Verantwortung dafür nimmt, dass er seine Tochter mehrmals nicht vollständig ausgestattet (ohne Schuhe) übergab.
Auch Daniel erlebt Väter als wenig planvoll handelnd:
Daniel: Ja. Also, dieses verpeilte Lockere halt, ne, so. Dieses: Ah! Ja. Okay. Generell so dieses etwas Lockere, was Männer manchmal so an sich haben so. Das/ dieses Verpeilte halt so.
Dagegen erschienen insbesondere Mütter leistungsorientiert in Bezug auf die Entwicklung des Kindes (trocken werden, Sprache), und die Väter passten sich ihnen an:
Daniel: […] Dieses: Mein Kind muss funktionieren. Mein Kind muss mit drei trocken sein und muss mit zweieinhalb anfangen zu sprechen oder spätestens angefangen haben zu sprechen und so. Das ist halt das. Und dass halt jeder seine Meinung irgendwo schreiben kann oder reinwerfen kann. Da durch diese ganzen Gruppen da, die es im Netz gibt, wo halt auch jeder jeden Mist reinschreiben kann und so. Daran liegt das, glaube ich. Ja.
Interviewerin: Und das bezieht sich aber tatsächlich auf die/ also eher auf die Elternschaft an sich, jetzt nicht mehr auf Mütter oder Väter, die da Druck ausüben?
Daniel: Nein. Das/ nein. Nein, nein. Ich glaube, dass da manche Mütter vielleicht ein bisschen mehr informiert sind, dass sie sich einfach generell mehr mit so Themen beschäftigen, ne, sodass die Männer halt dann eher so: Na ja. Lasse mal/ gucke mal! Lasse mal die Mutti das machen so. Und dass die Mutter halt dann mit neuen Ideen aus dem Internet kommt und der Mann halt dann quasi dazu ein bisschen angetrieben wird da halt da mitzufahren. Ob die ganzen Väter das so toll finden, da weiß ich nicht, aber/ ja. Genau.
Die Aussagen stammen von den Fachkräften der beiden Einrichtungen, die einen hohen Anteil an akademisch ausgebildeten Eltern haben. Die Mütter werden als gut organisiert und strukturiert, souverän, leistungsfähig und -orientiert, ehrgeizig, aber auch gestresst wahrgenommen. Die Schilderungen erwecken den Eindruck, dass sie in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf bzw. Studium und Familie ebenso wie in Bezug auf Elternschaft eine große Optimierung betreiben.
___
19 Die Großbuchstaben bedeuten, dass die*der Sprecher*in das Wort besonders betont hat.
***
Sie möchten gern weiterlesen?
Jetzt versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
© Titelbild: gestaltet mit canva.com

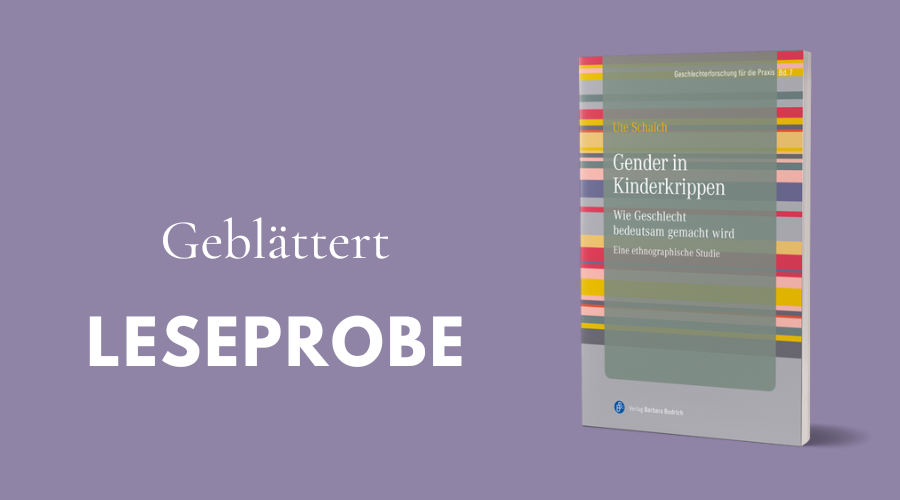
 Ute Schaich:
Ute Schaich: