Aufarbeitung der Kinderverschickungskuren in Deutschland – Gewalt und Zeugenschaft in generationalen Ordnungen
Johanna Christ
Diskurs Kindheits- und Jugendforschung / Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research, Heft 2-2024, S. 189-204.
Zusammenfassung
Der Artikel präsentiert die Ergebnisse einer Analyse, die einen Beitrag zur Aufarbeitung der Kinderverschickungskuren in Deutschland (~1945 – frühe 1990er) leistet. Er skizziert den Aufarbeitungsprozess, der wesentlich durch die Betroffenen selbst angestoßen wurde und betrieben wird. Gewaltvolle Verhältnisse in den Heimen wurden dadurch offenbar. Die Analyse nimmt eine kindheitstheoretische Perspektive auf Gewalt und Zeugenschaft in generationalen Ordnungen ein und fragt, wie die Verschickung für das Kind gewesen sein muss und wodurch sich die Kinderverschickung auszeichnet. Dafür wurden im Rahmen einer Masterarbeit 2186 online öffentlich zur Verfügung gestellte Zeugnisse ehemals als Kind Verschickter analysiert und mit einer rekontextualisierten Worthäufigkeitsanalyse mit Hilfe der Software MAXQDA untersucht. Die Ergebnisse können bisherige Forschung bestätigen und beleuchten materielle, relationale und emotionale Aspekte der Gewaltdynamiken.
Schlagwörter: Verschickungskinder, Gewalt in generationalen Ordnungen, Kindheitsforschung, Aufarbeitung, Zeugenschaft
Reappraisal of the so-called children’s health displacement (Kinderverschickungskuren) in Germany – Violence and Witnessing in Generational Orders
Abstract
The article presents the results of an analysis that contributes to the process of working through the past of the so-called children’s health displacement (Kinderverschickungskur) or shipment of children in Germany (~1945 – early 1990s). It outlines the process of coming to terms, which was essentially initiated by those affected themselves and made violent circumstances in the institutions visible. The analysis itself takes a childhood theory perspective on violence and testimony in generational orders and asks what the displacement must have been like for the child and what distinguishes the phenomenon from this perspective. For this purpose, 2186 publicly posted online testimonies of people who were once displaced as children were analysed in a master’s thesis and examined with a recontextualised word frequency analysis using MAXQDA software. The results confirm previous research and shed light on material, relational and emotional aspects of the dynamics of violence.
Keywords: shipped away children (Verschickungskinder); violence in generational orders; childhood studys; working through the past, testemony
Einleitung
„Es war im Juni 1962, da hieß es, ich solle verschickt werden. ‚verschickt‘ … ich wusste gar nicht, was das bedeutete.“ (Kati in Röhl, 2021, S.59)
Unter dem Begriff der Kinderkurverschickung1 wurden im Nachkriegsdeutschland bis in die frühen 90er-Jahre schätzungsweise acht bis zwölf Millionen Mal Kinder auf Kur geschickt (Röhl, 2022b, S. 41). Mit dem Ziel der „Verbesserung des Gesundheitszustandes“ (Röhl, 2022a, S. 31) wurden Kinder zwischen fünf und zehn Jahren für einen Zeitraum von in der Regel sechs Wochen ohne ihre Eltern in Heime an der Ost- und Nordsee, in die Alpen, an den Bodensee oder auch in den Schwarzwald gebracht. Bei guter Luft und Kurkost sollte Gewicht zu- oder abgenommen, ein Husten kuriert oder anderweitig Kraft getankt werden. Das Ausmaß wird deutlich, wenn etwa Dokumente der Bundesregierung aus 1963 herangezogen werden, wonach die Deutsche Bundesbahn für 200.000 kurbedürftige Kinder allein aus Nordrhein-Westfalen 117 Kurkindersonderzüge einsetzte (Report Mainz, 2019). Besonders in den 1950ern/60ern erlebte diese sozialmedizinische Praxis einen quantitativen Höhepunkt (Röhl, 2022a). Die bisherige Datenlage lässt zu, von einem Massenphänomen zu sprechen (Kappeler, 2022; Lorenz, 2021; Röhl, 2022a; Schmuhl, 2023). Umso mehr überrascht es, dass bis vor wenigen Jahren kaum Forschung dazu existierte.
Viele der als Kind Verschickten problematisieren heute diese Aufenthalte. Ganz konträr zu den eigentlichen Zielen Gesundheit und Erholung berichten sie von körperlichem Abbau und Krankheit, schweren emotionalen und psychischen Belastungen durch Strafen und Demütigung sowie von physischer Gewalt, Zwang, sexualisierter (Röhl, 2022a; Neumann & Reichert, 2019) ebenso wie medizinischer Gewalt (Wagner & Wiebel, 2020, S. 30). Laut einer Untersuchung zum Kurort Bad Salzdetfurth im Jahr 1969 wurde auch der Tod von drei Kindern durch Peergewalt und vermutlicher Erstickung an Erbrochenem berichtet (Neumann & Reichert, 2019). Wissen, was zuvor im Gedächtnis „einer ganzen Generation“ (Kappeler, 2022, S. 55) verankert, nicht aber in Forschungsliteratur zu finden war, drängt in den letzten Jahren an die Öffentlichkeit. In einem fortlaufenden Prozess kollektiver Wissensproduktion sind es Zeitzeug:innen, die einen weiteren dunklen Teil deutscher Geschichte aufarbeiten. Anknüpfend an verschiedene Aufarbeitungsprozesse von Gewalt und Unrecht an Kindern (Andresen, 2019)2 wird der Fall der Verschickungskinder auch zu einem Gegenstand der Erziehungswissenschaft. Er reiht sich ein in die Geschichte der Erziehung, die mit Andresen als eine „Geschichte der Gewalt in Erziehungsverhältnissen“ (2018, S. 6) erzählt werden kann. In dieser Historie untersucht der Beitrag das Spezifische der Kinderverschickung, das bereits in dem Begriff der Kinderverschickung selbst angelegt ist. Der Text geht der Frage nach, vor der auch die eingangs zitierte Kati im Jahr 1962 als Kind stand: Was bedeutet es überhaupt „verschickt“ zu werden?
Aus einer kindheitstheoretischen Perspektive mit dem Konzept der generationalen Ordnung (Alanen, 1992) argumentierend, rückt der Beitrag die soziale Position der Kinder in den Blick (Kapitel 1). Danach ist die Kinderverschickung als ein Gewaltphänomen im Generationenverhältnis zu betrachten. In der Tradition der Kindheitsforschung interessiert hier besonders die Perspektive der Kinder, um zu verstehen, was die Verschickung mit ihnen gemacht hat, wodurch eine Erholungsreise subjektiv zu einem Horrortrip wurde oder wo Kipppunkte zur Gewalt zu identifizieren sind.
Andresen et al. heben in einem Beitrag von 2016 hervor, welche Bedeutung in Aufarbeitungsgeschehen von Unrecht an Kindern den Zeugnissen der Menschen zukommt, die diese Gewalt erlebt haben. Hieran anschließend sind Zeugnisse derer, die die Kuren als Kinder erlebt haben, Ausgangspunkt der Analyse. Sie sind, abgesehen von Briefen, der heute einzige Zugang zur Perspektive der Kinder. Nach einer reflexiven Einordnung der Zeugnisse im Spannungsfeld von Anerkennung und Aufarbeitung einerseits und Forschung und Quellenkritik andererseits (Kapitel 2) bildet die Präsentation ausgewählter Ergebnisse einer rekontextualisierenden Worthäufigkeitsanalyse von über 2000 Zeugnissen den Kern des Textes. Einer Erläuterung des entwickelten methodischen Vorgehens (Kapitel 3) folgt die Ergebnispräsentation (Kapitel 4), welche in einem abschließenden Fazit zusammengefasst und diskutiert wird (Kapitel 5).
Die Studie ist im Rahmen der Masterarbeit der Autorin3 entstanden. Der Artikel präsentiert nur einen Extrakt dieser, er erhebt damit explizit nicht den Anspruch, das Phänomen der Verschickungskuren umfänglich zu beschreiben und aufzuarbeiten. Dafür sei auf größere Forschungsprojekte, welche die historische Genese, den Systemcharakter und die Dimension der Kinderverschickung ausführlich rekonstruieren, verwiesen und auf die zahlreichen Arbeiten der Betroffenen im Rahmen ihrer Bürger:innenforschung. Deren Forderung nach weiterer Forschung ist zu unterstützen.
1 Gewalt in generationalen Ordnungen, Aufarbeitung und Zeugenschaft
Gewalt an Kindern ist dadurch spezifisch, dass die Betroffenen Kinder sind. Was es bedeutet, ein Kind zu sein, und ab wann etwas als Gewalt und noch eindeutiger als Unrecht benannt wird, ist historisch nicht immer gleich gewesen und auch kulturell verschieden. Das Konzept der generationalen Ordnung (Alanen, 1992, 2003) schließt hier an und versteht Kindheit als eine soziale Kategorie. Alanen (1992) beschreibt, wie generationale Ordnungen die Gesellschaft auf ähnliche Weise strukturieren wie z. B. Geschlechterordnungen. Kinder sind demnach strukturell aufgrund ihrer Position im Generationenverhältnis gegenüber Erwachsenen benachteiligt. Alanen verlässt mit ihrer Forschung die bisher vorherrschende erwachsenenzentrierte Perspektive und macht die tatsächliche Kindheit, wie sie von Kindern ge- und erlebt wird, zum Ausgangspunkt (Alanen, 2003, S. 131).
So rückt auch Gewalt an Kindern in den Fokus der Kindheitsforschung. Bühler-Niederberger et al. (2019) identifizierten Gewalt als zentralen Faktor hinsichtlich der Einschränkung der Agency (Handlungsfähigkeit) von Kindern sowie der Behinderung in ihrem Recht, als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft anerkannt zu sein (Bühler-Niederberger et al., S. 2). Sie charakterisieren Gewalt an Kindern als generationales Herrschaftsinstrument für Erwachsene im Privaten, aber auch als gesellschaftliche Strategie zur Einordnung (oder Unterordnung) der Kinder in die bestehende gesellschaftliche Hierarchie (Bühler-Niederberger et al., S. 2). Andresen et al. (2016) fassen es aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive wie folgt:
So führt die strukturell bedingte Abhängigkeit von Heranwachsenden dazu, dass ihnen Zugänge zu Entscheidungsprozessen und Anerkennung im Rahmen einer gewaltlosen Erziehung von Erwachsenen gewährt werden müssen. Es hängt folglich vom Willen und vom Handeln der Erwachsenen in Erziehungsverhältnissen ab, was sie Kindern ermöglichen. So liegt die Umsetzung von Rechten des Kindes im Alltag maßgeblich in der Hand der älteren Generation. (Andresen et al., 2016, S. 627)
Andresen et al. stellen daran anschließend auch Aufarbeitungsgeschehen von Gewalt an Kindern in jenes Generationenverhältnis, als einen „kommunikative[n] Prozess, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ineinander verwoben sind“ (S. 627–628). Die Anhörung von Zeug:innen ist aus dieser Perspektive von zentraler Bedeutung.
Aufarbeitung hat gezeigt, dass Gewalt hätte verhindert werden können, es aber oft daran scheiterte, dass nicht richtig hingeschaut, eindeutig weggeschaut, Kindern nicht richtig zugehört und noch weniger geglaubt wurde (Andresen, 2018, S. 9). Kavemann et al. (2022) greifen auf das Konzept der epistemischen Ungerechtigkeit (epistemic injustice) nach Fricker (2007) zurück und erweitern es um die Kategorie Alter. Demnach wird Kindern vorurteilsbedingt weniger Glaubhaftigkeit (credibility) entgegengebracht als Erwachsenen, welche dagegen einen Glaubhaftigkeitsvorschuss (credibility excess) genießen (Fricker, 2007, S. 30; Kavemann et al., 2022, S. 32). Das nennt Fricker testimonial injustice (Fricker, 2007, S. 1). Hermeneutische Ungerechtigkeit (hermeneutical injustice), der zweite Grundbegriff bei Fricker beschreibt vereinfacht ausgedrückt das Fehlen von Deutungsmustern oder den eingeschränkten Zugang zu Wissen, mit welchem eine erlebte Erfahrung adäquat eingeordnet werden könnte (Fricker, 2007, S. 147–175). Epistemische Ungerechtigkeit führt auf gesellschaftlicher Ebene dazu, dass „das Wissen von diskriminierten Gruppen und die Erfahrungen dieser Menschen nicht in gesellschaftliche Diskurse einbezogen [werden]. Die Vielfalt von Betroffenen und deren heterogene Erfahrungen werden dann nicht Teil des gesellschaftlichen Wissensbestands und der kollektiven hermeneutischen Ressourcen“ (Kavemann et al., 2022, S. 35). Wenn Betroffene allerdings doch am Diskurs beteiligt werden, ändert sich der Blickwinkel und der Diskurs gewinnt an Konkretheit (Kavemann et al., 2022, S. 37).
Menschen, die als Kind Gewalt erlebt haben und heute als Erwachsene darüber sprechen, sind in den letzten Jahren in Zusammenhang mit der Aufarbeitung sexueller Gewalt und anderen (inter-)nationalen Transitional Justice-Projekten zu wichtigen Wissensträger: innen und –produzent:innen geworden (Andresen, 2021). Sie treten als Zeug:innen auf. Diese Rolle ist jedoch keine neutrale und bewegt sich insbesondere im Zusammenhang mit Forschung in einem mehrdimensionalen Spannungsfeld. Sibylle Schmidt (2011) hebt die ambivalente Position der Zeug:innen hervor: Demnach besitzen Zeug:innen immer „eine doppelte Autorität: eine epistemische und eine soziale. Zeugenschaft und Politik stehen in Zusammenhang, weil der Zeuge sich nicht nur durch ein Wissen qualifiziert, sondern ‚Zeuge-sein‘ selbst eine soziale Rolle realisiert, die von ethisch-politischen Bedingungen und Anerkennungsmechanismen geprägt ist“ (Schmidt, 2011, S. 12).
Glaubwürdigkeit als Person, als Zeug:in geht mit Anerkennung einher. „Die spezifische Ambivalenz der Figur des Zeugen ist dabei nicht aufzulösen, sondern sie ist konstitutiv. […] Das Zeugnis steht im Spannungsfeld von ‚bloßer‘ Wissensvermittlung und persönlicher Verantwortung und Machtfragen“ (Schmidt, 2011, S. 15). Schmidt versteht das Zeugnis selbst somit als das Produkt eines kommunikativen Prozesses und als eine authentische Spur des Ereignisses. Ein Streben nach Objektivität und Glaubhaftigkeit der Zeug:innen bewegt sich in den ungleichen Ordnungsgefügen der Gesellschaft und Anerkennung fehlt häufig.
In Aufarbeitung und Transitional-Justice Prozessen geht es darum, vergangenes Unrecht sichtbar zu machen, als solches anzuerkennen und Wege der Gerechtigkeit für Gegenwart und Zukunft zu finden (siehe hierzu UKASK, 2020). Die Zeugnisse der Betroffenen sind wesentlich, um das Verletzende und Gewaltvolle der Ereignisse zu erkennen. Insbesondere, wenn ihre Perspektive in den hermeneutischen Ressourcen einer Gesellschaft bisher nicht repräsentiert war.
2 Zeugenschaft im Spannungsfeld von Aufarbeitung und Forschung
Angestoßen durch einen Artikel der Autorin Anja Röhl im Jahr 2009, der ihre eigenen Verschickungen und die dort erlebten gewaltvollen Verhältnisse thematisiert (Röhl, 2009), finden sich seitdem stetig Menschen zusammen, die von ähnlichen Erlebnissen berichten. Bis heute sind sie die treibenden Akteur:innen der Aufarbeitung (Röhl, 2022b): Sie teilen Erfahrungen, tragen ihr Wissen zusammen, rekonstruieren individuelle Kuraufenthalte, recherchieren in Archiven, sammeln und sortieren Wissen über Heime, Träger und Verantwortliche, schaffen Öffentlichkeit, organisieren sich als Vereine und Initiativen, suchen den Dialog mit Politik und Trägern und veranstalten jährliche Fachkongresse oder setzen sich künstlerisch mit ihren Leiderfahrungen auseinander.4
Die Aufarbeitung der Verschickungskinder unterliegt Besonderheiten: 1. Die Verschickungen fanden über einen langen Zeitraum mit großen gesellschaftlichen Veränderungen statt. 2. Die Verantwortungslage ist unübersichtlich: Zwischen dem wohlfahrtsstaatlichen Handeln der Politik, einer Vielzahl an Heimträgern, profitierenden Kommunen und gewalttätigen Einzelpersonen. 3. Verschiedene Gewaltformen und erzieherische Praktiken werden problematisiert, die nicht so spezifisch zu adressieren sind, wie etwa in der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. 4. Die Kuren stellen eine vergleichsweise kurze Periode im Leben der Betroffenen dar und anders als bei den (meisten) Heimkindern folgte wieder eine Rückkehr nach Hause. 5. Die Betroffenen sind nicht vorher schon eine zusammengehörende Gemeinschaft gewesen, wie etwa die Glaubensgemeinschaft einer Kirche, des gleichen Vereins etc., sodass sie sich erst gegenseitig finden und als gemeinsam betroffen erkennen mussten.
1 Zur Abgrenzung vom Begriff Kinderlandverschickung siehe u. a. Röhl 2022a.
2 Zu nennen ist hier die Aufarbeitung der Heimkinderbewegung (Runder Tisch Heimerziehung (RTH), 2010; Wendelin, 2010; Wensierski, 2007), sowie die Auseinandersetzungen mit sexualisierter Gewalt (Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs [UKASK], 2020).
3 Die Arbeit wurde betreut von Prof. Dr. Sabine Andresen und zweitbetreut von Prof. Dr. Frank Oswald. Sie ist im Kontext des Graduierten Kollegs „Doing Transitions“ (https://doingtransitions.org/) entstanden.
4 Vergleiche hierzu z. B. die Homepage der Initiative Verschickungsheime: https://verschickungsheime.de/ [31. Oktober 2023].
* * *
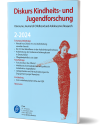 Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist in Heft 2-2024 unserer Zeitschrift Diskurs Kindheits- und Jugendforschung / Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research erschienen.
Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist in Heft 2-2024 unserer Zeitschrift Diskurs Kindheits- und Jugendforschung / Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research erschienen.
Mehr Leseproben …
… finden Sie auf unserem Blog.
© Unsplash 2024, Foto: Markus Spiske


