Deutschland im Aufbruch: Was erwarten die Deutschen von der neuen Regierung und wie müssen sich Politiker und Parteien ändern? Ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Horst Opaschowski, wissenschaftlicher Leiter des Opaschowski Instituts für Zukunftsforschung (OIZ) in Hamburg
„Zum Glück haben wir die Wahl!“ – Was ist das?
„Zum Glück haben wir die Wahl!“ – unter diesem Motto teilen unsere Autor*innen ihre Perspektiven auf die Bundestagswahl 2025. Demokratie ist eine der größten Errungenschaften unserer Gesellschaft, doch sie ist keine Selbstverständlichkeit. Sie lebt davon, dass wir sie aktiv gestalten, schützen und immer wieder aufs Neue mit Leben füllen.
Mit dieser Beitragsreihe möchten wir die Vielfalt der Stimmen sichtbar machen und gemeinsam ein Zeichen setzen: für die Freiheit, die Demokratie uns gibt, und für die Verantwortung, die sie mit sich bringt.
***
Deutschland vor der Wahl. Ein Land im Aufbruch? Kurs- und Politikwechsel sind angesagt – immer verbunden mit dem Ziel, für einen Neuanfang zu sorgen. Quer durch die politische Landschaft sind sich fast alle Parteien einig: Ein Aufbruch muss her! Die CDU versteht sich als Partei für „Aufbruch und Erneuerung“, die SPD für „Aufbruch und Modernisierung“. Die Grünen konzentrieren sich zusätzlich auf den „Bildungsaufbruch“. Das „Bündnis Sarah Wagenknecht“ feiert gerade Geburtstag und verkündet stolz: „Ein Jahr Aufbruch für Deutschland“. Die FDP bringt es auf den Punkt, was alle vermutlich wollen: „Aufbruch statt Stillstand“. Die sich fast inflationär ausbreitende politische Zauberformel „Aufbruch“ für die nächste Bundestagswahl droht fast zum Unwort zu werden.
Ist am Ende eigentlich alles egal – egal, wen man wählt und egal, wer regiert oder nicht regiert? Gleicht die nächste Bundestagswahl einem Lotteriespiel, bei dem alle wahllos ihr Wahl-Los ziehen? Der Eindruck verfestigt sich: Wir müssen uns Sorgen um die Austauschbarkeit von Parteien und Programmen machen. Es ist doch unbestritten: Wir erleben derzeit eine krisenhafte Übergangsphase und leiden weltweit unter einem gestörten Gleichgewicht in einer Periode des Übergangs. Die Weichen müssen in diesen Zeiten des Umbruchs neu gestellt werden, um wieder zu einem dynamischen Gleichgewichtszustand zu gelangen. Andernfalls bewirken wachsende soziale Konflikte, dass die Bevölkerung das Vertrauen in politische Institutionen zunehmend verliert und populistischen oder autoritären Versprechungen vertraut.
In dieser kritischen Umbruchzeit wächst die Unzufriedenheit eines Großteils der Bevölkerung. Die Enttäuschungserfahrungen häufen sich. „Politikverdrossenheit“ war ein Jahr nach dem Ende des Golfkriegs 1991 das „Wort des Jahres 1992“. Wiederholt sich – historisch gesehen – die Krise der Politik im Jahr 2025, weil die Bevölkerung zu wenige ermutigende Antworten auf die sich ausbreitende Verunsicherung erhalten hat? Es fehlen bisher verlässliche Antworten auf die Frage: „Quo vadis, Deutschland?“
Bundeskanzler Olaf Scholz begründete das Ende der Ampel-Regierung mit dem Vorwurf „Verantwortungslosigkeit“ und „Vertrauensbruch“ an Finanzminister Christian Lindner. Mit dem Vertrauensbruch war zugleich ein Legitimationsschwund von Politik und Parteien verbunden. Politiker werden seither nicht müde, gegenüber der Bevölkerung das „Wir-sitzen-alle-in-einem-Boot“-Gefühl zu betonen, weil sie ohne ihre Mithilfe Schiffbruch befürchten. Sie vergessen dabei: Wer die Bürger in Krisenzeiten ins Boot holt, wird sie in besseren Zeiten nicht mehr vom Steuer verdrängen können.
Was also passiert, wenn nichts passiert? Dann werden die Parteien Nachwuchssorgen plagen. Politische Karriere wird immer weniger ‚in‘ und aktive politische Mitarbeit auf Dauer nur mehr schwer zu erreichen sein. Und die Politik von oben wird bei den Jungen immer weniger Anziehungskraft besitzen. Was also muss sich ändern?
-
Die Politiker müssen sich ändern
Politiker haben zu lange an alten Strukturen festgehalten und nicht schnell und sensibel genug auf die ökonomischen und sozialen Herausforderungen der Globalisierung reagiert. Da brauchen sie sich nicht zu wundern, wenn plötzlich Sand in ihr politisches Getriebe gerät und ihre propagierten Programme und Versprechungen wie ein Kartenhaus zusammenfallen.
Es gibt infolgedessen eine große Sehnsucht nach Identifikationsfiguren mit menschlichen Zügen: Aufrichtig, ehrlich und geradlinig. Authentisch – und nicht nur populär. Vertrauenswürdig – und nicht einfach nur beliebt. Politiker sollen wieder die „3P“ in ihrem Handeln repräsentieren: Persönlichkeit. Programm. Perspektive. Sie sollten den Mut haben, ehrlich und offen zu kommunizieren – auch und gerade dann, wenn fertige Problemlösungen noch nicht absehbar sind. Nur so können Politiker ihre Glaubwürdigkeit wiedergewinnen. Dazu müssen sie mehr Bürgernähe leben und nicht nur propagieren.
-
Die Parteien müssen sich ändern
Die Parteien müssen Antworten auf die offenen Fragen der Bevölkerung geben können:
- Wie repräsentativ sind wir eigentlich noch?
- Welche Interessen vertreten wir wirklich?
- Und wie nah sind wir am Alltagsleben und an den Bedürfnissen der Menschen?
- Politiker dürfen nicht länger in ihrer Parallelwelt („Berlin Bubble“) verweilen. Sie müssen sich wieder mehr den Lebenswirklichkeiten der Menschen stellen und mehr Zukunft wagen, also den Mut haben, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen.
Was wir in diesen Krisenzeiten brauchen, ist ein gelungener Spagat zwischen Bürgerdemokratie und Parteiendemokratie. Parteien und Parlamente müssen in ihren Zielsetzungen und Vorgehensweisen das machen und widerspiegeln, was die Bürger wollen, was sie bewegt und was sie denken, wollen und tun. Die Bevölkerung muss mehr Möglichkeiten erhalten, zu wichtigen Sachfragen Stellung zu beziehen, um etwas bewirken zu können. Volksentscheide werden mehr als bisher darüber entscheiden, was vorrangig getan werden muss. Insbesondere die urbane Bevölkerung im Umfeld der Großstädte fordert mehr Volksbefragungen.
Die Bürger müssen ihre demokratischen Rechte stärker wahrnehmen können, in die politische Offensive gehen und die Parteien in die zweite Linie zurückdrängen, ja teilweise auch entmachten. Ganz im Sinne von Artikel 21 des Grundgesetzes: „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit“ – nicht mehr. Die Willensbildung soll wieder mehr vom Volk („Wir sind das Volk“) als von den Parteien ausgeübt werden.
-
Die Bürger müssen aktiver werden
Politische Willens- und Entscheidungsbildung muss wieder mehr und öfter als in vierjährigen Legislaturperioden vom Volk ausgehen, wenn eine Legitimationskrise der Demokratie verhindert werden soll. Bundesweite Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide werden Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen kontinuierlich ergänzen müssen. Statt Wahlmüdigkeit kann es dann in Zukunft heißen: Helft euch selbst, bevor die Politik euch hilft.
Die bisherige Diskrepanz zwischen Bürger- und Politikerinteressen lässt sich nur durch intensivere Kommunikation ausgleichen. Und das heißt auch: Mehr Volksbefragungen und Volksentscheide. Die Bevölkerung will mitmischen. Über drei Viertel (78%) der deutschen Bevölkerung wünschen sich „eine bessere Gesellschaft und wollen auch mithelfen, eine bessere Gesellschaft zu schaffen“.
Resümee
Die Menschen werden zunächst einmal sich selbst helfen müssen, die Ärmel hochkrempeln, anpacken, loslegen und für eine bessere Gesellschaft kämpfen. Dabei verlieren sie vielleicht ein Stück individueller Freiheit, gewinnen dafür aber mehr soziale Sicherheit. Deutschland braucht eine erweiterte Vision von Wohlstand und Wohlfahrt, in der soziales Wohlergehen genauso wichtig wie wirtschaftliches Wachstum wird.
Die Bürger sagen inzwischen doch selbst, was ihre Lebensqualität gefährdet: Wohnungsnot und Pflegekrise, Einsamkeit und Langeweile, Altersarmut und Angst vor Wohlstandsverlusten, Gewaltkriminalität und Fremdheitsgefühle. An diesen Lebensnöten regierte die Ampel-Regierung bisher weitgehend vorbei. Zivilgesellschaft und Anwenderdemokratie müssen daher wieder mehr zu Hilfe kommen – als Helfer und Mithelfer, Macher und Mitmacher. Mit dem Wunsch nach einer besseren Gesellschaft werden sich dann auch die persönlichen Lebensprioritäten verändern. Konkret heißt dies:
- Mehr Lebensqualitätsverbesserung als Lebensstandardsteigerung
- Mehr Nachbarschaftshilfe als Sozialamtshilfe
- Mehr Wohnen daheim als Einweisung ins Heim.
Das ehemalige Ludwig Erhard’sche Postulat „Wohlstand für alle“ kann zum „Wohlergehen für alle“ werden, wenn die Hoffnung und der Wille für eine bessere Gesellschaft nicht aufgegeben werden.
***
Der Autor

Prof. Dr. Horst Opaschowski, Zukunftswissenschaftler und Berater für Wirtschaft und Politik, leitet seit 2014 das Opaschowski Institut für Zukunftsforschung (OIZ) in Hamburg. Er gilt international als „Mr. Zukunft“ (dpa), „Futurist“ (Xinhua/China) und „Vorhersager vom Dienst“ (Deutschlandfunk). Aktuell ist 2025 sein Buch „Das Opaschowski Zukunftsbarometer. Wegweiser für eine nachhaltige Entwicklung von 2025 bis 2045“ im Verlag Barbara Budrich erschienen.
Mehr Gastbeiträge aus der Reihe …
… sind auf unserem Blog versammelt.
© Foto Horst Opaschowski: privat | Titelbild: gestaltet mit canva.com


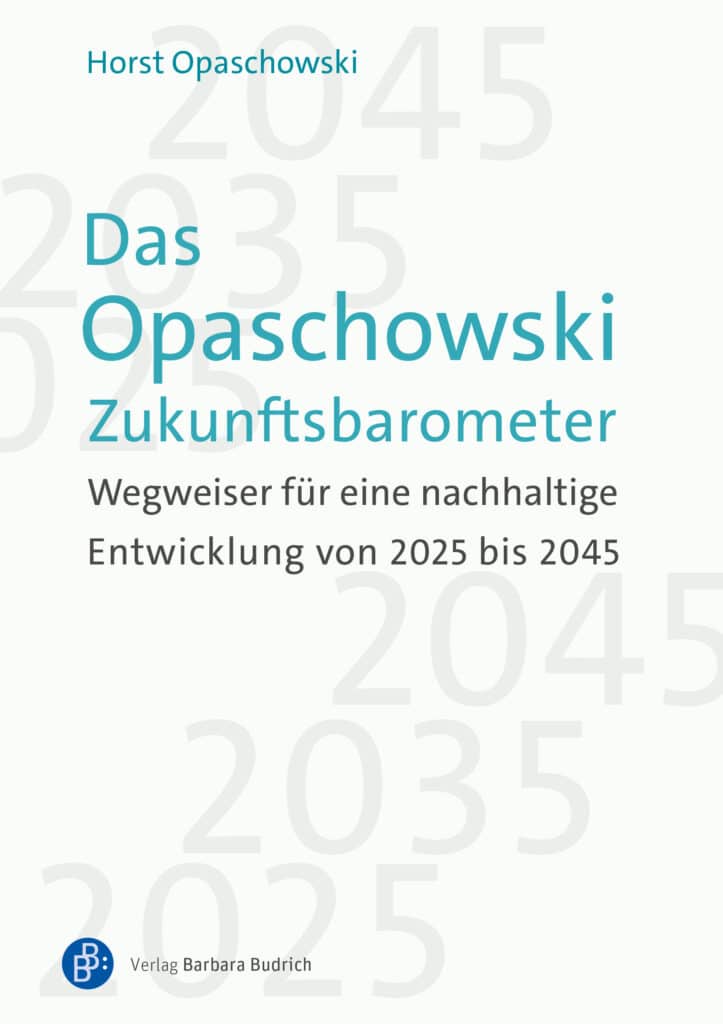 Horst Opaschowski:
Horst Opaschowski: