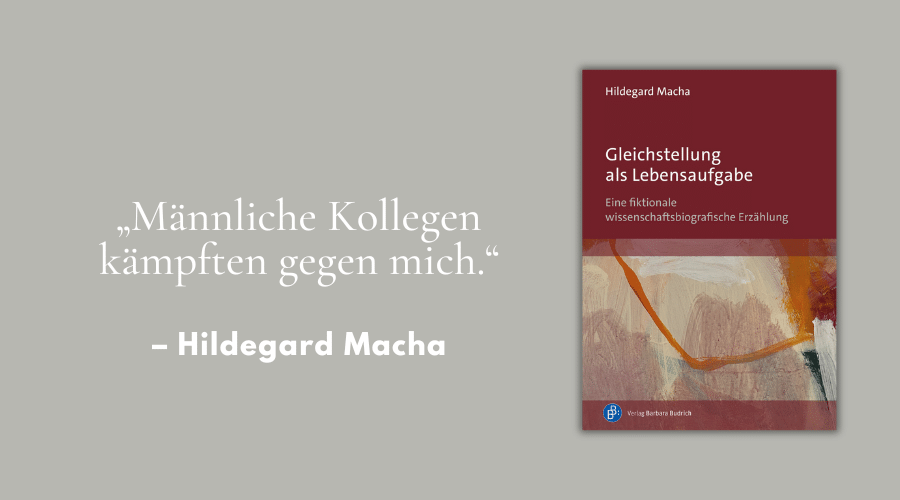Ein Gastbeitrag von Hildegard Macha
Hildegard Machas Lebensweg ist geprägt von Widerstand, Resilienz und persönlichem Wachstum. Ihre Reise führt sie durch die Wirren der Studentenbewegung und die Strömungen des Feminismus, während sie sich aus den Schatten der familiären Gewalt befreit und eine Karriere an der Universität aufbaut.
Ihre wissenschaftsbiografische Erzählung bietet nicht nur Einblicke in die persönlichen Herausforderungen und Triumphe von Hildegard Macha, sondern wirft auch ein Licht auf die gesellschaftlichen Umwälzungen und ideologischen Bewegungen, die ihr Leben geprägt haben. Eine inspirierende Reise einer bemerkenswerten Frau voller Mut, Entschlossenheit und unerwarteter Wendungen.
***
Warum erzähle ich meine Lebensgeschichte? Ich hatte im Laufe meines Lebens oft Entscheidungen getroffen, ohne sie bewusst zu planen. Ich war neugierig, die maßgeblichen Entscheidungen aufzuspüren, die den Verlauf meines Lebens in eine bestimmte Richtung gelenkt hatten, mir sozusagen „auf die Schliche zu kommen“. Im Rückblick wollte ich erkennen, unter welchen persönlichen Bedingungen und Einflüssen ich gehandelt habe. Warum war ich Wissenschaftlerin geworden, wie hatte ich mich in der männlich geprägten Universität der 70er Jahre durchsetzen können und wie konnte ich angesichts meiner Missbrauchserfahrung das alles bewältigen?
Mithilfe von Tagebüchern in die Kindheit
Ich fing damit an, in meinen 29 Tagebüchern zu schmökern, die ich seit dem 11. Lebensjahr mehr oder weniger kontinuierlich geführt habe. Außerdem suchte ich mir die Fotoalben heraus, die mein Vater jeweils für uns 4 Kinder akribisch geklebt und beschriftet hatte. Und da sprang mich die Erinnerung an die kleine Hildegard an, die ich ganz vergessen hatte: ein fröhliches kleines Mädchen mit einem Kopf voller weißblonder Locken, das gerne malte und im Urlaub mit dem Papa am Strand von Baltrum Sandskulpturen und Sandschlösser baute und mit den Geschwistern in den Wellen badete. Das mit Begeisterung in den Kindergarten ging und bei den Schwestern sehr beliebt war. Später war ich ein wildes Kind, das mit einer Bande von Freunden durch die Trümmergrundstücke zog und am liebsten allein in einer zerbombten Glasfabrik spielte. Von unseren Aktivitäten erfuhren die Eltern nichts, wir mussten nur pünktlich zum Essen daheim sein. Aber wie ich mich anhand der Fotos erinnerte, hatte ich auch die Fähigkeit, unbändig und atemlos glücklich zu sein. Zum Beispiel, als ich zu Karneval ein Schornsteinfeger-Kostüm mit Zylinder und Leiter trug. Ich strahlte aus meinen blauen Augen in die Kamera.
Aber ich war auf den Fotos auch oft krank und liege auf dem Sofa mit einem dicken Schal und rotem Fieberkopf. Und in der Pubertät versteckte ich mein Gesicht unter einem langen Pony, der meine Augen fast verdeckte und das fröhliche Lächeln war nicht mehr zu finden, ich war ernst und trug später viel schwarze Kleidung. Man sieht, dass ich es hasste, fotografiert zu werden. Ich war sehr wissbegierig und fühlte mich mit meinen Interessen an Büchern und Kunst oft als Außenseiterin in der Schule. Wo war das glückliche kleine Mädchen geblieben? Ein Schatten hatte sich über mich gelegt, weil ich als Kind vom Vater missbraucht worden war. Ich schwor mir, beim Schreiben herauszufinden, welche Folgen der Missbrauch für mich hatte.
Ich geriet ins Grübeln und versuchte, die Orte und Begegnungen meiner Kindheit zu erinnern. Da lag es nahe, meine drei Geschwister einzuladen, um gemeinsam mit ihnen zu versuchen, die Fakten der Nachkriegszeit, in der wir aufgewachsen sind, mit Evakuierungen und Entbehrungen, zu sammeln. Wenig später trafen sie bei mir ein, meine zwei Brüder und meine Schwester und wir begannen, unsere jeweiligen Erinnerungen auszutauschen. „Weißt du noch, damals, als …“. Da kamen dann die individuellen Erfahrungen zutage, die wir als Kinder gar nicht alle voneinander wussten.
Ich teilte meinen Geschwistern auch so schonend wie möglich mit, dass ich eine autofiktionale Erzählung schreiben wollte, die neben meinem Lebenslauf und der Karriere als Wissenschaftlerin und Forscherin auch noch das geheime Thema beinhaltete, nämlich den Missbrauch durch unseren Vater. Dieses Familiengeheimnis war in der Vergangenheit lange totgeschwiegen worden und nun sollte es plötzlich an die Öffentlichkeit gezerrt werden. Das erschütterte sie zunächst nachhaltig, aber sie äußerten keine Zweifel an der Tat. Sie vertrauten mir. Das war ein entscheidend wichtiger Schritt, der uns ganz eng verband und unsere sehr gute Beziehung zueinander noch vertiefte.
Der Schreibprozess: Studium, Professuren, Familie
Ausgerüstet mit den gemeinsamen Erinnerungen, Fotos und Tagebüchern legte ich nun los mit dem Schreiben. Ich hatte dabei Unterstützung durch eine Autor*innenberaterin und profitierte sehr von ihr. Ich legte eine Struktur an, wie ich den Gedankengang schildern wollte, im Wechsel zwischen Gegenwart und Vergangenheit.
In der Folgezeit erwies sich, dass ich beim Schreiben tief in meine Vergangenheit eintauchte und dabei jeweils mein früheres Ich als Originaltext in den Tagebüchern vorfand, die chronologisch nach Datum geordnet waren und aus denen ich an passenden Stellen auch zitierte. In der Grundschule hatte ich noch sehr gern gelernt, aber im Nonnen-Gymnasium habe ich mich nur gelangweilt, außer in Philosophie und Deutsch. Nach dem Abitur ging ich an die Universität Bonn studieren, mein erster Schritt in die Unabhängigkeit. Dort habe ich mich zunächst im Lehramt für Grundschulen eingeschrieben, weil ich mir ein anspruchsvolleres Studium nicht zutraute, aber das war mir zu langweilig und ich wagte es schließlich, Germanistik, Philosophie und Pädagogik für das Lehramt an Gymnasien zu belegen, meine eigentlichen Interessengebiete.
Oh, und hier tat sich plötzlich für mich eine neue Welt auf, der ganze Kosmos der Wissenschaft lag nun in meiner Reichweite! Ich kämpfte zunächst mit den hohen Anforderungen und auch mit der Diskriminierung als Frau, aber nach und nach bewältigte ich sie nicht nur, sondern war sogar erfolgreich! Mein erstes „sehr gut“ in einem Referat in Pädagogik machte mich stolz und verlegen zugleich – würde ich jetzt unter die Streber*innen gehen? Aber nein, es war reines Interesse, was mich antrieb und das hatte Folgen: Schon in meinem 6. Semester forderte mich mein Pädagogik-Professor auf, bei ihm eine Promotion zu schreiben! Ich hätte mir das selbst nie zugetraut, aber ich dachte mir: „Wenn Professor Geißler meint, dass ich dazu fähig bin, wird er es ja wohl richtig beurteilen, dann versuche ich es halt!“ Und das blieb meine Devise während der Promotion, der Habilitation und bei meinen anschließenden Bewerbungen auf Professuren.
Ich liebte die Forschung und die Lehre mit den Studierenden. Ich machte eine Ausbildung zur Trainerin in Themenzentrierter Interaktion, um noch bessere didaktischen Methoden kennenzulernen und das machte meine Seminare lebendig und spannend. Dabei hatte ich selbst am meisten Spaß. Jeden Morgen ging ich in mein Büro und arbeitete konzentriert an meiner Promotionsarbeit. Ich war so vertieft, dass nichts mich stören konnte, selbst die Witze nicht, die meine Kolleg*innen neben mir erzählten. Denn ich wusste, ich hatte morgens genau 4 Stunden Zeit, während meine Kinder im Kindergarten waren, und dann hatte ich „Kinderdienst“. Ich hatte nämlich inzwischen geheiratet, Jürgen Macha, einen Wissenschaftler, und wir hatten zwei Kinder bekommen, einen Jungen und ein Mädchen. Um nicht allein neben der Karriere an der Uni die Kinderbetreuung zu stemmen, hatten wir parallel mit Freund*innen eine Wohngemeinschaft gegründet und ein Haus mit zwei Wohnungen und einem Garten gekauft. Jede*r Erwachsene betreute an einem Nachmittag alle vier Kinder und dazu hatten wir noch ein Kindermädchen, Claudia.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf war eine große Herausforderung, oft fühlte ich mich überfordert, aber gemeinsam mit meinem Mann und unseren Freund*innen haben wir es ganz gut geschafft. Ich absolvierte meine Qualifikationen in der vorgesehenen Zeit, wenn auch gegen erhebliche Widerstände von männlichen Kollegen und dann kam die Aufgabe, mich auf Professuren zu bewerben. Hier wurden nun die Barrieren noch höher: Männliche Kollegen kämpften gegen mich, wenn ich mich an „ihrer“ Universität als Frau bewarb und schworen mir, dass sie meine Bewerbung vereiteln würden. Aber es gelang mir auf Anhieb, die Kollegen der Universität Augsburg von meiner Qualifikation zu überzeugen und so trat ich dort 1992 im April meinen Lehrstuhl für Pädagogik und Weiterbildung an.
Aufarbeiten von Missbrauchserfahrungen
Und als ich das alle geschafft hatte und nun fand, ich sei an meinem Lehrstuhl „wie auf Rosen gebettet“, weil ich tolle Arbeitsbedingungen hatte – da begannen spontan die Erinnerungen an den Missbrauch in der Kindheit. Ich musste wohl erst die berufliche Sicherheit erlangen, bevor ich mich dem Trauma widmen konnte. Und ich merkte, wie sehr ich durch die Kindheitserfahrung geprägt worden war: Nicht nur hatte ich kein Selbstbewusstsein, ich konnte mich auch an meinen Erfolgen nicht freuen und rannte atemlos stets hinter dem nächsten hohen Ziel her. Das machte mich krank – und traurig. Ich begann eine lange Phase von Therapien, um das Trauma aufzuarbeiten, das ja nicht nur psychisch bewältigt werden musste, sondern auch die körperlichen Folgen waren erheblich: Durch die Unfähigkeit, Gefühle zu erleben, die Verspannungen in Bauch und Nacken, war ich nur ein halber Mensch.
Neben meinen Forschungsprojekten in der Anthropologischen Pädagogik, der Familienforschung und später der Interventionsforschung in Organisationen, der Lehre an der Universität und meiner geliebten Familie bearbeitete ich also nun die Gewalt in der Kindheit. Ich hatte dabei oft ein Gefühl von Gespalten sein zwischen all diesen Anforderungen. Aber zugleich ahnte ich intuitiv: Wenn ich jemals ein glückliches und erfolgreiches Leben führen wollte, musste ich dranbleiben.
Ich machte verblüfft die Erfahrung, dass die Befreiung von dem Trauma zugleich meine Liebes- und Arbeitsfähigkeit befeuerte. Je mehr ich mich von der Erinnerung befreien konnte, desto glücklicher wurde ich, konnte besser auf meinen Mann und die Kinder eingehen und konnte viel konzentrierter arbeiten, nicht zuletzt deshalb, weil ich mehr Distanz bekam und mich selbst besser annehmen konnte. „Mama, du bist eine liebe Mutter und auch eine Arbeitsfrau“, sagte mein Sohn stolz.
Als ich dann in Rente ging, verstarb leider mein Mann. Das war ein großer Verlust und ich brauchte eine lange Phase der Trauerbewältigung. Trotzdem setzte ich den Prozess der Bearbeitung vor allem der körperlichen Folgen der Traumatisierung fort. Dadurch verfügte ich schließlich über mein volles emotionales und körperliches Potential.
Jetzt versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
 Hildegard Macha:
Hildegard Macha:

- emeritierte Professorin der Universität Augsburg für Pädagogik und Erwachsenenbildung an der Philosophischen Fakultät.
- Forschungsschwerpunkte: Pädagogische Anthropologie des Ich, Interventionsforschung in Schulen mit „Kollegialer Beratung“, in Unternehmen zum Thema Gleichstellung mit dem „Transformativen Organisationalen Lernen“, in Kirchen, Kommunen und der Bundeswehr
- Dozentin an der Universität Koblenz im Fernstudiengang Master für Personal und Organisation mit Schwerpunkt Change Management
Über das Buch
Hildegard Machas Lebensweg ist geprägt von Widerstand, Resilienz und persönlichem Wachstum. Ihre Reise führt sie durch die Wirren der Studentenbewegung und die Strömungen des Feminismus, während sie sich aus den Schatten der familiären Gewalt befreit und eine Karriere an der Universität aufbaut. Diese wissenschaftsbiografische Erzählung bietet nicht nur Einblicke in die persönlichen Herausforderungen und Triumphe von Hildegard Macha, sondern wirft auch ein Licht auf die gesellschaftlichen Umwälzungen und ideologischen Bewegungen, die ihr Leben geprägt haben. Eine inspirierende Reise einer bemerkenswerten Frau voller Mut, Entschlossenheit und unerwarteter Wendungen.
Mehr Gastbeiträge …
… sind auf unserem Blog versammelt.
© Foto Hildegard Macha: privat | Titelbild: unsplash.com, Priscilla Du Preez