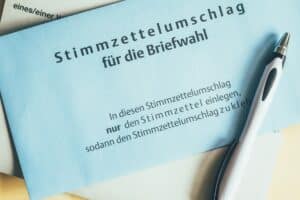Mitbegründerin der Frauenforschung und Grenzgängerin zwischen Wissenschaft und Politik: eine Leseprobe aus „Wie ich lernte aufmüpfig zu sein. Lebensrückblick einer Pionierin der Frauen- und Geschlechterforschung“ von Sigrid Metz-Göckel✝.
***
1 | Aus-der-Reihe-Tanzen kann sich lohnen: Vom Ende zum Anfang
Dieses Buch erscheint am Ende meines Lebens, das mir beim Schreiben dieser Zeilen bereits vor Augen steht. Ob ich sein Erscheinen noch erlebe, ist ungewiss. Warum will ich es unbedingt zu Ende bringen? Eitelkeit, Größenwahn – solche Motive unterstellte ich mir zeitweise, bis mir klar wurde: In meiner Biographie drücken sich gesellschaftliche Entwicklungen aus, die ich mit einer ganzen Frauengeneration teile. Diese Generation – grob beschreibbar als die Kriegs- und Nachkriegsfeministinnen – hat das Leben in der (alten) Bundesrepublik verändert. Meine persönliche Geschichte ist die von vielen und mit vielen.
Ich werde in diesem Buch von meinen Anfängen erzählen, um in der Rückschau die Voraussetzungen aufzuzeigen für meinen Lebensweg. Nicht immer halte ich dabei die historische Zeitabfolge ein, sondern greife manchmal vor – z.B. von Erfahrungen im Jahre 1968 auf das, was 1976 daraus folgte.
Das Buch beginnt und endet mit der Situation von heute, in der meine Stiftung „Aufmüpfige Frauen“ die zentrale Rolle einnimmt – ist sie doch das, was mich – hoffentlich – überdauern wird.
Mein Blick für die Frauen wurzelt in meiner Kindheit, in der ich – kriegsbedingt – von starken Frauen umgeben war. Alles, was zu tun war, wurde von Frauen bewältigt. Und so dachte ich im Umkehrschluss: Wie kann man nach all den Erfahrungen den Frauen bloß so wenig zutrauen? Sie konnten doch alles schaffen!
Es waren die Frauen der Nachkriegsgeneration, die in der Frauenbewegung aufstanden – und aufmüpfig wurden. Ihnen ging es besser als ihren Müttern und Großmüttern und als Frauen je zuvor. Sie nutzten die Chance einer demokratischen Gesellschaft, traten selbstbewusst auf und kritisierten lautstark die Geschlechterverhältnisse.
Meinen Bildungsweg unterstützten meine Mutter und Großmutter – solange sie lebten. Ich ging noch zur höheren Schule, als Großmutter zu einer Operation ins Krankenhaus aufbrach und sagte: »Du kannst studieren und Beamtin werden«. Sie starb im Krankenhaus. Ihren Rat habe ich befolgt.
Nur durch den westdeutschen Sozialstaat wurde mein Berufsweg möglich: Da mein Vater im Krieg gefallen war, erhielt ich eine Halbwaisenrente, das Fahr- und Schulgeld für die höhere Schule wurde unserer Mutter als Kriegerwitwe erstattet. Außerdem gehörte ich zur ersten Generation der Studierenden, die vom Honnefer Modell profitierte, dem Vorläufer des heutigen BAföG. Ohne diese staatliche Unterstützung wäre mein Bildungsweg unmöglich gewesen. Deswegen war es mir ein Bedürfnis, diesem Sozialstaat der Nachkriegszeit mit seinem Lastenausgleich und der Kriegsopferversorgung in Dankbarkeit etwas zurückzugeben, wenn auch als aufmüpfige Frau.
Ich war ein schüchternes und stilles Kind. Bis zum Ende des Studiums hielt ich mich im Hintergrund. Erst die neue Frauenbewegung, der ich mich seit ihren Anfängen in den 1970er Jahren verbunden fühle, gab mir das Selbstvertrauen, »aufmüpfig« zu werden. Gemeinsam mit anderen Frauen fühlte ich mich stark. Ich lernte zu widersprechen, ja: aufzubegehren.
Als junge Professorin konnte ich in den 1970er und 1980er Jahren mit diesem Rückenwind vieles lernen: Meine Stimme für mich und andere Frauen zu erheben, Mut zum eigenen Denken zu entwickeln, die Beharrlichkeit, Ziele zu verfolgen und Steine aus dem Weg zu räumen. Ich setzte mich in den Gremien – zumeist als einzige Frau und daher mit allerhand Verwunderung wahrgenommen – für unsere Sichtbarkeit ein und für die gerechtere Verteilung der Ressourcen. Inspiriert haben mich dabei auch meine »aufmüpfigen« Studentinnen und Doktorandinnen.
Dass ich diesen »Kampf« aus einer sicheren Position führen konnte, verdanke ich einer Frau: Professorin Helge Pross. Sie förderte mich und ermöglichte mir den Ruf nach Dortmund.
Ich kämpfte immer auch für meine Mutter. Sie war überzeugt: Bildung sei das Wertvollste, das ein Mensch besitzt. Sie hätte, wie so viele andere Frauen ihrer Generation, selbst gern studiert – und ich bin sicher: mit großem Erfolg.
***
Sie möchten gern weiterlesen?

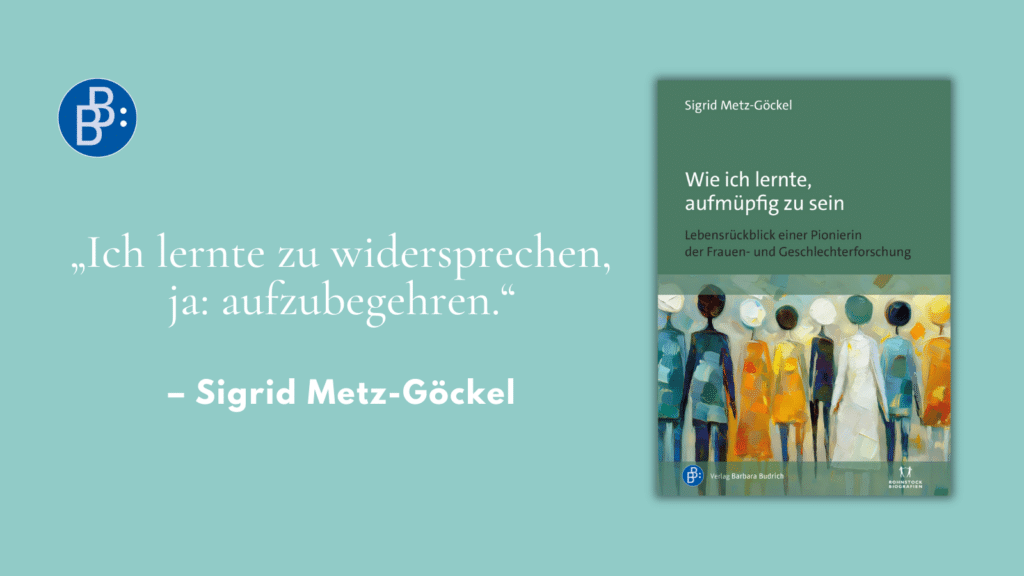
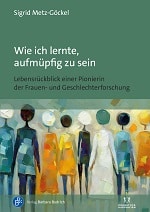 Sigrid Metz-Göckel✝:
Sigrid Metz-Göckel✝: Prof. (i.R.) Dr. Sigrid Metz-Göckel✝, Frauen- und Geschlechterforscherin, Hochschuldidaktikerin und Bildungsforscherin sowie
Prof. (i.R.) Dr. Sigrid Metz-Göckel✝, Frauen- und Geschlechterforscherin, Hochschuldidaktikerin und Bildungsforscherin sowie