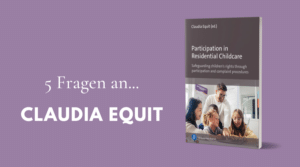Kommunale Verwaltungsdigitalisierung im föderalen Kontext: ein europäischer Ländervergleich
Justine Marienfeldt, Jakob Kühler, Sabine Kuhlmann, Isabella Proeller
dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management, Heft 1-2024, S. 35-59.
Zusammenfassung: Dieser Beitrag vergleicht die kommunale Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Länder) als Vertreter der kontinentaleuropäisch-föderalen Verwaltungstradition bei zugleich unterschiedlichen Digitalisierungsansätzen und -fortschritten. Basierend auf Interviews mit 22 Expert*innen und Beobachtungen in je einer Kommune pro Land sowie Dokumenten-, Literatur‐ und Sekundärdatenanalysen untersucht die Studie, wie Verwaltungsdigitalisierung im Mehrebenensystem organisiert ist und welche Rolle dabei das Verwaltungsprofil spielt sowie welche Innovationsschwerpunkte die Kommunen im Hinblick auf die Leistungserbringung und die internen Prozesse setzen. Die Ergebnisse zeigen, dass der hohe Grad lokaler Autonomie den Kommunen ermöglicht, eigene Akzente in der Verwaltungsdigitalisierung zu setzen. Zugleich wirken die stark verflochtenen komplexen Entscheidungsstrukturen und hohen Koordinationsbedarfe in verwaltungsföderalen Systemen, die in Deutschland am stärksten, in Österreich etwas schwächer und in der Schweiz am geringsten ausgeprägt sind, als Digitalisierungshemmnisse. Ferner weisen die Befunde auf eine unitarisierende Wirkung der Verwaltungsdigitalisierung als Reformbereich hin. Insgesamt trägt die Studie zu einem besseren Verständnis dafür bei, welche Problematik die Verwaltungsdigitalisierung für föderal-dezentrale Verwaltungsmodelle mit sich bringt.
Schlagworte: Digitalisierung, Verwaltungsreform, Kommunen, DACH-Länder, Vergleich
Local government digitalization in a federal context: A European country comparison
Abstract: This article compares the digitalization of local government in Germany, Austria and Switzerland (DACH countries) as representatives of the continental European federal administrative tradition, but with different approaches to and progress in digitalization. Based on interviews with 22 experts and observations in one municipality per country as well as document, literature and secondary data analyses, the study examines how administrative digitalization is organized in the multi-level system and what role the administrative profile plays in this, as well as what innovation priorities the municipalities set with regard to service provision and internal processes. The results show that the high degree of local autonomy enables the municipalities to set their own innovation priorities. Simultaneously, the highly intertwined complex decision-making structures and need for coordination in federal administrative systems, which are most pronounced in Germany, somewhat weaker in Austria and least pronounced in Switzerland, act as barriers to digitalization. Furthermore, the findings point to a unitarizing effect of administrative digitalization as an area of reform. Overall, the study contributes to a better understanding of the problems that administrative digitalization poses for federal-decentralized administrative systems.
Keywords: Digitalization, administrative reform, local government, DACH countries, comparative case study
1 Einleitung
Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist seit Mitte der 2000er Jahre das zentrale Thema der Verwaltungsmodernisierung (Bogumil & Jann, 2020, S. 45–46; Kuhlmann & Marienfeldt, 2023, S. 322 ff.; Mergel, 2019). Verwaltungsdigitalisierung umfasst dabei eine Vielzahl von Service-, Prozess-, IT- und Managementinnovationen sowohl im Außen- als auch im Innenverhältnis der öffentlichen Verwaltung (Heuermann et al., 2018; De Vries et al., 2016): Einerseits beinhaltet sie somit die Bereitstellung von Informationen, vor allem aber die Kommunikation und Interaktion zwischen Bürger*innen und Verwaltung über Internettechnologien mit dem Ziel der Leistungserbringung (externe Digitalisierung) (Bogumil et al., 2022; Gräfe et al., 2024; Schwab et al., 2019). Andererseits umfasst sie die Nutzung neuer Technologien, die Bereitstellung neuer Services und die Anpassung von Prozessen innerhalb der Verwaltung (interne Digitalisierung) (Mergel et al., 2019). Die Kommunen stellen durch die Nähe zu den Bürger*innen die wichtigste Ebene der Erbringung öffentlicher Leistungen dar (Kuhlmann & Bouckaert, 2016) und spielen somit eine ausschlaggebende Rolle bei der Digitalisierung der angebotenen Leistungen und der diesen zugrundeliegenden internen Prozesse (Kuhlmann & Heuberger, 2023). Im europäischen Vergleich zeigt sich jedoch, dass die kommunale Ebene im Vergleich zu anderen Verwaltungsebenen bei der Digitalisierung in Verzug geraten ist (Europäische Kommission, 2023b). Gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Länder) verfügen Kommunen über eine vergleichsweise hohe Autonomie und Handlungsspielräume im Organisationsbereich. Oftmals stehen sie allerdings vor der Herausforderung, dass es ihnen an finanziellen Mitteln, personellen Ressourcen, (IT‐)Kompetenzen und IT-Infrastruktur mangelt, die als wesentliche Grundlage für die strategische und operative Umsetzung der Digitalisierung gelten (Meijer, 2015; De Vries et al., 2016). Hieraus entsteht für die Kommunen häufig ein Dilemma zwischen der Ausübung lokaler Autonomie und dem Wunsch nach mehr Unterstützung durch die übergeordneten Ebenen.
Angesichts ihrer wichtigen Rolle bei der öffentlichen Leistungserbringung finden Kommunen in der international vergleichenden verwaltungswissenschaftlichen Digitalisierungsforschung vergleichsweise wenig Beachtung. Diese Forschungslücke greift der vorliegende Beitrag auf und untersucht die kommunale Verwaltungsdigitalisierung in ländervergleichender Perspektive. Die DACH-Länder wurden als Vertreter einer gemeinsamen kontinentaleuropäisch-föderalen Verwaltungstradition ausgewählt, die zugleich unterschiedliche Digitalisierungsansätze und -fortschritte aufweisen, worin wir das „Puzzle“ der folgenden Analyse sehen. Um diese Unterschiede zu erklären, wird zum einen die Art und Weise, wie Verwaltungsdigitalisierung im Mehrebenensystem organisiert ist, untersucht. Denn um die Dynamiken der kommunalen Reformaktivitäten zu verstehen, ist ihre institutionelle Einbettung im Mehrebenensystem zu berücksichtigen (Cinar et al., 2024; Kuhlmann et al., 2021). Zum anderen wird analysiert, welche Innovationsschwerpunkte die Kommunen in Bezug auf die lokale Leistungserbringung gegenüber den Bürger*innen (externe Digitalisierung) und im Hinblick auf Prozesse innerhalb der Verwaltung (interne Digitalisierung) setzen. Schließlich werden weitere institutionelle und kulturelle Merkmale der Verwaltungssysteme herangezogen, um die unterschiedliche Responsivität der kommunalen Akteure gegenüber digitalen Innovationen zu erklären.
In den letzten Jahren haben sich verschiedene Forschungsstränge herausgebildet, die sich mit der digitalen Transformation in der öffentlichen Verwaltung auseinandersetzen. Diese umfassen Fragen nach der Art des Wandels sowie nach Treibern, Erklärungsfaktoren und Auswirkungen von Digitalisierung (vgl. Fischer et al., 2021; Haug et al., 2023), teils mit Blick auf die kommunale Ebene (Budding et al., 2018; Kuhlmann & Heuberger, 2023). Auch die vergleichende Verwaltungsforschung hat sich ansatzweise dem Thema zugewandt (Breaugh et al., 2023; Marienfeldt, 2021; Rackwitz &Palaric, 2023). Wie bereits beschrieben, spielt die kommunale Ebene bei diesen internationalen Vergleichen in der Regel jedoch eine nachrangige Rolle (für eine Ausnahme siehe Ingrams et al., 2020), sodass hier ein besonderer Forschungsbedarf besteht. Insbesondere institutionelle Ansätze, die nach den organisatorischen, politischen und administrativen Kontextbedingungen der digitalen Transformation im öffentlichen Sektor, speziell auf kommunaler Ebene, fragen, kommen bislang deutlich zu kurz.
Trotz vergleichbarer Verwaltungssysteme zeigen sich Unterschiede im kommunalen Digitalisierungsfortschritt und seinen Ausprägungen zwischen den Ländern. Ähnlich wie andere Verwaltungsreformen, etwa das New Public Management (NPM), ist auch die Verwaltungsdigitalisierung in die jeweiligen Verwaltungssysteme und -kulturen eingebettet und wird von diesen beeinflusst (Breaugh et al., 2023; Kuhlmann & Wollmann, 2019). Der vorliegende Beitrag setzt hier an und konzentriert sich auf die folgenden zwei Leitfragen, die mittels einer vergleichenden Fallstudie der DACH-Länder beantwortet werden sollen:
(1) Wie ist die Verwaltungsdigitalisierung im Mehrebenensystem der DACH-Länder organisiert und welche Rolle spielt dabei das kontinentaleuropäisch-föderale Verwaltungsprofil mit den Kommunen als Schlüsselakteuren?
(2) Inwieweit unterscheiden sich die Digitalisierungsansätze in den DACH-Ländern, insbesondere im Hinblick auf die kommunalen Innovationsschwerpunkte?
Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Zunächst erfolgen eine konzeptionelle Einordnung des Untersuchungsgegenstandes und die Herleitung des vergleichenden Forschungsdesigns (Kapitel 2). Anschließend werden die Methoden und die Datenbasis erläutert (Kapitel 3). In Kapitel 4 werden die empirischen Befunde in einer „country-by-country“-Logik dargestellt. Abschließend werden die zentralen Ergebnisse verglichen und diskutiert (Kapitel 5) und Schlussfolgerungen für die Verwaltungspraxis und die Verwaltungsforschung gezogen (Kapitel 6).
2 Digitalisierung der kommunalen Verwaltung als Verwaltungsreform
2.1 Externe und interne Digitalisierung
Digitalisierung, verstanden als die Einführung von Informations- und Kommunikationstechnologien in Organisationen des öffentlichen Sektors, hat breiten Eingang in die Innovationsforschung gefunden (Cinar et al., 2024). Zum einen betrifft die externe Dimension der Digitalisierung – auch als E-Government, E-Services oder digitale Verwaltungsleistungen bezeichnet – die Veränderung der Leistungserbringung gegenüber Bürger*innen oder Unternehmen. Diese umfasst die Bereitstellung von Informationen, vor allem aber die Kommunikation und Interaktion zwischen Bürger*innen und Verwaltung über Internettechnologien (Bogumil et al., 2022; Gräfe et al., 2024; Schwab et al., 2019). Ziel ist hier (soweit die Leistung dies zulässt) eine medienbruchfreie, Ende-zu-Ende-Digitalisierung von der Antragstellung über die Bearbeitung bis hin zur Übermittlung des Ergebnisses an den Antragstellenden durchzuführen. Zum anderen bezieht sich die interne Dimension von Digitalisierung auf die Anpassungen von Prozessen innerhalb der Verwaltung und zwischen Verwaltungseinheiten durch die Nutzung neuer Technologien (Mergel et al., 2019). Digitalisierung umfasst somit sowohl Service‐ und Prozessinnovationen in Bezug auf Verwaltungsprozesse, als auch IT‐ und Managementinnovationen, wie neue Software, Strategien oder Rollen (Heuermann et al., 2018, S. 16; De Vries et al., 2016, S. 153). Abhängig vom Umfang der Veränderung können diese Innovationen im Sinne des von Mergel, Edelmann und Haug (2019) vorgeschlagenen Kontinuums als digitale Bereitstellung (digitization) (1:1-Umwandlung von analog zu digital), Digitalisierung (digitalization) (Anpassung von Dienstleistungen und Prozessen) und digitaler Transformation (digital transformation) (kulturelle, organisatorische und relationale Veränderungen) verstanden werden.
2.2 Verwaltungsprofile und ihre Offenheit für Verwaltungsreformen
Anknüpfend an einschlägige Typologien der vergleichenden Verwaltungswissenschaft (siehe Kuhlmann, 2019; Kuhlmann & Wollmann, 2019), gehen wir von der Annahme aus, dass Verwaltungsreformen (hier: die kommunale Verwaltungsdigitalisierung) entscheidend durch die jeweiligen Ausgangs- und Kontextbedingungen in den Ländern beeinflusst werden. Dabei kommt der institutionellen Dimension (Verwaltungsaufbau und Funktionalprofil der Kommunen) sowie der kulturellen Dimension (Verwaltungskultur) besondere Bedeutung zu (ebd.). Die hier untersuchten Länder der DACH-Gruppe zeichnen sich zwar durch ein gemeinsames kontinentaleuropäisch-föderales Verwaltungsprofil aus, jedoch weisen sie im Hinblick auf ihre intergouvernementalen Systeme und der Rolle der Kommunen auch eine Reihe von Unterschieden auf, von denen wir annehmen, dass sie lokale Digitalisierungsdynamiken (mit‐)erklären können (siehe Tabelle 2 im Anhang).
Bezogen auf die institutionelle Dimension sind der Verwaltungsaufbau (Grad der Zentralisierung bzw. Dezentralisierung) (Pollitt & Bouckaert, 2017) sowie das Funktionalprofil der Kommunen (Umfang und Wichtigkeit kommunaler Aufgaben sowie kommunale Autonomie in der Aufgabenerledigung) entscheidend (Kuhlmann & Wollmann, 2019; Ladner et al., 2019). Der Verwaltungsaufbau und die funktionale Aufgabenverteilung im föderalen Mehrebenensystem bestimmen, welche Ebenen überhaupt für die Digitalisierung bestimmter Verwaltungsleistungen und Prozesse zuständig sind. Daraus folgt, inwieweit die lokale Ebene autonom über Vorgehen und Schwerpunktsetzung bei der Digitalisierung entscheiden kann. Für die DACH-Länder institutionell bedeutsam sind das Subsidiaritätsprinzip und die starke Stellung der kommunalen Selbstverwaltung. Die Aufgabenerledigung sowohl von übertragenen Staatsaufgaben als auch kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben obliegt maßgeblich den subnational-dezentralen Institutionen. Die stark dezentralisierte Struktur lässt sich mit unterschiedlichen Vermutungen hinsichtlich der Verwaltungsdigitalisierung verknüpfen. Einerseits wäre anzunehmen, dass in diesem Kontext nur eine gering ausgeprägte zentrale Einführung digitaler Verwaltungsleistungen und -prozesse in den Kommunen stattfindet. Dies stellt in der Folge eine eher hinderliche strukturelle Ausgangsbedingung dar, da zur Koordinierung von Innovations-/Digitalisierungsaktivitäten eher spezialisierte zentrale Institutionen als vorteilhaft erachtet werden (Cinar et al., 2024).
* * *
 Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist im Open Access in Heft 1-2024 unserer Zeitschrift dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management erschienen.
Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist im Open Access in Heft 1-2024 unserer Zeitschrift dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management erschienen.
Mehr Leseproben …
… finden Sie auf unserem Blog.
© Unsplash 2024, Foto: Daniel Enders-Theiss