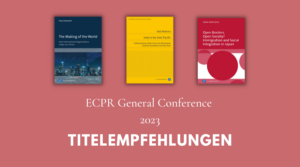„Das dürfte in Europa eigentlich nicht passieren“. Das Problem der Internationalen Beziehungen aus Sicht des Globalen Südens
Siba N‘Zatioula Grovogui & Sarah Then Bergh
PERIPHERIE – Politik • Ökonomie • Kultur, Heft 169+170 (1-2023), S. 11-45.
Zusammenfassung
Dieser Beitrag soll ein Plädoyer von Eliten des globalen Südens, insbesondere von führenden Politiker:innen und Meinungsmacher:innen in Afrika, aufgreifen, um der Debatte über den russischen Einmarsch in der Ukraine im Rahmen größerer Fragen zur internationalen Ordnung und den damit verbundenen Sicherheitssystemen eine andere Wendung zu geben. Dementsprechend geht der Artikel den zeitgenössischen Artikulationsformen der afrikanischen Blockfreiheit nach, die die Frage der Rechte der Ukraine, die Anliegen Russlands und die Ambitionen der NATO als drei separate Fragen betrachten, welche nicht miteinander vermengt oder als moralisch und rechtlich untrennbar zusammengeworfen werden dürfen. Obwohl solche Ansichten mit internationalen Normen und dem Grundsatz eines auf Regeln basierenden internationalen Systems im Einklang stehen, haben sie europäische Analytiker:innen verwirrt und amerikanische Politiker:innen verärgert, die davon ausgehen, die Führung Europas und des Westens sei von globalem normativem Nutzen, wenn nicht gar ein wünschenswertes universelles Gut. Dies hat zum falschen Vorwurf afrikanischer Gleichgültigkeit gegenüber der Ukraine geführt, der wenn auch nicht ausdrücklich, sondern unterschwellig den Gegensatz zwischen einem zivilisierten, liberal-demokratischen Europa und einem Afrika wiederholt, welches die Bedeutung von internationaler Moral, Recht und Sicherheit noch nicht verstanden habe. Gegen dieses falsche Urteil versucht der Beitrag, die konkurrierenden Erinnerungen und Lehren der afrikanischen Eliten aus der Geschichte zu beleuchten, die weder Teil des europäischen/westlichen noch des russischen Common Sense sind.
Schlagwörter: Bündnisfrei, Globaler Süden, Internationale Sicherheitsordnung, NATO, Russland-Ukraine-Krieg
This Shouldn‘t Happen in Europe: The Problem of International Thought Seen from the Global South
Summary
This paper aims to revisit a plea by global south elites, particularly leaders and opinion-makers in Africa, to recast the debate around the Russian invasion into Ukraine along the axis of larger questions about the international order and attendant security systems. Accordingly, the article traces contemporary articulations of African non-alignment, which have held the question of Ukraine rights, Russian concerns, and NATO ambitions as three separate questions that are not to be confused or conflated as morally and legally indivisible. Though consistent with international norms and the principle of a rule-based international system, such views have confused European analysts and angered US policymakers operating on the predicate that the guidance of Europe and the West is of global normative utility, if not a desirable universal good. This has led to a false charge of African indifference toward Ukraine, exemplified in the repeated, if insinuated, contrast between a civilized liberal democratic Europe and an Africa that has yet to understand the stakes of international morality, law, and security. Against this misinformed judgement, the paper seeks to illuminate the competing memories and lessons of histories that African elites hold, which are neither part of the European/Western nor Russian commonsense.
Keywords: global south, International Security Regimes, NATO, nonalignment, Russia-Ukraine conflict
Es kann keinen Zweifel geben, dass Russlands Einfall in die Ukraine das seit dem Zweiten Weltkrieg gepflegte Selbstbildnis Europas als Friedenszone, in Frage gestellt hat. Als Präsident Putin am 24. Februar 2022 die militärische Invasion in der Ukraine sanktionierte, waren die Reaktionen der europäischen Regierungen weitgehend einheitlich: allgemeiner Schock, Unglauben und Entrüstung. Der oben zitierte deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz brachte diese Stimmung zum Ausdruck. Für sie steht die unverfrorene Aggression und das militärische Abenteuer Vladimir Putins im Gegensatz zu den Normen und dem Ethos eines stabilen, prosperierenden und regelbasierten Europas. Folglich drohte die russische Invasion die entscheidenden kulturellen und ideologischen Annahmen und Vorstellungen zu zerreißen, auf denen Europa sein Selbstbild aufgebaut hat. Dennoch ließ sich Europa von der russischen Bedrohung nicht abschrecken, an seinem Selbstverständnis festzuhalten, nach dem es sich nicht nur Russland entgegenstellte, sondern zugleich zwei parallele, freilich konvergierende Projekte hochhielt: Das erste ist die Ausweitung der liberaldemokratischen europäischen Sphäre auf ehemals kommunistische Staaten in Osteuropa. Das zweite betrifft das Recht der North Atlantic Treaty Organization (NATO), ihren Sicherheitsschirm auf jeden Ort in Europa auszudehnen und die Ukraine sowie andere Staaten, die dies wünschen, als Ausdruck ihrer Selbstbestimmung Mitglied werden zu lassen. Von der Gerechtigkeit dieser Positionierung überzeugt, waren die Öffentlichkeit und meinungsbildende Instanzen in Europa überrascht, dass viele Staaten, besonders in Afrika, noch nicht ausreichend davon überzeugt sind, dass die Missbilligung der russischen Invasion logisch dazu führen müsse, sowohl das europäische Selbstbild als friedlich und wohlmeinend, wie auch die Ausweitung der NATO gutzuheißen, ohne dass legitime Fragen aufgeworfen würden. Wir behaupten in diesem Beitrag, dass es moralisch möglich ist, die russische Invasion in der Ukraine zu missbilligen und sich dennoch ein Urteil über die Begründung und die Klugheit der europäischen und transatlantischen Reaktionen darauf vorzubehalten.
Wir pflichten bei, dass es wenig Rechtfertigung für die Invasion Russlands in der Ukraine gibt. Vielmehr ist es Ziel dieses Artikels, den Äußerungen von Angehörigen afrikanischer Eliten – politischer Führungspersönlichkeiten wie Meinungsmacher:innen – genauer nachzugehen, die eine Diskussion über die russische Invasion entlang der übergreifenden Fragestellungen zur existierenden internationalen Ordnung und einer Neustrukturierung des internationalen Systems fordern. Die engen Grenzen der gegenwärtigen Debatte zeigen sich anhand der Auseinandersetzung in Deutschland anlässlich der weitgehenden Enthaltung afrikanischer Staaten bei der Abstimmung über die Resolution der UN-Generalversammlung von März 2022, in der Russland aufgefordert wurde, sich aus der Ukraine zurückzuziehen. Ebenso deutlich zeichnen sie sich in dem Gesetzentwurf für eine Concerning Malign Activities in Africa Act im US-Senat vom 28. April 2022 (Fabricius 2022a) ab. Zusammengenommen machen diese Fälle deutlich, dass sich die entsprechenden Narrative über irregeleitete Afrikaner:innen mit hartnäckigen Annahmen verbinden, nach denen „Europa“ und der „Westen“ im Gegensatz zu Russland und, aus der Sicht mancher auch zum Globalen Süden, Träger der internationalen Normen und der internationalen Moral seien. Das hat für die globalen Debatten über den gegenwärtigen Konflikt zwei miteinander verknüpfte Konsequenzen.
Zum einen wurden auf der Grundlage solcher Abgrenzungen die Forderungen formuliert, sich den europäisch-westlichen Positionen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine anzuschließen. Zum andern wurden differenzierte Formulierungen einer bündnisfreien Position durch verschiedene afrikanische Diplomat:innen entlegitimiert, die der Vorstellung entgegentraten, Europa und der Westen hätten einen exklusiven Anspruch auf moralische Reife und ethische Überlegenheit gegenüber anderen Regionen und Akteur:innen. Die afrikanischen Ansichten und Positionierungen, wie sie aus formellen Stellungnahmen und dem Abstimmungsverhalten bei den Vereinten Nationen hervorgehen, beruhen auf ebenso nachvollziehbaren historischen, moralischen und ethischen Argumenten, die zur Vorsicht gegenüber der unhinterfragten Übernahme einer einseitigen Sicht auf den Konflikt gemahnen. Sie bestehen insbesondere auf einer genauen Prüfung einer Reihe von Facetten des Konflikts: etwa, dass die Frage der ukrainischen Souveränität und Selbstbestimmung einschließlich des Wunsches nach NATO-Mitgliedschaft zusammen mit Russlands nationalen Sicherheitsinteressen betrachtet wird, die wiederum aus der Bedrohung durch eine Stationierung von Atomwaffen in der Nähe seiner Grenzen im Rahmen der Bündnissysteme und angesichts militärischer Gegnerschaft hervorgehen. Beides steht in paralleler, aber konflikthafter Beziehung zu den Bestrebungen der NATO, ihren Sicherheitsschirm in Europa auch bis an die Grenzen Russlands auszudehnen. Die Unfähigkeit, sich ernsthaft mit der von Afrikaner:innen aufgezeigten Komplexität dieser Probleme zu befassen, wirft Fragen auf hinsichtlich des Elends europäisch-westlicher Konzepte der internationalen Beziehungen. Die auf diesen beruhenden Methoden und Praktiken verstellen innerhalb des aktuellen Konflikts den Weg zu globalen Lösungen.
Die damit einhergehenden Einsprüche und die Suche nach einer internationalen Ordnung jenseits ihrer Verewigung als eindeutig europäisch-westliches Projekt machen diese Vorstellungen entschieden zum Moment einer Bewegung des Globalen Südens, wie auch unser Untertitel unterstreicht. Entsprechend verstehen wir „Globaler Süden“ als einen Begriff , der „den Geist der Programmatik der Dritten Welt“ erfasst, der „noch immer zur Überprüfung der intellektuellen, politischen und moralischen Grundlagen des internationalen Systems anhält“ (Grovogui 2011: 176). Dieser Geist ist räumlich wie zeitlich im (unabgeschlossenen) Projekt der Entkolonisierung sowie der Herausbildung von nationalen und internationalen Ordnungen nach der Unabhängigkeit verortet, die innerhalb der zuvor kolonisierten Einheiten aufgetreten sind. Doch ist die „symbolische Markierung“, die dem Terminus „Globaler Süden“ anhaftet, weder auf diese Orte beschränkt noch gleichmäßig über diese verteilt (ebd.: 176). Hier greifen wir auf die Ansichten ausgewählter afrikanischer Führungspersönlichkeiten, Diplomat:innen und politischer Entscheidungsträger:innen zurück, um exemplarisch zu zeigen, worum es bei einer Sicht aus dem Globalen Süden auf den gegenwärtigen Krieg zwischen Russland und der Ukraine geht. Dabei beanspruchen wir nicht, eine repräsentative Übersicht über das politische Denken zu geben, das innerhalb der geographischen Region aufgetreten ist, die oft mit dem Terminus „Globaler Süden“ verbunden wird, soweit sie im Gegensatz zum „Globalen Norden“ steht. Dennoch handelt es sich bei den folgenden Beispielen nicht nur um provinzielle oder volkstümliche Wiederholungen des Widerstands gegen Unterdrückung. Vielmehr umfassen die universellen Zielsetzungen der Nicht-Aggression, Gleichheit und Gegenseitigkeit, wie sie in den hier untersuchten afrikanischen Vorschlägen und Positionen zur auswärtigen Politik hochgehalten werden, ein alternatives und damit paralleles internationales Projekt des Multilateralismus im Gegensatz zur Expansion der NATO. In der Überzeugung, dass Sensibilität gegenüber diesem Erbe des Globalen Südens als spezifischem intellektuellem und politischem Projekt unerlässlich ist, wollen wir ganzheitlich erfassen, was in dem gegenwärtigen Konflikt sowie den unterschiedlichen internationalen Reaktionen darauf auf dem Spiel steht.
Eine Krise öffnet ein Opportunitätsfenster
Es besteht nahezu allgemein Einigkeit, dass die Aggression Russlands gegen die Ukraine die Chance eröffnet, die Grundlagen der internationalen Beziehungen zu überprüfen. Es wäre nicht das erste Mal, das eine Krise zum Anstoß wird, das internationale System neu zu überdenken. Die gegenwärtige Ordnung ist selbst das Ergebnis der letzten großen Krise, die den Planeten erfasst hatte: des Zweiten Weltkriegs. Die damaligen Protagonisten auf westlicher und sowjetischer Seite erreichten eine Reihe von Abkommen, die zu der Konfi guration der Weltpolitik führten, wie sie bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion und darüber hinaus Bestand hatte. Diese Abkommen sind zuweilen unter den Namen der Städte bekannt, wo sie abgeschlossen wurden – in alphabetischer Reihenfolge: Bretton Woods, Dumbarton Oaks, Genf, Jalta, Nürnberg, Potsdam, San Francisco usw. Diese Foren waren unterschiedlich weit, manche beschränkter, manche offener und genauer. Auf jeden Fall bestand unter den damaligen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft – unter Ausschluss der gewaltigen kolonialen Provinzen Europas – eine nahezu allgemeine Übereinstimmung über die anstehenden Probleme. Diese fanden Ausdruck in der Atlantik-Charta, der UN-Charta, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, den Nürnberger und Tokyoter Prozessen, den Genfer Konventionen usw.
Es besteht heute ebenfalls ein nahezu universeller Konsensus, dass Russland bei seinem Konflikt mit der Ukraine der Aggressor-Staat ist. Doch aus Sicht einiger der ehemaligen kolonialen Provinzen vor allem in Afrika haben Europa und die NATO sich nicht ausreichend und zum Zwecke universeller Beratungen mit der wirklichen Ursache des Krieges und dem Charakter der Probleme des globalen Regierens auseinandergesetzt, die dadurch aufgeworfen werden. Das atlantische Bündnis scheint scharfe Resolutionen gegen Russland und militärische Unterstützung der Ukraine an die Stelle offener und inklusiver Beratungen über die Mittel gesetzt zu haben, mit denen die internationale Politik gegenüber der Aggression, Kriegsführung und den dahin führenden Instrumenten sowie der entsprechenden Moral stabilisiert werden kann. Im Ergebnis hat sich die Debatte über eine mutmaßliche Störung der internationalen Ordnung und einen Bruch in der nationalen Moral in eine Debatte über Rechtschaffenheit verwandelt, in der Europa Russland gegenübergestellt werden muss, um ein exklusives europäisches Projekt und damit verbundene transatlantische Militärdoktrinen zu rechtfertigen.
Die Argumente sind nicht abwegig, aber irreführend. Seit dem zweiten Weltkrieg haben Europa und andere westliche Mächte kognitive, symbolische, kulturelle und materielle Ressourcen der Förderung des globalen Friedens gewidmet. Diese hatten den Anspruch, Ausdruck der normativen Ordnungen des Rechts, der Ethik und der Moral zu sein; Unterstützung von Demokratie und Menschenrechten; ferner Entwicklungshilfe und Investitionen in die Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen auf der ganzen Welt.
Dieser Eindruck wird durch Vieles bestärkt. In Vorwegnahme des Sieges der Alliierten versprachen F. D. Roosevelt und Winston Churchill lange vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges in der Atlantik-Charta (1941), dabei zu helfen, eine Welt selbstbestimmter Einheiten zu schaffen, die keine territorialen Erweiterungen gestattet. Im Nachgang zu dieser Erklärung spielten die USA und ihre Alliierten eine wesentliche Rolle beim Entwurf der Charta der Vereinten Nationen; der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte; und der Schaffung des Internationalen Gerichtshofs neben einer Reihe anderer UN-Institutionen, die internationale Verantwortung wahrnahmen wie die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (UNESCO). Wie im Fall der Atlantik-Charta warteten die USA nicht bis zum Ende des Krieges, um die neue Weltordnung vorwegzunehmen. So luden sie etwa 1944 vierundvierzig Staaten zu einem Treffen ein, das zur Schaffung der sogenannten Bretton-Woods-Institutionen führte: des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank). Diese Haltung fand ihren Höhepunkt 1948 im Marshall-Plan, einer massiven Investitionshilfe in die wirtschaftliche und politische Infrastruktur Europas. 1949 verkündete Präsident Truman dann sein Point-IV-Programm zur technischen Unterstützung von Entwicklungsländern. Dieses Programm eröffnete eine Ära der Entwicklungshilfe, die Nacheiferung bei fast allen europäischen und westlichen Mächten fand.
All dies verstärkte europäische und westliche Narrative über sich selbst und über Andere. Eines der wichtigsten Charakteristika der europäisch-westlichen Selbst-Erzählung ist das Gefühl des Außerordentlichen. Dieses Gefühl wird durch den Glauben gerechtfertigt, dass Europa kraft seiner Vernunft, Wissenschaft sowie moralischer und materieller Fortschrittlichkeit einzigartig dazu geeignet sei, anderen Führung, Gesetze und Normen vorzugeben. Dabei steht die Vernunft als Produkt kultureller und wissenschaftlicher Errungenschaften an erster Stelle. Darauf folgt, dass Europa durch die bittere eigene Geschichte von Kriegen gezwungen wurde, sich Regime der Ordnung und Normen zu verschreiben, die es zu friedlichem Verhalten zwingen und vorwärtstreiben.
* * *
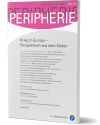 Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist im Open Access in Heft 169+170 (1-2023) unserer Zeitschrift PERIPHERIE – Politik • Ökonomie • Kultur erschienen.
Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist im Open Access in Heft 169+170 (1-2023) unserer Zeitschrift PERIPHERIE – Politik • Ökonomie • Kultur erschienen.
© Unsplash 2023, Foto: Artem Beliaikin