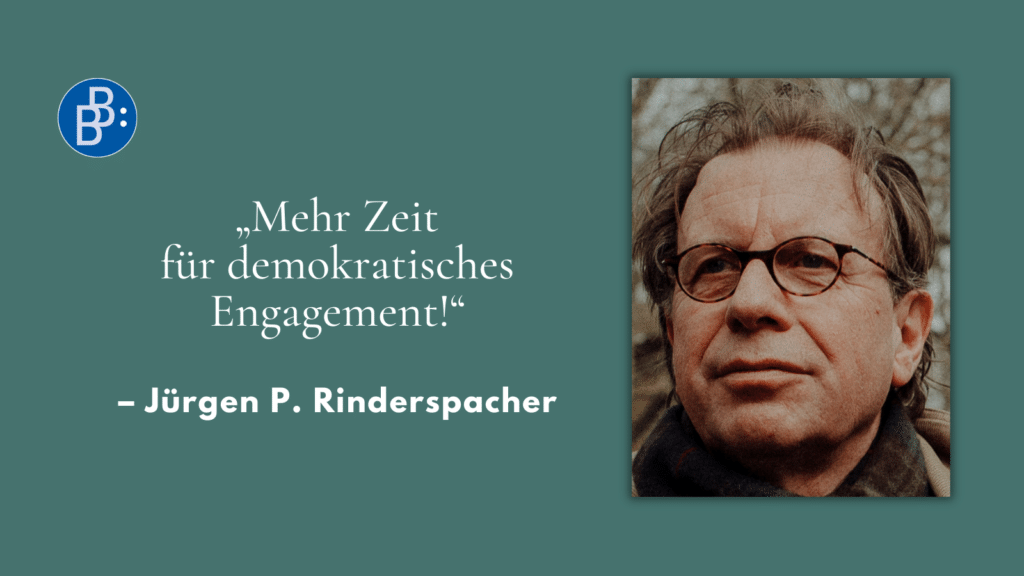Die Demokratie ist eine durch und durch zeitliche Veranstaltung, sagt Jürgen P. Rinderspacher, Autor des Buchs Politik im Zeitnotstand. Katastrophen, Krisen, Kriege, Transformationsprozesse. Was damit gemeint ist und warum er Demokratie als Zeit-Projekt versteht, darum geht es im heutigen Gastbeitrag.
„Zum Glück haben wir die Wahl!“ – Was ist das?
„Zum Glück haben wir die Wahl!“ – unter diesem Motto teilen unsere Autor*innen ihre Perspektiven auf die Bundestagswahl 2025. Demokratie ist eine der größten Errungenschaften unserer Gesellschaft, doch sie ist keine Selbstverständlichkeit. Sie lebt davon, dass wir sie aktiv gestalten, schützen und immer wieder aufs Neue mit Leben füllen.
Mit dieser Beitragsreihe möchten wir die Vielfalt der Stimmen sichtbar machen und gemeinsam ein Zeichen setzen: für die Freiheit, die Demokratie uns gibt, und für die Verantwortung, die sie mit sich bringt.
***
1. Macht auf Zeit
Die Demokratie ist eine durch und durch zeitliche Veranstaltung. Zurückgehend auf ihre antiken und vor allem auf ihre aufklärerischen Wurzeln, versteht sie sich als eine Staatsform, deren Grundidee die Verleihung der politischen Macht auf eine begrenzte Zeit ist. Schon im Begriff der Verleihung liegt ja eine zeitliche Limitierung, insofern man Verliehenes irgendwann und in möglichst gutem Zustand wieder an den Eigentümer zurückzugeben hat. Der Eigentümer der politischen Macht ist in der Demokratie – „Herrschaft des Volkes“ – der Souverän und dieser wiederum ist, wenn auch in institutionell geregelter Pufferung unter anderem durch das Prinzip der Repräsentativität, das Volk respektive des Volkes Wille.
Dagegen kennt eine von Gott verliehene höchste staatliche Autorität, wie im Absolutismus, gegen den sich die moderne Demokratie als Antithese herausgebildet hat, keine zeitliche Begrenzung der Herrschaft, schon gar nicht eine, deren Ablauf durch eine irdische Rechtfertigungsordnung fundiert wäre (Forst 2015). Auf diese Weise wird der Kalender zu einer systemisch unverzichtbaren Autorität der Demokratie, indem das schlichte Vergehen von Zeit die Herrschenden innerhalb regelmäßiger Perioden dazu auffordert, ihre Herrschaft niederzulegen und Rechenschaft über vergangenes politisches Handeln gegenüber dem Souverän abzulegen, um anschließend ein neues Spiel zu beginnen.
Der als regelmäßige Sollbruchstelle konzipierte Machtwechsel, den Beginn und Ende einer Wahlperiode vorgeben, setzt die Demokratie damit jedoch auch unter den Zeitdruck regelmäßiger Erfolgsbilanzierung. Diese erweist sich immer auch als kritisch, weil damit die Frage nach den mehr oder weniger großen inhaltlichen politischen Erfolgen der jeweiligen Regierungskonstellation auf dem Tisch liegt und darüber hinausgehend immer auch die Grundsatzfrage nach der funktionellen Effizienz der Staatsform Demokratie.
2. Viel zu langsam? Zeitliche Defizite gefährden die Demokratie
Die Leistungsfähigkeit demokratischer Strukturen resultiert wesentlich auch aus der zeitlichen Effizienz politischen Handelns. Aktuell werden in der öffentlichen Debatte vor allem zwei zeitliche Defizite parlamentarischer Demokratien beklagt:
Zum einen erscheinen ihre Reaktionsfähigkeit sowie ihr proaktives Regieren von Krisen, Kriegen und Transformationsprozessen sehr häufig als defizitär und in diesem Sinne nicht zeit-gemäß (Rinderspacher 2024; Merkel/Schäfer 2015). Dazu tragen wesentlich zum einen die Logik der demokratischen Institutionen bei, die aufgrund interner Abstimmungs- und Kompromissfindungsprozesse zumeist sehr zeitaufwändig agieren müssen (u.a. durch mehrstufige Beteiligungsverfahren und Einspruchsrechte). Doch auch wenn der Kompromiss zeitaufwändig ist, ist er ein wesentlicher Bestandteil jeder demokratischen Ordnung und somit eine generelle zivilisatorische Errungenschaft (Zanetti 2022).
Weitere zeitliche Defizite freiheitlicher Demokratien, welche in der Regel auf das Wirtschaftssystem des Kapitalismus aufsetzen, sind in kritischen Situationen deutlich geworden. So scheint es selbst unter den Bedingungen des russischen Angriffskriegs unter anderem auf Grund der zurückhaltenden Investitionsbereitschaft der Rüstungsindustrie kaum möglich, zeitnah dringend benötigte Wehrtechnik, vom Kampfpanzer bis zur Artilleriemunition, zu liefern. Ähnliches gilt auch für Infrastrukturinvestitionen und weitreichende Umstrukturierungen in anderen Sektoren.
Zum anderem wird unter Effizienzgesichtspunkten die föderale Struktur, wie sie im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland mit Ewigkeitsgarantie festgeschrieben ist, als zu langsam gegenüber dem Erfordernis einer zeitnahen Bewältigung bundesweiter Probleme kritisiert. Schon im Normalbetrieb hinken die Abstimmungsprozesse etwa bei Bildung, innerer Sicherheit oder in der Migrationspolitik nach fast einhelliger öffentlicher Meinung den Erfordernissen oft weit hinterher.
Hinzu kommen Koordinationserfordernisse mit der kommunalen Ebene, in der die Bürger*innen den Staat am häufigsten und für sie intensivsten wahrnehmen. Die Kommunen werden jedoch von Bund und Ländern häufig ungefragt mit Aufgaben überhäuft, die sie sich selbst nicht gestellt oder verursacht haben. Dabei ist umstritten, ob es ich um systemische Defizite der Demokratie handelt oder nicht doch eher um schlechtes Regierungshandeln (hierzu Merkel/Schäfer 2015).
3. Staatliche Weitsicht bei kurzen Legislaturberioden – Quadratur des Kreises?
Neben den Geschwindigkeits- und Synchronisierungsproblemen scheinen liberale Demokratien auch zu kurzsichtig und nicht vorausschauend genug zu handeln, um Zukunftsprobleme wirklich lösen zu können. Statt Prävention, die auf fast allen Politikfeldern, von der Bildungs- Gesundheits- und Rentenpolitik über die Verteidigungspolitik bis hin zum sozialökologischen Umbau der Gesellschaft, eine entscheidende Rolle spielen sollte, ist trotz besserer sachlicher Einsicht nach wie vor reaktives Handeln vorherrschend.
Die derzeit viel beklagten fehlenden öffentlichen Investitionen vorangegangener Legislaturperioden haben unter anderem einen zeitökonomischen Hintergrund: Tatsächlich ist es in der schmuddeligen Wirklichkeit der Realpolitik dem Wahlvolk kaum klar zu machen, dass gerade auch im öffentlichen Sektor knappe finanzielle Mittel heute aufgewendet werden müssen, um morgen besser Leben zu können – ungeachtet dessen, dass solche Weitsicht im Bereich privater Investitionen Gang und Gäbe ist.
Noch kritischer wird die Verwendung knapper Ressourcen etwa für den Katastrophenschutz und die Abwehr der Folgen des Klimawandels beurteilt, denn dabei handelt es sich um Ereignisse, die nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, aber nie sicher passieren werden. Tritt dann eine große Flutkatastrophe, eine Pandemie oder gar eine hieraus resultierende politische Radikalisierung eines Teils der Bevölkerung ein, lautet die Kritik an die politisch Verantwortlichen, sie hätten vor-sorgen müssen, etwa durch höhere Dämme oder durch Impfkampagnen. Treten solche Ereignisse dagegen nicht ein, argumentieren oppositionelle Kräfte, solche Maßnahmen seien Verschwendung anderweitig besser zu verwendender Ressourcen gewesen („Präventionsparadox“).
So führt die Sollbruchstelle der Wahlperiode dazu, dass kurzfristige Strategien der Mittelverwendung, deren Erfolge dem Wahlvolk plastisch vorgeführt werden können, den weiteren Kurs der Gesellschaft stärker bestimmen als weitsichtiges politisches Agieren. Inwiefern eine Verlängerung der Legislaturperioden solchen systemischen Restriktionen politischen Handelns entgegenwirken könnte, müsste weiter diskutiert werden ebenso wie andere institutionelle Veränderungen, die langfristiges Denken und Handeln der Regierungen und Parteien unterstützen.
4. Demokratiedämmerung?
Angesichts solcher und anderer zeitlicher Constraints westlicher Demokratien könnten Zweifel aufkommen, ob es von den Urvätern der Demokratie tatsächlich eine gute Idee war, eine bestehende Regierung auch – oder gerade – wenn sie erfolgreich operiert, mit einem Wahlvorgang nach Maßgabe bloßer zeitlicher Kriterien in regelmäßigen Perioden der totalen Disposition auszusetzen. Und auch an einer weiteren, noch viel grundlegenderen Zeit-Problematik kommt selbst die Demokratie nicht vorbei: Muss die Grundidee der Demokratie, beginnend mit ihrer Ausformulierung im Zuge der Aufklärung, tatsächlich als eine über-zeitliche Angelegenheit behandelt werden, die Ewigkeitswert besitzt – oder muss diese sich nicht auch selbst, wie (fast) Dinge dieser Welt, als dem Wandel der Epochen unterworfen verstehen (Payk 2024)?
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die die Idee der modernen Demokratie einschließlich ihrer zentralen Elemente wie etwa der Gewaltenteilung immerhin mehrere Jahrhunderte zurückreicht. Die lange Dauer könnte auf der einen Seite dafür sprechen, dass die liberale Demokratie anders als bisherige Staatsformen fast schon Ewigkeitswert besitzt; andererseits könnte diese Tatsache in Richtung der Aktualisierungsbedürftigkeit einer inzwischen leicht ergrauten Institution weisen.
Ob man heute, angesichts der zahlreichen Angriffe von verschiedenen Seiten, bereits von „Demokratiedämmerung“ sprechen sollte, sei dahingestellt. Selk (2024) glaubt nicht nur eine lebensbedrohliche Krise der real existierenden westlich-liberalen Demokratien beobachtet zu haben, sondern darüber hinaus eine Insuffizienz der die Demokratie begleitenden Demokratie-Theorien.
Letzteres scheint mir so plausibel wie Ersteres, auch deshalb, weil nur wenige Theoretiker*innen sich der historischen Relativität der liberal-demokratischen Ordnung bewusst zu sein und dementsprechend in ihrer Fantasie gehemmt scheinen, sich auf Basis einer ehrlichen Defizitanalyse deren – demokratische – Fortschreibung vorstellen zu können. Allein die Digitalisierung unserer Lebenswelt könnte dazu ein Anlass sein (vgl. hierzu Zeitpolitisches Magazin ZPM 2013). Freilich sind solche Wege nicht ohne Risiko; doch ohne selbstreflexive kritische Begleitung, die ja Teil jedes Demokratiekonzepts sein müsste, besteht auch für demokratische Ordnungen die Gefahr, lediglich eine geschichtliche Episode gewesen zu sein.
Wenn die bestehenden Demokratien nicht plausibel machen, dass sie ihre systemische Effizienz so weit steigern können, dass sie in der Lage sind, neue, darunter auch zeitliche Herausforderungen, zu bewältigen, scheint deren Existenz tatsächlich gefährdet. Ebenso wie übrigens auch alte Herausforderungen weiterhin mit gleicher Dringlichkeit auf der Agenda stehen – hier vor allem die dauerhafte Herstellung von äußerer und innerer Sicherheit, sozialer Gerechtigkeit und, generell, von Freiheit, Gleichheit und Anerkennung (Honneth 2018).
5. Verändern und Bewahren
In einem sehr tiefen Verständnis ist der Imperativ der permanenten Veränderung der Demokratie ebenso eingeschrieben, wie umgekehrt die Unverhandelbarkeit bestimmter Basiselemente im Verlauf ihrer Geschichte, allen voran die Menschenrechte. Wenn man die Demokratie als eine unvollendete Staatsform versteht, die – in moderner Diktion – eine permanente Baustelle ist (Hacke 2024), dann weist diese per se immer schon systemisch in die Zukunft.
Die Kunst besteht dann darin, mit Blick auf die Vergangenheit und deren Legitimationskraft für politisches Handeln (besonders hervorstechend hier etwa die so genannte Staatsräson (Stolleis 1990) in Bezug auf den Staat Israel oder die Dankbarkeit gegenüber den Westalliierten des Zweiten Weltkriegs, durch die Befreiung vom Faschismus die Demokratie in Deutschland erst ermöglicht zu haben) die rechte Balance zwischen Tradition und der Notwendigkeit zu finden, um sich veränderten Umweltbedingungen des politischen Systems adäquat stellen zu können. Dabei muss sowohl die Aufgabe bisheriger Positionen, etwa im Kontext einer kritisch-hermeneutischen Überprüfung geltender Standards, zum Beispiel in der Migrationspolitik, ebenso möglich sein wie auch im Sinne von Willy Brandts „Mehr Demokratie wagen“ weitere institutionelle Schritte in Richtung einer weiteren Öffnung politischer Teilhabe bislang marginalisierter Bevölkerungsgruppen.
Dabei müssen auch grundsätzliche kritische Betrachtungen der freiheitlichen Demokratie und ihrer ausgesprochenen und unausgesprochenen Prämissen zumindest denkmöglich sein. So etwa, wenn die radikale Zukunftsorientierheit moderner Gesellschaften, die sich im Anschluss an den im 19. und 20. Jahrhundert weit verbreiteten, uns heute großenteils als naiv erscheinenden Fortschrittsoptimismus herausgebildet hat, aus queer-feministischer Sicht einer radikalen Kritik unterzogen wird.
Isabell Lorey (2020) behauptet, dass dieser in seiner radikal linearen und demgemäß nicht zyklischen Struktur des Denkens grundständig dem Männlichen korrespondiert und daher viele der Institutionen eines hierauf aufsetzenden Demokratieverständnisses des 18., 19. und 20. Jahrhunderts heutzutage nicht länger haltbar seien. Sie plädiert daher für eine „Demokratie im Präsens“. Damit gemeint ist eine queer-feministische, eurozentrismuskritische Perspektivierung des Politischen, die bei der Gegenwart des Alltags der Menschen ansetzt und die jedenfalls dem eigenen Anspruch nach zu einem radikalen Neudenken von Demokratie führen soll: Demokratie, die auf die Sorge und Verbundenheit und auf die Unhintergehbarkeit von Verantwortlichkeiten im Nahbereich gegründet ist.
Nicht umsonst hat Jacques Derrida von einer erst noch kommenden Demokratie gesprochen.
„Kommende Demokratie ist ein Denken des Ereignisses, des Kommenden also, das ist der offene Raum, damit es das Ereignis, die Zukunft, gibt und damit die Ankunft die des Anderen ist. Undemokratische Systeme sind in erster Linie Systeme, die sich verschließen, sich dieser Ankunft des Anderen verschließen.“ (nach Englert 2014)
6. Gleichheit und Gerechtigkeit zwischen den Generationen
Zu den kritischen Zeitlichkeiten nicht nur der Demokratie gehört auch das Verhältnis der Generationen zueinander. In jeder Staatsform resp. Gesellschaft existieren unterschiedliche Altersgruppen, die biologisch bedingt unterschiedliche Zeitperspektiven aufweisen, die in demokratischen Verfahren zum Ausgleich gebracht werden müssen. In der spätmodernen Demokratie sollen diese Altersgruppen mit gleichen Rechten ausgestattet sein, also nicht etwa die Alten ungefragt über die Jungen verfügen dürfen, wie teilweise noch im letzten Jahrhundert, wie aber auch nicht umgekehrt.
Die Demokratie erweist sich an dieser Stelle als problematisch, weil mit der Umkehrung der klassischen Bevölkerungspyramide die höheren Altersgruppen die jüngeren mit zunehmender Tendenz überstimmen können, was tatsächlich die Gefahr einer „Seniorokratie“ in sich birgt. In fast allen Politikarenen wird das Generationenthema derzeit mehr oder weniger explizit ausgefochten, in der Renten- Sozial- und Gesundheitspolitik ebenso wie in der Finanzpolitik, und immer drängender, vor allem in der Klimapolitik. So hat unter anderem das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundesklimaschutzgesetz von 2021, vereinfachend gesagt, geurteilt, dass die heute lebenden Generationen nur noch so viel an CO2-Ausstoß verursachen dürfen, dass künftigen Generationen einschließlich den bereits heute lebenden jüngeren Menschen in Zukunft noch genügend Freiheitsspielräume gelassen werden, ihre Lebensweise selbst zu bestimmen; diese Freiheit dürfe nicht durch eine übermäßige Erderwärmung unzulässig beschnitten werden (vgl. bei Rinderspacher 2024, S. 95 ff.).
Auf andere Weise relevant wird das Verhältnis der Generationen in demokratischen Gesellschaften neuerdings aber auch bei dem durch den Ukraine-Krieg aktivierten Thema der Landesverteidigung, wenn nämlich die Jüngeren die Älteren bzw. das demokratische Staatswesen insgesamt vor militärischen Anfeindungen schützen müssen. Ebenfalls lastet die Aufgabe der physio-psychischen Regeneration der Bevölkerung auf den Jungen, wie nicht zuletzt auch die Finanzierung der Altersrenten vor dem Hintergrund eines immer häufiger in Frage gestellten Konstrukts eines Generationenvertrages.
Freilich muss auch eine Gesellschaft, die nicht demokratisch organisiert ist, mit solchen Herausforderungen umgehen. Das Grundproblem der Landesverteidigung ebenso wie der Versorgung der Alten ist also nicht neu. Jedoch stellt sich der Anspruch an die Gleichheit aller Bürger*innen in demokratischen Gesellschaften (Rosanvallon 2017) anders dar, weil die biologische Evidenz im ersten Fall die Älteren, die nicht (mehr) in den Krieg ziehen müssen, bevorzugt, ebenso im zweiten Fall, indem die Alten aus ihrer reduzierten Leistungsfähigkeit zurecht ein Anrecht auf materielle Unterstützung durch die Jungen herleiten. Funktionierende Demokratien, die immer auch sozialstaatliche Demokratien sein sollten, haben dann die Aufgabe, da alle ihre Bürger*innen im Verlauf ihrer Biografie in der Regel sowohl jung als auch alt sein werden, mittels langfristiger, verlässlicher politischer Regulierung einen fairen Ausgleich der Lasten zwischen den Kohorten herzustellen und in diesem Sinne soziale und politische Gleichheit zu implementieren.
7. Mehr Zeit für demokratisches Engagement – überall!
Eine der zentralen Aufgaben der Fortentwicklung der Demokratie scheint mir nach wie vor, diese nicht nur im engeren Verständnis als eine politische Staatsform zu verstehen, sondern die Demokratisierung der Gesellschaft in allen ihren Facetten und Kapillaren voranzutreiben – in Wirtschaft und Schule ebenso wie in Familie und Bundeswehr. Diese Aufgabe ist alles andere als neu (Vilmar 1973), doch sie scheint nach wie vor die unabdingbare Voraussetzung für eine wahrhaft funktionierende freiheitlich-demokratische Gesellschaft zu sein wie gleichzeitig auch ein wesentlicher Teil ihrer Verwirklichung.
Dazu gehört nicht zuletzt ein Zeitregime, das den Menschen in ihrem Alltag zwischen Erwerbsarbeit, Familie und Freizeit genügend Raum gibt, sich in der politischen Arbeit und im Ehrenamt zu engagieren, ebenso wie in der praktischen Sorgearbeit im näheren Lebensumfeld. Die Bedingungen hierfür haben sich trotz Arbeitszeitverkürzung und -Flexibilisierung sowie vieler Liberalisierungsmaßnahmen im Alltag der Menschen in den vergangenen Dekaden paradoxerweise eher verschlechtert (Rinderspacher 2001). Mehr Zeit für demokratisches Engagement – an dieser Nahtstelle zwischen der Alltagswirklichkeit der Menschen und dem Ideal der Teilhabe möglichst Vieler an einer lebendigen Demokratie zu arbeiten, dürfte neben anderen Baustellen zu den wichtigen Aufgaben künftiger Demokratie-Politik gehören.
Literatur
Englert, Klaus (2014): Jaques Derrida. Kreatives Denken jenseits der klassischen Philosophie. Deutschlandfunk Archiv https://www.Deutschlandfunk.de/jacques-derrida-kreatives-denken-jenseits-der-klassischen-100.html (Zugriff 05.01.2025).
Forst, Rainer (2015): Normativität und Macht: Zur Analyse sozialer Rechtfertigungsordnungen. Berlin: Suhrkamp.
Hacke, Jens (2024): Wehrhafte Demokratie. Vom Wesen und Wert eines schillernden Konzepts. In: In guter Verfassung? Aus Politik und Zeitgeschichte (ApuZ) Nr. 9-11/2024, S. 28-31.
Honneth, Axel (2018): Kampf um Anerkennung. Eine europäische Ideengeschichte. Berlin: Suhrkamp.
Lorey, Isabell (2020): Demokratie im Präsens. Eine Theorie der politischen Gegenwart. Berlin: Suhrkamp.
Merkel, Wolfgang; Schäfer, Andreas (2015): Zeit und Demokratie: ist demokratische Politik zu langsam? In: Strasheim, Holger; Ulbricht, Tom (Hrsg.), Zeit der Politik. Demokratisches Regieren in einer beschleunigten Welt. Leviathan Sonderband Nr. 30/2025, S. 218-238.
Payk, Marcus (2024): Verfassung in der Zeit. Zur Temporalität des Grundgesetzes. In: Merkur 78, H. 900 (2024), S. 33-46).
Rinderspacher, Jürgen P. (2001): Zeit für Demokratie. In: Mückenberger, Ulrich (Hrsg.), Bessere Zeiten für die Stadt. Chancen kommunaler Zeitpolitik. Hamburg: VSA, S. 107-133.
Rinderspacher, Jürgen P. (2024): Politik im Zeitnotstand. Katastrophen, Krisen, Kriege, Transformationsprozesse. Opladen et al.: Verl. Barbara Budrich.
Rosanvallon, Pierre (2017): Die Gesellschaft der Gleichen. Berlin: Suhrkamp.
Selk, Veith (2024): Demokratiedämmerung. Eine Kritik der Demokratietheorie. Berlin: Suhrkamp.
Stolleis, Michael (1990): Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Vilmar, Fritz (1973): Strategien der Demokratisierung. Band I Theorie der Praxis. Neuwied: Luchterhand.
Zanetti, Veronique (2022): Spielarten des Kompromisses. Berlin: Suhrkamp.
Zeitpolitisches Magazin ZPM (2013): Demokratie braucht Zeit. ZPM Nr.22/2013 https: //zeitpolitik.org/Zeitpolitikmagazin (Zugriff 11.01.2025).
***
Jetzt „Politik im Zeitnotstand“ von Jürgen P. Rinderspacher versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
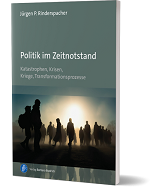 Jürgen P. Rinderspacher:
Jürgen P. Rinderspacher:
Politik im Zeitnotstand. Katastrophen, Krisen, Kriege, Transformationsprozesse
Der Autor
 Dr. Jürgen P. Rinderspacher, Institut für Ethik und angrenzende Sozialwissenschaften (IfES) der Universität Münster
Dr. Jürgen P. Rinderspacher, Institut für Ethik und angrenzende Sozialwissenschaften (IfES) der Universität Münster
Über das Buch
Zeitdruck ist zur zentralen Herausforderung für politisches Handeln geworden. Katastrophen, Krisen, Kriege und der große Transformationsprozess hin zur Klimaneutralität überlagern sich und gewähren wenig Spielraum für Kommunikation und demokratische Prozesse. Freiheit, Wohlstand und nicht zuletzt das Recht auf eigene Zeit scheinen durch die Gegenmaßnahmen der politisch Verantwortlichen immer öfter in Frage gestellt. Wenn allerdings nicht rechtzeitig gehandelt wird, sind diese Güter ebenfalls bedroht. Gibt es Wege, die aus diesem Rechtzeitigkeits-Dilemma herausführen?
Mehr Gastbeiträge aus der Reihe …
… sind auf unserem Blog versammelt.
© Foto Jürgen P. Rinderspacher: privat | Titelbild: gestaltet mit canva.com