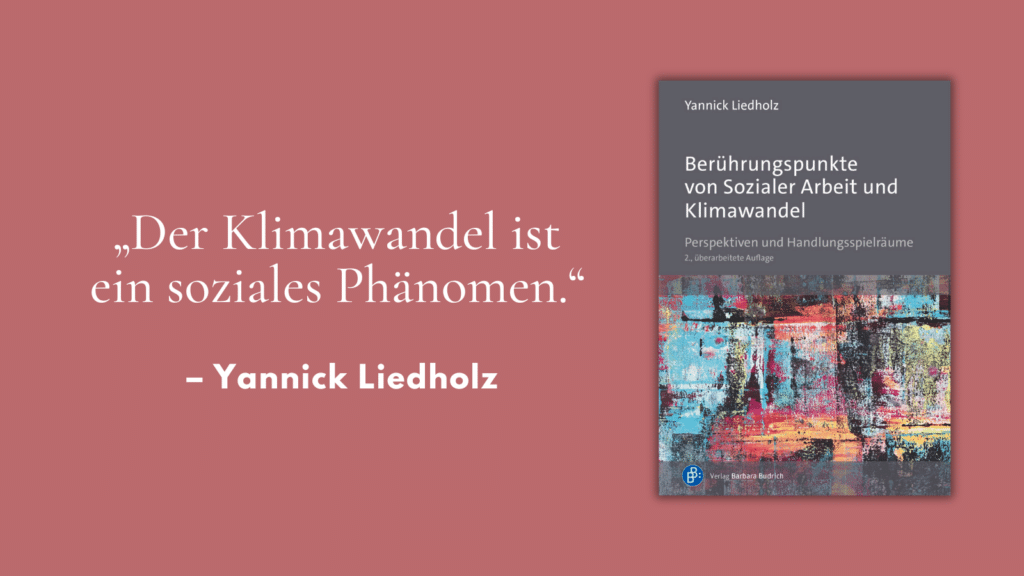Die erste umfassende Bestandsaufnahme zur Sozialen Arbeit und dem Klimawandel im deutschsprachigen Raum: Leseprobe aus Berührungspunkte von Sozialer Arbeit und Klimawandel. Perspektiven und Handlungsspielräume (2., überarbeitete Auflage) von Yannick Liedholz.
***
Berührungspunkte von Sozialer Arbeit und Klimawandel: 1 Einleitung
Der Klimawandel ist in all seinen Facetten ein soziales Phänomen und stellt grundlegend infrage, wie die Menschen – insbesondere im Globalen Norden1 – derzeit auf der Erde leben. Die soziale Tragweite des Klimawandels hat Welzer (2007) treffend in Worte gefasst. Anlässlich des Jahres der Geisteswissenschaften schrieb er in der Zeitung DIE ZEIT:
Was wir gegenwärtig als ,Klimawandel‘ bezeichnen, wird die größte soziale Herausforderung der Moderne sein (ebd.: o.S.).
Zahlreiche Veröffentlichungen vor allem aus der sozialwissenschaftlichen Klimaforschung stützen und bereichern diese These.
In der Sozialen Arbeit fristete der Klimawandel lange ein Schattendasein. International setzte nach der Jahrtausendwende ein allmählicher Bezug zum Klimawandel ein (z.B. McKinnon 2008; Coates/Gray 2012; Dominelli 2012; Boetto/McKinnon 2013; Drolet 2015). Im deutschsprachigen Raum intensivierte sich die Auseinandersetzung erst zu Beginn der 2020er-Jahre. Auf sozialarbeitswissenschaftlicher Ebene entstanden einführende Werke zum Klimawandel und zu Nachhaltigkeit (Liedholz 2021a; Schmidt 2021; Stamm 2021; Pfaff et al. 2022; Liedholz/Verch 2023a; Or 2023a). Fachzeitschriften der Sozialen Arbeit gaben Schwerpunkthefte heraus. In der DGSA gründete sich die Fachgruppe ,Klimagerechtigkeit und sozialökologische Transformation in der Sozialen Arbeit‘. Zudem wurden zahlreiche Fachtage gestaltet.
Parallel dazu schrieben sich die Praxisstrukturen der Sozialen Arbeit den Klimawandel auf die Fahnen. Auf der Ebene der Wohlfahrtsverbände verkündete der Deutsche Caritasverband das Ziel, „bis 2030 klimaneutral“ (Deutscher Caritasverband o.J.: 92) werden zu wollen. Die Diakonie Deutschland verabschiedete „Nachhaltigkeitsleitlinien“ und bekannte sich damit zu „den 17 Nachhaltigkeitsziele[n] der Vereinten Nationen“ und dem Vorhaben, „bis spätestens 2035 selbst klimaneutral zu sein“ (Diakonie Deutschland 2021: 1). Der Paritätische Wohlfahrtsverband initiierte das Projekt „Klimaschutz in der Sozialen Arbeit stärken!“ (Yeung 2023: 17). Sozialarbeiter_innen2 brachten den Klimawandel vielerorts in ihren Berufsalltag ein.
Gleichzeitig sah sich die Soziale Arbeit mit den auch in Deutschland spürbarer werdenden Klimawandelfolgen konfrontiert. Angesichts häufigerer Hitzewellen thematisierte die Diakonie Hessen (2022) die gesundheitlichen Gefahren für obdachlose Menschen. Die mit dem Klimawandel assoziierte Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 in Westdeutschland (Schleussner et al. 2021) traf die Soziale Arbeit unmittelbar. „[I]n dem rheinlandpfälzischen Ort Sinzig“ starben durch die Überschwemmungen „zwölf Bewohner:innen einer stationären Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen“ (Liedholz 2021b: 358). „Zwölf Menschen, die der Sozialen Arbeit anvertraut waren, die sich in ihrer Obhut befanden“, ertranken „in ihren Zimmern“ (ebd.). Für die Soziale Arbeit wurde offensichtlich, dass sie bereits mitten im Klimawandel stattfindet.
Die erste Auflage dieses Buches fiel zeitlich mit den skizzierten sozialarbeiterischen Annäherungen an den Klimawandel im deutschsprachigen Raum zusammen. Damals war die Idee, eine ,erste Bestandsaufnahme‘ zu liefern. Mit dieser zweiten Auflage soll eine aktualisierte Bestandsaufnahme angeboten werden. Dabei bleibt die Struktur des Buches gleich: Auf eine Einführung in die Soziale Arbeit und in den Klimawandel folgt eine Betrachtung der potenziellen Verbindungslinien zwischen den beiden Themenfeldern. Anschließend werden mögliche Handlungsspielräume der Sozialen Arbeit zum Klimawandel aufgezeigt. In dieses Grundgerüst wird der neu entstandene Klima- und Nachhaltigkeitsdiskurs der Sozialen Arbeit integriert. Die Darstellung der Berührungspunkte von Sozialer Arbeit und Klimawandel erfährt dadurch eine inhaltliche Erweiterung. Anhand der Klimaprojekte lassen sich hoffentlich die Praxisrelevanz und die Handlungsmöglichkeiten für die Soziale Arbeit besser veranschaulichen. Der Blick richtet sich verstärkt auf den deutschsprachigen Raum, um den Entwicklungen gerecht zu werden. Internationale Fragen finden aber weiter eine Beachtung. Denn der Klimawandel ist eine globale Problematik und erfordert eine international denkende Soziale Arbeit.
Konkret schlagen sich diese Vorhaben in den folgenden Kapiteln nieder: Kapitel 2 gibt zunächst Einblicke in das (historische) Selbstverständnis, die Arbeitsweisen sowie einzelne Arbeits- und Forschungsfelder der Sozialen Arbeit und stellt erste Bezüge zum Klimawandel her. Kapitel 3 bietet dann eine Einführung in die Grundlagen des Klimawandels. Welche Veränderungen im Klimasystem wurden bereits beobachtet? Wie lauten die Klimaziele? Und wie könnte sich der Klimawandel im 21. Jahrhundert entwickeln? Es folgt der erste Hauptteil. Kapitel 4 zeigt anhand von neun Themenbereichen auf, wo und wie sich die Soziale Arbeit und der Klimawandel berühren. Behandelt werden Themen wie Postkolonialismus, Rassismus, Flucht und Migration, Menschenrechtsverletzungen sowie Geschlechter- und Generationenfragen. Kapitel 5 stellt den zweiten Hauptteil dar. Dieser fokussiert mögliche gesellschaftspolitische und pädagogische Handlungsspielräume der Sozialen Arbeit. Die Umsetzung von Klimagerechtigkeit und die Ausgestaltung einer Postwachstumsökonomie werden ebenso erörtert wie die Potenziale einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) und einer ökologisch orientierten Erlebnispädagogik. Gebündelt dargestellt wird dies in einem Übersichtsmodell zu den Handlungsspielräumen von Sozialarbeiter_innen zum Klimawandel in der Berufspraxis. Kapitel 6 wagt einen Ausblick und eröffnet eine Zukunftsperspektive für die Soziale Arbeit und den SAGE-Bereich in Zeiten des Klimawandels. Die Soziale Arbeit ist ein heterogenes Berufsfeld. Wer hierzulande Soziale Arbeit an einer Hochschule, Universität oder Berufsakademie studiert, der_die kommt mit einer Vielzahl an Theorie- und Praxisbezügen in Berührung. Neben der Geschichte und den Handlungs- und Forschungsmethoden Sozialer Arbeit stehen unter anderem Ethik, Gender- und Queer-Studies, Psychologie, Sozialpolitik, Soziologie und Recht auf dem Studienplan (z.B. ASH Berlin 2022). Mit dem Studienabschluss öffnen sich für die Absolvent_innen dutzende Türen. Im gesamten sozialen Bereich können sie tätig werden. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Soziale Arbeit zu einem der größten sozialen Berufsstände gemausert und sie zeigt eine anhaltend wachsende Tendenz:
Waren 2008 noch etwa 235.000 Menschen in Deutschland erwerbstätig, die über einen (Fach-)Hochschulabschluss in der Sozialen Arbeit verfügten, stieg diese Zahl bis zum Jahr 2017 auf rund 316.000 Personen (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2019: 97).
Im Folgenden werden Einblicke in die Soziale Arbeit vorgenommen. Damit dieses Vorhaben nicht ausufert, beschränken sich die Ausführungen auf ausgewählte Entwicklungen und theoretische Ansätze der Sozialen Arbeit in Deutschland, die im Kontext des Klimawandels gewinnbringend erscheinen. Dabei wird bereits ein mögliches Selbstverständnis der Sozialen Arbeit hinsichtlich des Klimawandels angedeutet.
___
1 In Anlehnung an Postkoloniale Theorien in der Sozialen Arbeit werden in der vorliegenden Arbeit die Begriffe ,Globaler Norden‘ und ,Globaler Süden‘ anstelle von ,Industrie-‘, ,Schwellen-‘ und ,Entwicklungsländer‘ verwendet. Dabei ist die „Einteilung Süden und Norden […] nicht geographisch gemeint, sondern bezeichnet die geopolitische Verortung in einem ungleichen Weltsystem“ (Heuwieser 2015: 13).
2 Im Sinne einer geschlechtersensiblen Sozialen Arbeit werden alle Personenbezeichnungen und ihre jeweiligen Possessivpronomen mit einem Gender-Gap gegendert.
***
Sie möchten gern weiterlesen?
Jetzt versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
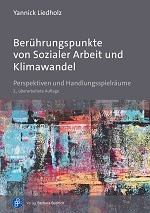 Yannick Liedholz:
Yannick Liedholz:
Berührungspunkte von Sozialer Arbeit und Klimawandel. Perspektiven und Handlungsspielräume
2., überarbeitete Auflage