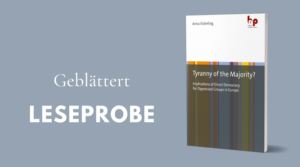Leseprobe zum Thema Lotte Hahm aus unserer Zeitschrift GENDER – Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, Heft 1-2021.
***
Offensiv – strategisch – (frauen)emanzipiert: Spuren der Berliner Subkulturaktivistin* Lotte Hahm (1890–1967)
Ingeborg Boxhammer, Christiane Leidinger
GENDER – Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, Heft 1-2021, S. 91-108
Zusammenfassung
Der Beitrag präsentiert kritisch-hermeneutische Rekonstruktionsergebnisse vor allem zu Handlungsmöglichkeiten und -strategien einer bekannten Berliner Subkulturaktivistin*: Lotte Hahm verknüpfte ihre ökonomische Selbstständigkeit mit kollektiver Selbstorganisierung (offene Klubstrukturen), gastronomischen Einrichtungen (Barbetrieb, Tanz, Kulturprogramm) mit dem Angebot von Beratung und politischer Bildung (Artikel, Vorträge, Bibliothek) sowie mit politischen Zielen wie Politisierung, Antidiskriminierung und (über)regionaler sowie transnationaler Vernetzung von Lesben und (homosexuellen) „Transvestiten“. Die Lokalnutzung baute sie zu exklusiv räumlicher Vergemeinschaftung sowie städtischer Verortung und Verankerung aus. Dabei entwickelte sie neben eigener politischer Programmatik eine offensive subkulturelle Werbestrategie, mit der sie sich als offene Lesbe und Weiblichkeitsnormen verweigernde Frau selbstermächtigend ins Bild rückte.
Schlüsselwörter
LSBT*-Subkultur, Selbstempowerment, Transvestit, Weimarer Republik, Nazi-Deutschland, Emanzipation
Daring, strategically minded and emancipated: Searching for traces of the subcultural activist Lotte Hahm (1890–1967)
Summary
In this article we present the critical findings of a reconstruction that focuses primarily on the scope and strategies of action of Lotte Hahm, a well-known subcultural activist from Berlin. Lotte Hahm combined her economic independence with collective self-organization (non-restrictive club structures). She also paired hospitality (bars, dances and cultural events) with providing advice and political education (articles, lectures, a library), as well as with political goals such as politicizing people, working to abolish discrimination and striving to establish local, national and international networks of lesbians and (homosexual) ‘transvestites’. She transformed event venues into exclusive spaces for building community that had a distinct urban feel and were rooted locally. In the process she developed her own political programme as well as an aggressive, subcultural advertising strategy in which she presented herself in a self-empowering way as openly lesbian, someone who refused to bow to feminine norms.
Keywords
LGBT* subculture, self-empowerment, transvestite, Weimar Republic, Nazi Germany, emancipation
1 Einleitung
Lotte Hahm gehört zu den schillernden Persönlichkeiten der Berliner lesbischen, schwulen und trans* Subkultur in der Weimarer Republik. Mindestens sechs Jahre, nämlich von 1926 bis 1932, wirkte sie*1 als unerschrockene und multifunktionale Aktivistin in Berlin.2 Durch erfolgreiches Veranstaltungsmanagement, das sie mit einer gezielt entwickelten Werbestrategie bewarb, wurde sie eine allseits bekannte Größe in der Subkultur. Hahms kulturelles sowie politisches Engagement prägte die Szene(presse), in der sie sich für die Organisierung von Lesben3 und „Transvestiten“ stark machte. Sie nutzte ihre Bekanntheit, um unterschiedliche Selbstorganisierungen zu initiieren und zu fördern: Maßgeblich gestaltete sie Zusammenschlüsse wie einen „Damenklub“ und eine „Transvestitengruppe“, außerdem brachte sie die Idee von einem Bund für ideale Frauenfreundschaft auf den Weg. Mit den Organisationen, die gesellschaftlicher Isolation marginalisierter Gruppen entgegenwirkten, sorgte sie vorrangig für Geselligkeit und Spaß, versuchte jedoch auch dezidiert politisch zu arbeiten, andere dafür zu interessieren und zu mobilisieren. In dem Bemühen, eine überregionale Organisierung voranzutreiben, wob sie ein Frauen(*)netzwerk auch außerhalb Berlins. Selbst während der NS-Diktatur engagierte sie sich klandestin für den Erhalt von Lesbentreffpunkten. In der Nachkriegszeit gehörte sie ebenso zu den Aktiven, die die Homosexuellenbewegung der Weimarer Zeit wiederbeleben wollten.
Über Lotte Hahm und ihre Berliner Zeit wird seit den 1980er-Jahren geforscht: Zu nennen sind vor allem Gudrun Schwarz (1981), Ilse Kokula (1983), Katharina Vogel (1984), Doris Claus (1987) und Claudia Schoppmann (1991 [1985], 1997 [1991], 1998 [1993]). Sie brachten nachhaltig Lotte Hahms Namen ins Spiel der sich konstituierenden außeruniversitären, bewegungsbasierten Lesbengeschichtsforschung und hoben ihre Bedeutung für die Subkultur hervor. Weitere wichtige Untersuchungen sind seither Heike Schader (2000, 2004, 2017) sowie Jens Dobler (2003) und Rainer Herrn (2005) zu verdanken, die zu Lokalen bzw. Klubs und Zeitschriften für Lesben und Trans* arbeiten. Viele von Hahms Berliner Aktivitäten lassen sich ausschließlich in der subkulturellen Presse der Weimarer Republik nachvollziehen – vor allem in den Lesbenzeitschriften Die Freundin, die mit Unterbrechungen zwischen 1924 und 1933 erschien, in Liebende Frauen, Ledige Frauen und Garçonne. Ein Nachlass von Lotte Hahm liegt nicht vor – nicht einmal nennenswerte Selbstaussagen jenseits der Presse. Um diese Lückenhaftigkeit für eine biografische Kleinform dennoch produktiv zu machen, erarbeiteten wir für die personenbezogenen Primärquellen ein Analyseraster und konzentrieren uns auf die Rekonstruktion ihres Lebens und subkulturellen Wirkens. Teilweise ergeben sich für die Zeit des Nationalsozialismus weitere Anhaltspunkte aus bislang unbekannten Polizeiakten, mit denen bisherige Einschätzungen neu bewertet werden können. Zentrale Forschungsfragen sind die nach Hahms Strategien der Selbstbemächtigung und Existenzsicherung, nach ihrem subkulturellen Vorgehen und Wirken sowie nach ihrer Herkunftsfamilie, ihrer persönlichen und beruflichen Lebenssituation. Folgende Unterfragen wurden für die kritisch-hermeutische Analyse entwickelt: Wie funktionierte Lotte Hahms Selbstempowerment? Welches geschlechtliche Selbstverständnis ist naheliegend? Welchen eigenen Beitrag leistete Hahm und welchen Einfluss hatte sie auf die Entwicklung der lesbischen und trans* Subkultur?
2 Hahms Herkunftsfamilie und ihr Leben in Dresden
Lotte Hahm wurde als Charlotte Hedwig Hahm am 23. Mai 18904 in eine evangelische Dresdner Familie geboren: Ihre Eltern waren Alwine Wagner (1866–1920) und der selbstständige Kaufmann Carl Hahm (1864–1931).5 Lotte hatte drei Geschwister. Nachdem die jüngste Schwester (1897–nach 1943) offenbar etwa 18 Jahre mit dem Namen Agnes Hahm gelebt hatte, wurde 1916 auf Anordnung des Landgerichts auf ihrer Geburtsurkunde vermerkt, dass sie „nicht weiblichen, sondern männlichen Geschlechts“ sei und Agnes Hahm nun den Namen Joachim Karl trage.6 Über die Hintergründe lassen sich bislang nur Mutmaßungen anstellen: Es könnte sein, dass Agnes inter* geboren wurde und bei der Geburt als weiblich identifiziert bzw. festgelegt worden ist. Der Bruder könnte sich auch als trans* verstanden haben. Womöglich versuchte er ein Recht auf geschlechtliche Selbstbestimmung geltend zu machen. Die Entscheidung zur Vornamensänderung des Geschwisters von Hahm hat vermutlich ihre eigene geschlechtliche Selbstwahrnehmung beeinflusst.
Lotte Hahm absolvierte offenbar eine Büroausbildung und machte sich um 1920 als Inhaberin einer Versandbuchhandlung7 selbstständig. Bald darauf verließ sie Dresden und zog nach Berlin, wo sich seit dem neuen Jahrhundert und verstärkt durch die Weimarer Demokratie eine lesbisch-schwul-trans*(vestitische) Subkultur entwickelte. Diese Wahl zeigt eine frühe Entscheidung für Selbstständigkeit und ökonomische Unabhängigkeit; der Umzug in die Spreemetropole dürfte mit der Imagination weiterer persönlicher und beruflicher Selbstverwirklichung verbunden gewesen sein.
3 Bedeutung für die Subkultur: politische, strategische, gestalterische Schlüsselfigur sowie Struktur-, Raum- und Richtungsgeberin
Im Laufe der 1920er-Jahre entstand eine Vielzahl von homosexuellen Klubs und Lokalen, die teilweise von Vereinen getragen und deren Programme und Aufrufe in Zeitschriften beworben wurden (Schoppmann 2007: 13). Treffpunkte dienten zum Kontakt, der Geselligkeit, der politischen Bildung und zur Organisierung. Diese – halböffentliche8 – Subkultur entwickelte sich zu einer lebendigen Infrastruktur und sozialen Möglichkeit, die gesellschaftlich bedingte Isolation zu durchbrechen und sich im ‚geschützten‘ Raum vorübergehend frei bewegen zu können. Gleichzeitig boten Subkulturorte Erwerbsquellen, z. B. im musikalischen, artistischen oder literarischen sowie im Dienstleistungsbereich (Bewirtung). Mit der Gründung der ersten und wohl auch größten deutschen Lesbenzeitschrift Die Freundin ließ sich nachlesen, wo in Berlin Frauen zu treffen waren. Lotte Hahm sah Potenzial für die Verwirklichung eigener Vorstellungen und/ oder suchte nach Möglichkeiten, ihren wirtschaftlichen Status zu sichern. Jedenfalls entschied sie, das subkulturelle Angebot selbst aktiv mitzugestalten: Anfang Dezember 1926 rief sie den erfolgreichen Damenklub Violetta ins Leben.9 Die Berliner Szene boomte, und Lotte Hahm war nicht nur eine der maßgeblichen Klubleiter*innen, sondern gab mit Ideen und Elan sogar wesentlich die Richtung vor.
3.1 Damenklub Violetta: Werbung, Programm und Präsentation der Klubleitung
Über mehrere Jahre warb Lotte Hahm kontinuierlich mit großflächigen Anzeigen in der subkulturellen Presse: Die Werbung empfahl die zahlreichen Veranstaltungen von Violetta und benannte Lotte Hahm als Klubleiterin; nicht selten war ein Foto von ihr mit abgedruckt.10 Insgesamt sind sechs Abbildungen von ihr überliefert, die sie grundsätzlich in Hosen, meist im Smoking, mit oder ohne Jackett, immer mit Fliege oder Krawatte, in flachen Schuhen und mit sehr kurzen Haaren zeigen (Abbildungen z. B. in Liebende Frauen 49/1927, Die Freundin 1; 17/1929; 40; 49/1930; 20/1932). Ihre mehrfach abgedruckten Werbefotos gaben Anhaltspunkte für Interessierte, ja, vielleicht sogar eine Art Vorschau auf einen Teil erwartbares Publikum im Damenklub Violetta. Hahm könnte mit diesem Auftreten auch normative und/oder geschlechtsspezifische Maßstäbe für die Art und Weise gesetzt haben, sich in der Lesbenwelt zu zeigen, sodass ihr Auftreten als Identifikationsfigur, wie Marti M. Lybeck überlegt, von anderen auch nachgeahmt wurde (Lybeck 2014: 152). Angesichts vieler versteckt lebender Lesben und Trans*(vestiten), die sich in den Zeitschriften nur unter Tarnnamen äußerten, beeindruckt besonders die mutige Offensivität, mit der sie sich präsentierte. Denn die meiste Zeit, in der die Freundin erschien, konnte die Zeitschrift auch am Kiosk erworben werden. Damit war Lotte Hahm öffentlich sichtbar – und vor allem: angreifbar. Nicht nur für die Polizei und die „Prüfstellen für Schund und Schmutz“, durch die die Subkulturpresse mehrfach verboten wurde,11 sondern auch auf der Straße und im eigenen Kiez. Trotz des Risikos liegt ein Teil ihres Erfolges wohl genau in dieser Entscheidung begründet, nämlich mit ihrem Gesicht, in bevorzugtem Outfit und mit ihrem bürgerlichen Namen für ihren Klub zu werben. Darüber hinaus erschien Lotte Hahm in den Abbildungen stets gut gelaunt und gelassen. So lud sie ein, und ihre Einladungen waren offenkundig eine Art ‚Feel-good‘-Garantie für ihre subkulturellen Orte und Veranstaltungen. Das abwechslungsreiche Programm – von Windbeutel-Wettessen über Mondschein-Dampferpartien bis zu Ostsee-Strandfesten – trug ebenso zum Erfolg des Klubs bei wie Lotte Hahm selbst. Zusätzlich zu den geschalteten Anzeigen sind mehr als 50 Textbeiträge aus der Lesbenpresse überliefert, die sie namentlich unterschrieb oder die sich ihr zuordnen lassen. Darunter befinden sich auch Hinweise auf mehrere Reden und Vorträge, die sie zu aktuellen Ereignissen im Damenklub bzw. der Frauen- und Homosexuellenbewegung gehalten hat (Boxhammer/Leidinger 2020). Sie kritisierte antifeministische Attacken und forderte Frauenrechte ein (Hahm 7/1930); ihr politisches Selbstverständnis könnte an die (radikal-bürgerliche) Frauenbewegung angeschlossen haben. Ehrungen, die in der Bewegungspresse abgedruckt wurden, zeigen Hahms große Beliebtheit: Huldigungen, an sie gerichtete Gedichte oder auch explizite Geburtstagswünsche (Engler 41/1927; Käthe 51/1927; Käthe 21/1928; O. A. 21/1928) belegen sowohl ein nachhaltiges Wirken als auch die namentliche Wertschätzung ihrer persönlichen Leistung. Lotte Hahm scheint ein gefeierter Star der Berliner Subkultur gewesen zu sein.
___
1 Diese gelegentliche Genderung mit dem Asterisk soll konkrete geschlechtliche Annahmen der Kategorien „Frau“ und „Lesbe“ irritieren und so zur Destabilisierung der heteronormativen Zweigeschlechterordnung beitragen.
2 Das Mikroforschungsprojekt an der Hochschule Düsseldorf wurde freundlicherweise finanziert von der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, Fachbereich LSBTI (Laufzeit: 10–12/2018). Wir danken der*/dem* anonymen Reviewer*in für die hilfreichen Anmerkungen.
3 Zur Verwendung des Begriffs „Lesbe“ für die Historiografie vgl. Leidinger/Boxhammer (2015).
4 StadtA Dresden.
5 StadtA Dresden, Standesamt, Löbtau 276/1890.
6 StadtA Dresden, 1083/1897. Herzlichen Dank für den Hinweis an Ralf Dose.
7 Adressbuch für Dresden und seine Vororte. Über das (etwaige subkulturelle) Sortiment ist nichts überliefert.
8 Zum Begriff Leidinger (1999).
9 Zum Klub Schader (2017), zum lesbischen Farbencode Hacker (2015: 306ff.).
10 Z. B. Anzeige 49/1930: Bildunterschrift „Lotte Hahm, Gründerin und Leiterin des Damenklubs ‚Violetta‘“.
11 Zu Verbotsentscheidungen: LAB A. Pr. Br. Rep. Tit. 121, Nr. 17063, GStA Berlin, I. HA, Rep. 77, Ministerium des Innern, Tit. 2772, 3e Bd. 1; 3e Bd. 2; 6 Bd. 2. Herzlichen Dank an Julia Roßhart für ihre Unterstützung.
* * *
 Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist in dem Heft 1-2021 der GENDER – Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft erschienen.
Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist in dem Heft 1-2021 der GENDER – Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft erschienen.
Weitere Leseproben aus unseren Publikationen …
… finden Sie in der Blog-Rubrik Geblättert.
© Unsplash 2022, Foto: Kirssia Cruz