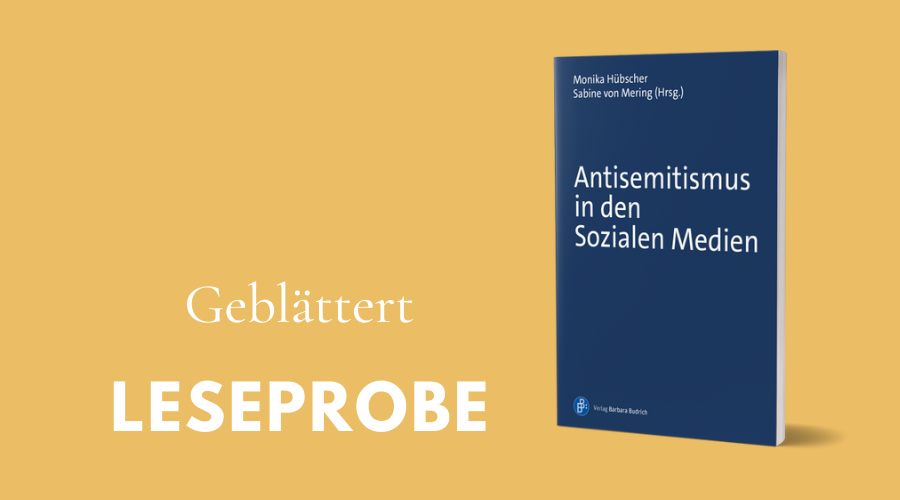Die Sozialen Medien revolutionieren mit ihren Technologien und Geschäftsmodellen die Verbreitung von Antisemitismus. Einblicke in Fallstudien zu verschiedenen Plattformen und Analysen von Strategien gegen antisemitischen Hass: eine Leseprobe aus Antisemitismus in den Sozialen Medien von Monika Hübscher und Sabine von Mering (Hrsg.).
***
Antisemitismus in den Sozialen Medien: Einleitung
Sabine von Mering
Die englische Version dieses Bandes, die im März 2022 bei Routledge erschien, setzte sich zum Ziel, Antisemitismus in den sozialen Medien als Forschungsfeld zu etablieren. Bereits mit dem Erscheinen von Facebook im Jahr 2004 hatten antisemitische Memes begonnen, viral zu gehen, doch unser Band war 2022 der erste, der sich ausschließlich mit diesem Phänomen befasste. Schon 2022 zeigten wir auf, dass etliche Terroranschläge live auf Millionen Handys gelikt, kommentiert und geteilt worden waren. Einzeltäter*innen und terroristische Organisationen nutzten die Plattformen für ihre Interessen. In Myanmar wurde der Genozid an den Rohingya durch Facebook wesentlich befördert. Doch 2022 diskutierten wir noch, ob wir warnen sollten, dass Social Media auch strategisch gegen Jüdinnen*Juden eingesetzt werden könnten. Wir zögerten, denn wir wollten nicht übertreiben oder alarmierend klingen. Doch am 7. Oktober 2023, nur Monate vor der Veröffentlichung der deutschen Ausgabe dieses Bandes – wurde die strategische Nutzung sozialer Medien zur Verbreitung von Terror gegen Israelis und zur Anstiftung zum Hass gegen Jüdinnen*Juden grausame Realität. Die dringend notwendige Intensivierung und Erweiterung wissenschaftlicher Beschäftigung mit Antisemitismus in den sozialen Medien wurde durch die Erfahrungen seit dem 7. Oktober 2023 auf schreckliche Weise bekräftigt.
Vor diesem Hintergrund hat Monika Hübscher die Kapteil eins, drei, und fünf überarbeitet und aktualisiert, während Sabine von Mering vorrangig für die Übersetzungen der übrigen elf Kapitel verantwortlich zeichnet. Besonders das erste Kapitel, das wir in der englischen Version gemeinsam formuliert hatten, und worin es uns vor allem darum gegangen war, die Rolle von Technologie und Geschäftsmodell der Plattformen bei der Verbreitung antisemitischer Inhalte hervorzuheben und den Forschungsstand bzw Forschungsdesiderata zu benennen, hat nun zusätzliche Schwerpunkte erhalten. Monika Hübscher beschreibt darin die algorithmische Kuratierung von Antisemitismus vor dem Hintergrund des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 und den Folgen für Jüdinnen*Juden. Zudem bietet Hübscher einen Einblick in Interviews mit nicht-jüdischen deutschen Jugendlichen und beschreibt die gängigen Gegenmaßnahmen im Vergleich zu den Möglichkeiten der Social Media Literacy (SML).
Armin Langer, der an der Übersetzung des zweiten Kapitels ins Deutsche freundlicherweise mitgewirkt hat, untersucht darin das Verschwörungskollektiv QAnon, das seit seiner Gründung im Jahr 2017 in den USA und in der gesamten „westlichen“ Welt eine beunruhigend große und überraschend vielfältige Anhänger*innenschaft gewonnen hat, wobei die meisten Aktivitäten in den sozialen Medien ihren Anfang finden. Langer argumentiert, dass die Social-Media-Beiträge von QAnon archetypische Elemente verwenden – etwa Vorstellungen von geheimen Eliten und entführten Kindern –, die aus der Geschichte bekannte antisemitische Verschwörungsmythen widerspiegeln. Sein Kapitel bietet einen Überblick über die Geschichte und Präsenz von QAnon und untersucht die häufigsten Formen des Antisemitismus in QAnon-Posts auf Twitter und Telegram.
Sophie Schmalenberger und Monika Hübscher analysieren in Kapitel drei Social-Media-Beiträge der „Alternative für Deutschland“ (AfD) zum 8. Mai, dem Tag der Niederlage Nazi-Deutschlands im Jahre 1945, die von Mitgliedern der AfD für revisionistische Zwecke instrumentalisiert wurden. Mit Hilfe der Mixed-Methods- Software MaxQDA entwickeln Schmalenberger und Hübscher ein Codesystem, das antisemitische Hinweise identifiziert. Ihre Ergebnisse führen sie dazu, in Erweiterung des primären und sekundären Antisemitismus ein neues Konzept von „tertiärem Antisemitismus“ zu entwickeln. Sie stellen fest, dass die AfD soziale Medien strategisch nutzt, um eine revisionistische Interpretation des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust zu kommunizieren, indem sie indirekte antisemitische Hinweise anstelle expliziter Äußerungen von Antisemitismus verwendet. Abschließend identifizieren die Autorinnen vier rhetorische Strategien in der Social-Media-Kommunikation der AfD, die Antisemitismus normalisieren, mainstreamen und rechtfertigen.
Im vierten Kapitel richtet Jakob Guhl, dem wir ebenfalls für seine Mitarbeit an der Übersetzung seines Kapitels danken, den Fokus auf die andere Seite des politischen Spektrums, nämlich auf Antisemitismus auf Facebook-Seiten von Mitgliedern der (linken) britischen Labour Party im Zeitraum von 2015 bis 2019. Nachdem Jeremy Corbyn zum Vorsitzenden der Labour Party gewählt wurde, kam es im September desselben Jahres im Vereinigten Königreich zu großen öffentlichen Debatten über Bedenken hinsichtlich des Antisemitismus in der Labour Party. Guhl weist darauf hin, dass die Dynamik sozialer Medien zwar oft im Mittelpunkt dieser Diskussionen stand, eine systematische und groß angelegte Analyse des Phänomens bisher jedoch kaum erfolgt ist. Seine Analyse zeigt, dass Online-Antisemitismus in Pro-Labour-Gruppierungen zwar in relativ geringem Umfang auftrat, aber noch immer leicht zugänglich ist und nicht immer verurteilt wird.
Monika Hübscher und Vanessa Walter beschreiben in Kapitel fünf einen antisemitischen Trollangriff in Deutschland, den sie live auf YouTube miterlebt haben, und der ihnen als Grundlage dient für die Analyse von Methoden und Zielen antisemitischen Trollings. Sie verwenden dabei eine Kombination aus qualitativer Diskursanalyse und digitaler Textanalyse mit Hilfe der digitalen Tool-Suite „Voyant“. Die Autorinnen geben auch Hinweise zum Umgang mit dem Phänomen des Trollangriffs.
Cassie Miller untersucht im sechsten Kapitel das zeitgenössische neonazistische Beschleunigungsnetzwerk in den Vereinigten Staaten und dessen Nutzung sozialer Medien zur Verbreitung von Propaganda und zur Radikalisierung neuer Anhänger. Miller zeigt auf, dass die Bewegung zutiefst antisemitisch ist und den Einsatz von Gewalt zum Sturz westlicher Demokratien fördert, von denen ihre Anhänger glauben, sie stünden unter jüdischer Kontrolle. Das Kapitel zeichnet das Wachstum des Netzwerks nach, vom faschistischen Forum „Iron March“, das 2011 entstand, über die neonazistische „Atomwaffen Division“ im Jahr 2015 bis hin zu „The Base“, einem gewalttätigen, antisemitischen Akzelerationisten-Netzwerk, das 2018 gegründet wurde. Obwohl diese Einheiten inzwischen nicht mehr existieren, zeigt Miller, dass eine riesige, vernetzte Beschleunigungsbewegung auf alternativen sozialen Plattformen wie Gab und Telegram weiterhin äußerst aktiv ist.
Der Beitrag von Navras Aafreedi in Kapitel sieben ist der erste wissenschaftliche Beitrag, der eine Analyse der antisemitischen Rhetorik auf YouTube in Urdu präsentiert, einer Sprache, die von Millionen Muslim*innen in Südasien gesprochen wird. Seine Fallstudie über den muslimischen Geistlichen Israr Ahmed beleuchtet, wie YouTube zur Verbreitung antisemitischer Verschwörungsmythen in Urdu genutzt wird. Aafreedi zeigt auf, aus welchen Gründen dieses Phänomen in Südasien bisher nicht die nötige Aufmerksamkeit erhält, und schlägt Maßnahmen gegen die Verbreitung von Antisemitismus auf Urdu vor.
Hendrik Gunz und Isa Schaller lenken den Blick in Kapitel acht zurück nach Deutschland, wo im Kontext der COVID-19-Pandemie auf der Straße und in den sozialen Medien eine lautstarke mit Vergleichen mit Nazi-Deutschland, Verschwörungstopoi und Antisemitismus-Erzählungen angefüllte Protestszene entstand. Gunz und Schaller, die dankenswerterweise ebenfalls an der deutschen Version ihres Kapitels mitgearbeitet haben, konzentrieren sich auf Attila Hildmann, der sich innerhalb von weniger als einem Jahr vom gefeierten veganen Koch und beliebten Talkshow-Gast in einen aggressiven Agitator verwandelte, der über seine Social- Media-Accounts nicht nur unverhohlenen, den Holocaust leugnenden Antisemitismus verbreitet, sondern auch direkt dazu aufruft, Juden zu töten. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung bestätigen, dass Video-Hosting-Dienste wie YouTube und der Messenger Telegram, der häufig zur Mobilisierung von Protesten genutzt wird, eine wichtige Ressource für die Analyse von Antisemitismus darstellen. Ihre Studie beweist auch, dass eine Kombination aus hermeneutischem Ansatz und Häufigkeitsanalyse nützlich ist, wenn mit mehreren Plattformen gearbeitet wird und große Mengen unterschiedlicher Daten zu analysieren sind sowie, um die Merkmale narrativer Strukturen von Verschwörungsmythen zu kontextualisieren.
In Kapitel neun rekonstruieren Hendrik-Zoltan Andermann und Boris Zizek ein antisemitisches Meme mithilfe der qualitativen Methode der objektiven Hermeneutik und zeigen dabei in akribischer Detailarbeit das riskante Potenzial einer solchen visuellen Kommunikation antisemitischer Inhalte auf, die in sozialen Netzwerken weit verbreitet ist. Die Autoren erläutern die latenten Bedeutungsschichten und Botschaftsstrukturen der antisemitischen Illustration, um zu zeigen, warum sich solche Memes besonders für die Vermittlung antisemitischer Botschaften eignen. Wir sind auch Hendrik-Zoltan Andermann für seine Hilfe bei der Übersetzung des Kapitels dankbar.
Gabriel Weimann und Natalie Masri machen uns in Kapitel zehn auf TikTok aufmerksam, die derzeit am schnellsten wachsende Plattform mit 1,2 Milliarden aktiven Nutzer*innen. Ihre Studie basiert auf einer systematischen Inhaltsanalyse von TikTok-Videos und verdeutlicht die alarmierende Präsenz extrem antisemitischer Botschaften in Videoclips, Liedern, Kommentaren, Texten, Bildern und Symbolen in auf TikTok geposteten Inhalten. Anders als auf anderen Online-Social-Media-Plattformen, erklären Weimann und Masri, seien die TikTok-Nutzer*innen fast alle jung, meist Kinder und Jugendliche. Da TikTok einem chinesischen Unternehmen gehört, besteht noch weniger Aussicht auf Regulierung oder Maßnahmen zum Schutz der Benutzer*innen vor hasserfüllten, gewalttätigen und gefährlichen Inhalten durch öffentlichen Druck. Ein weiteres Problem besteht darin, dass TikTok in Bezug auf Hassreden und andere anstößige Inhalte keine eigenen Nutzungsbedingungen hat.
In Kapitel elf verfolgt Quint Czymmek wiederum einen anderen Ansatz, indem er Interviews mit drei jüdischen Social-Media-Nutzer*innen führt und anschließend analysiert. In den Interviews befragt er sie zu ihren Erfahrungen mit Antisemitismus in sozialen Netzwerken. Czymmek konzentriert sich auf vier Fragen: Wie nutzen die Befragten soziale Netzwerke, welche Formen von Antisemitismus erleben sie, wo treffen sie auf Antisemitismus und welche Gegenstrategien nutzen sie. Auch Quint sei für die Bearbeitung der Übersetzung seines Kapitels herzlich gedankt.
Das Team von Günther Jikeli, Damir Cavar, Weejeong Jeong, Daniel Miehling, Pauravi Wagh und Denizhan Pak von der Indiana University in Bloomington, Indiana, USA stellt in Kapitel zwölf seine Fortschritte bei der Ausarbeitung einer Definition von Antisemitismus vor, die zur automatischen Erkennung antisemitischer Botschaften in sozialen Medien verwendet werden kann. Sie kommen zu dem Schluss, dass hierfür nicht nur ein umfassendes Verständnis der Geschichte des Antisemitismus und seiner (wieder) aktuellen Formen erforderlich ist, sondern auch ein umfassender Datensatz, der mit einer klaren Definition von Antisemitismus gekennzeichnet ist. Sie nennen diesen gekennzeichneten Datensatz ihren „Goldstandard“ und schlagen vor, ihn von Algorithmen zur Identifizierung antisemitischer Botschaften verwenden zu lassen. Die Ergebnisse ihrer Studie zeigen, dass der Anteil antisemitischer Nachrichten in Posts über Juden auf X (vormals Twitter) erheblich ist. In den von ihnen zwischen Mai und August 2020 gesammelten Live-Tweets wurde jeder siebte Tweet in Gesprächen über Juden*Jüdinnen als antisemitisch eingestuft. Günther Jikeli und Daniel Miehling auch herzlichen Dank für die Bearbeitung der Übersetzung ihres Kapitels.
Yfat Barak-Cheney und Leon Saltiel beschäftigen sich als Mitarbeitende des Jüdischen Weltkongresses mit vielen Jahren Berufserfahrung in Kapitel 13 mit der Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen im Umgang mit antisemitischer Hassrede in sozialen Medien. Sie stellen die Arten von Interventionen und Methoden der Zivilgesellschaft zur Bekämpfung von Antisemitismus in sozialen Medien dar und geben Empfehlungen für die Rolle der Zivilgesellschaft. Den Schwerpunkt legen sie auf das Melden antisemitischer Hassrede und setzen darauf, dass die Social-Media-Plattformen dabei überwacht werden, dass sie ihre eigenen Richtlinien auch einhalten. Barak-Cheney und Saltiel erklären, warum das von Organisationen, Wissenschaftler*innen und anderen Institutionen gewonnene Fachwissen als Leitfaden für die Gesetzgebung sowie die Gestaltung und Verbesserung von Richtlinien dienen muss. Ihrer Ansicht nach sollten die Plattformen sich bei der Bekämpfung von Antisemitismus nicht vorrangig auf Meldungen aus der Zivilgesellschaft verlassen dürfen. Vielmehr seien vor allem konkrete Gesetze und die effektive Durchsetzung stringenter Richtlinien gegen Hass auf den Plattformen durch die Unternehmen selbst nötig.
Im letzten Kapitel des Bandes stellt Michael Bossetta einige der Schlussfolgerungen in Frage, die in anderen Kapiteln auf der Grundlage einer Untersuchung bestehender quantitativer Forschung zu Antisemitismus und sozialen Medien präsentiert wurden, und argumentiert, dass es in sozialen Medien tatsächlich viel weniger Antisemitismus gibt als allgemein angenommen. Er erörtert, wie bestimmte Komponenten des Plattformdesigns erklären, warum Antisemitismus auf einigen Plattformen aufkommt, auf anderen jedoch nicht, und vergleicht das Design großer Social-Media-Plattformen mit Online-Foren. Letztlich argumentiert er, dass die zukünftige Forschung zu Antisemitismus und sozialen Medien die Untersuchung antisemitischer Inhalte in allen Online-Bereichen angehen sollte, mit besonderem Augenmerk auf die Auswirkungen solcher Inhalte auf die Radikalisierung von Nutzer*innen.
Die Beteiligung vieler deutscher Mit-Autor*innen am englischen Band legte eine deutsche Übersetzung nahe. Hinzu kam das große Interesse in Deutschland nach Erscheinen der englischen Ausgabe und wiederholte Bitten von Lehrenden und Vertreter*innen verschiedener Organisationen, die Arbeiten doch auch in deutscher Sprache bereitzustellen. Da wir uns dabei insbesondere erhoffen, dass der Band in Unterricht und Lehre zum Einsatz kommt, haben wir bewusst entschieden, alle englischen Zitate ins Deutsche zu übersetzen, um die Texte sowohl für Lehrende als auch für Lernende so zugänglich wie möglich zu machen.
Dieser Band setzt also den Anfang fort, den unser englischer Band gemacht hat, dieses Forschungsfeld zu etablieren. Wir erhoffen uns auch von der deutschen Ausgabe, dass sie viele und vor allem junge Forscher*innen auf der Suche nach neuen Forschungsthemen inspiriert, sich mit den unerforschten Aspekten von Antisemitismus in den sozialen Medien zu beschäftigen. Die Erfahrungen von 2023 deuten leider darauf hin, dass sich das Problem in den kommenden Jahren nicht verringern, sondern dass es eher noch zunehmen wird. Umso wichtiger ist es, dass sich noch wesentlich mehr wissenschaftliche Untersuchungen diesen Fragen widmen, um Gesellschaft, Politik und Lehre mit neuen Erkenntnissen zum Verständnis und zur Bewältigung von Antisemitismus in den sozialen Medien beratend zur Seite stehen zu können und die dafür notwendige Social Media Literacy mit neuen Methoden, Tools, und Ideen zu befördern.
***
Sie möchten gern weiterlesen?
Jetzt versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
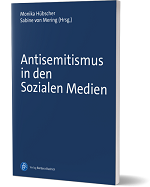 Monika Hübscher, Sabine von Mering (Hrsg.):
Monika Hübscher, Sabine von Mering (Hrsg.):
Antisemitismus in den Sozialen Medien
→ Interview mit den Herausgeberinnen
Die Herausgeberinnen
 Monika Hübscher ist PhD-Kandidatin an der University of Haifa in Israel und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt ‚Antisemitismus und Jugend‘ an der Universität Duisburg-Essen.
Monika Hübscher ist PhD-Kandidatin an der University of Haifa in Israel und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt ‚Antisemitismus und Jugend‘ an der Universität Duisburg-Essen.
 Sabine von Mering, Ph.D., ist Professorin für Germanistik und Gender Studies und Direktorin des Center for German and European Studies (CGES) an der Brandeis University in Massachusetts, USA.
Sabine von Mering, Ph.D., ist Professorin für Germanistik und Gender Studies und Direktorin des Center for German and European Studies (CGES) an der Brandeis University in Massachusetts, USA.
Über das Buch
Soziale Medien haben die Verbreitung von Antisemitismus revolutioniert. Algorithmisch verstärkt verbreitet sich Antisemitismus auf den Plattformen in Sekundenschnelle, kostenlos und global. Die daraus resultierende Gefahr für Jüdinnen*Juden ist eine große gesellschaftliche Herausforderung.
Das Buch gibt Einblicke in Fallstudien auf verschiedenen Plattformen und zeigt, wie soziale Medien durch die Verbreitung antisemitischer Inhalte von politischem Akteur*innen instrumentalisiert werden. Es werden innovative Methoden und Tools (CrowdTangle oder Voyant Tools) und neue Konzepte (Social Media Literacy, tertiärer Antisemitismus, antisemitische Eskalation) vorgestellt und Strategien, um Antisemitismus auf den Plattformen zu bekämpfen, kritisch evaluiert. Dieses Buch bietet eine umfassende Einführung für alle, die sich mit der Problematik Antisemitismus in den sozialen Medien auseinandersetzen wollen.
Mehr Leseproben …
… finden Sie auf unserem Blog.
© Foto Monika Hübscher: privat; Foto Sabine von Mering: Lotte Dale | Titelbild gestaltet mit canva.com