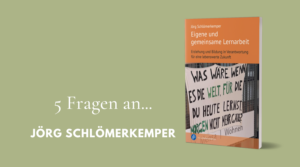Im Netzwerk von Mission und Naturwissenschaft. Die Geistergeschichte von Mqhayi, die Herrnhuter Brüdergemeine und die Meckelschen Sammlungen in Halle (Saale)
Thomas Ruhland, Sahra Dornick
FZG – Freiburger Zeitschrift für GeschlechterStudien, Heft 2023, S. 39-59.
Zusammenfassung: In der Provenienzforschung bildet die christliche Mission des 18. und 19. Jahrhunderts eine Forschungslücke. Bei der Repatriierung von human remains aus kolonialen Kontexten gerät die Sammlungstätigkeit christlicher Missionar*innen kaum in den Blick. Sahra Dornick und Thomas Ruhland untersuchen die bisher unbekannte systematische Sammlung von human remains im Rahmen der Mission der Herrnhuter Brüdergemeine aus Perspektive Feministischer und Postkolonialer Natur- und Technikforschung. Anknüpfend an Donna Haraways Methodologie des Fadenspiels wird Mqhayis Ghost Story auf Grundlage historischer und gegenwärtiger Sammlungen und umfangreichem Quellenmaterial rekonstruiert. Sahra Dornick und Thomas Ruhland verfolgen die fragmentierte Geschichte von human remains im Kontext missionarischen Sammelns der Herrnhuter Brüdergemeine, deren Verbindungen zu Hermann Welcker und den Meckelschen Sammlungen in Halle sowie zu Karl Ernst von Baer. Erstmals werden die systematische Zusammenarbeit mit Anthropologen und die koloniale und epistemische Gewalt im Kontext christlicher Mission bei der Erwerbung und dem Umgang von human remains als Forschungsobjekten dargelegt.
Schlagwörter: Herrnhuter Brüdergemeine, Wissenschaftstheorie, Meckelsche Sammlungen zu Halle (Saale), Provenienzforschung, human remains
Inside the Network of Christian Mission and Science. Mqhayi’s Ghost Story, the Moravian Brethren, and the Meckel Collections at Halle (Saale) (Germany)
Abstract: In provenance research, the Christian missionary activities of the 18th and 19th centuries represent a gap. With regard to the repatriation of human remains from colonial contexts, the collecting activities of Christian missionaries have received little attention. Sahra Dornick and Thomas Ruhland examine from the perspective of feminist and postcolonial science and technology studies how the mission of the Moravian Brethren also involved the hitherto unrecognized systematic collection of human remains. Following Donna Haraway’s methodology of the cat’s cradle, they reconstruct Mqhayi’s ghost story drawing on historical and contemporary collections and extensive source material. Sahra Dornick and Thomas Ruhland trace the fragmented history of human remains within the framework of the missionary collecting activities of the Moravian Brethren, their connections to Hermann Welcker and the Meckel Collections at the University of Halle-Wittenberg (Germany), and to Karl Ernst von Baer. For the first time, the systematic collaboration with anthropologists and the colonial and epistemic violence in the context of Christian mission in the acquisition and handling of human remains as research objects are outlined.
Keywords: Moravian Brethren, Philosophy of Science, Meckel Collections at Halle (Saale), provenance research, human remains
Einleitung
In der Ausstellung „Garten der irdischen Freuden“, die 2019 im Berliner Gropius-Bau gezeigt wurde, befand sich die Arbeit „Ngali Ngariba“ (We Talk) von Libby Harward, einer Nachfahrin von Junobin of Mulgumpin (Moreton Island). Auf einem Tisch standen neun in Flaschen gezogene, lebende Pflanzen. An den Gläsern waren die geographische Herkunft sowie die standardisierte naturwissenschaftliche Bezeichnung mit lateinischem Doppelnamen zu lesen. Über den Pflanzen ertönte die Frage „Why am I here?“ in den Sprachen der pazifischen Herkunftsgebiete. Mit ihrer Arbeit gibt Libby Harward Pflanzen eine Stimme, welche während der Kolonialzeit aus dem Südpazifik als ‚Entdeckungen‘ in den globalen Norden gebracht wurden. „Ngali Ngariba“ gehört zu einer Reihe von Kunstwerken, mit denen Libby Harward darauf aufmerksam macht, dass die Trope der ‚Terra Nullius‘, der leeren, auf Entdeckung und Benennung wartenden Welt niemals der Realität entsprach, deren Konzeption aber Voraussetzung und Legitimierung gewaltvoller kolonialer Ausbeutung war (Dornick 2023; Rosenthal 2019; Plumwood 2003).
Die von Harward aufgeworfene Frage: „Warum bin ich hier?“ verstehen wir als zentral für die Praxis einer Feministischen und Postkolonialen Wissenschaftsforschung, welche sich epistemologisch den partialen, situierten und spekulativen Perspektiven verschreibt (Verran 2017; Haraway 1988). Deboleena Roy folgend, wenden wir diese Frage in Fragen nach den Sammelnden, richten den Blick „back from the collected artifact to the collector, revealing science as a social practice“ (Roy 2018: 65) und suchen im vorliegenden Beitrag Antworten darauf, wie die human remains von Mqhayi aus dem Süden Afrikas in die Meckelschen Sammlungen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg kamen. Wir versuchen uns der Geschichte einer Person anzunähern, von deren Existenz nur ihr Schädel und kolonial-rassistische Begrifflichkeiten Zeugnis geben. Wer war Mqhayi, welche ethnische Zugehörigkeit hatte diese Person, und wie und unter welchen Umständen und von wem wurde sie nach Europa gebracht? Daran anknüpfend fragen wir danach, welche ethischen und epistemologischen Dimensionen in den Blick kommen, wenn wir diesen Fragen folgen und welche Bedeutung koloniale gewaltvolle Episteme für die Re-Individualisierung (Förster et al. 2018) von Mqhyai haben. Wie müssen globale christliche Missionsgeschichte und ihr Einfluss auf die Entwicklung der Naturwissenschaften neu erzählt werden?
Wir gehen der These nach, dass die systematische Sammlung von human remains im Rahmen der Herrnhuter Brüdergemeine als fragmentarisch greifbare Ghost Stories (Subramaniam 2014) begriffen werden müssen. Wir betrachten Mqhayi als ein Element dieser fragmentarischen Geschichte und wollen die in anderen Kontexten auftauchenden Elemente dieser Ghost Variable (Karkazis/Jordan-Young 2020), wie Sammlungsinventare oder medizinische Dissertationen, nutzen, um auf diese Weise Mqhayis Geschichte zu erhellen. Dabei verbinden wir aktuelle wissenschaftsgeschichtliche Forschungen zur Mission der Herrnhuter Brüdergemeine mit postkolonialer Provenienzforschung im Kontext der Repatriierung von human remains (Roque 2021; Fforde/McKeown/Keeler 2020a; Winkelmann 2020; Förster et al. 2018) aus Perspektive der Feministischen und Postkolonialen Science and Technology Studies (STS) (Verran 2017; Harding 1991; Haraway 1988). Nach einer theoretischen und methodologischen Einordnung unseres Vorgehens, erzählen wir Mqhayis Geschichte in Anlehnung an Haraway (2016) in sieben verschiedenen Fadenfiguren. Mit der methodologischen Entscheidung Mqhayis Geschichte in Fadenfiguren wiederzugeben, tragen wir der Tatsache Rechnung, dass sich seine Ghost Story aus zeitlich und thematisch sehr disparaten Quellen speist. Kataloge verschollener Sammlungen des 19. Jahrhunderts stehen heutigen wissenschaftlichen Kollektionen gegenüber. Unbekannte Privatarchive und Archive religiöser Gemeinschaften helfen diese Fadenfiguren ebenso zu schaffen wie Universitätsarchive. Berichte aus Südafrika stehen neben Erzählungen aus der russischen Steppe, wissenschaftliche Briefwechsel neben Zeitungsberichten und ethnographischen Beschreibungen aus drei Jahrhunderten. All diese Fragmente sind Teile des kolonial-rassistischen Wissens um, von und über Mqhayi. Indem wir im Folgenden, ausgehend von dem entmenschlichten, zum Artefakt degradierten Schädel Mqhayis den Blick auf die „Aufsammler“ (Förster et al. 2018: 46) und Sammler sowie deren Verknüpfung mit der Wissenschaft richten, kreieren wir eine alternative wissenschaftskritische Geschichte, welche sich bemüht, die hegemonialen und gewaltförmigen Bezeichnungen und Kategorisierungen zu unterlaufen. Mqhayis Geschichte erzählen wir als eine Geschichte über Macht und koloniale Gewalt; als eine Geschichte über weiße männliche Wissenschaftler und Missionare im Kontext der Phrenologie und besonders der Etablierung der biologischen Anthropologie (Sommer 2023). Durch den Fokus auf Herrnhuter Missionare als Sammelnde, Erwerbende und Vermittelnde von human remains und ihre Netzwerke liefern wir einen Beitrag zur Analyse der sozialen Praxis von Wissenschaft, der zugleich neue Kenntnisse über den systematischen Raub von human remains bereitstellt. Mit der Veröffentlichung des bislang in dieser Form unbekannten Wissens über Mqhayi, die globalen missionarischen Sammelkontexte der Herrnhuter Brüdergemeine und ihre Verbindung zur anthropologischen Wissenschaft hoffen wir zugleich einen Beitrag zur Re-Individualisierung und Repatriierung von unrechtmäßig erworbenen human remains aus kolonialen Kontexten leisten zu können und damit Wege zur Heilung zu eröffnen (Wergin 2021).1
Die unsichtbare Welt der Geister – Methodologie
Feministische STS haben eine lange Geschichte dahingehend, nicht nur den Inhalt, sondern auch die Politik der Wissensproduktion zu hinterfragen. Seit den 1970/80er-Jahren kritisieren sie die vermeintlich universalen, objektiven und neutralen Ansprüche von Wissenschaft sowie die leeren Stellen, die Unaussprechlichkeiten in der Formierung von Wissen und dessen Machtbeziehungen. Die Frage nach der Ethik und Politik von Wissenschaft in den Feministischen STS interferiert mit der für die Postkolonialen STS zentralen Frage nach der epistemischen Gewalt kolonialer Wissens- und Herrschaftsregime (Spivak 2008). Feministische STS zeigen, dass neben Geschlecht weitere Faktoren, wie etwa Sexualität, race, Klasse, Religion über die Formation des Wissens entscheiden, indem sie ausschlaggebend dafür sind, wer überhaupt Wissenschaftler*in werden kann, wessen Forschungsfragen relevant sind, welche Stimmen gehört, welche unterdrückt, welches Wissen produziert wird, was als wissenschaftliches Wissen gilt und welches Wissen unsichtbar in der „invisible world of ghostly hauntings“ (Subramaniam 2014: 225; Crenshaw 1991; Harding 1991; Longino 1987) herumspukt. Postkoloniale STS brechen radikal mit dem Fortschrittsnarrativ der Moderne als unilinearem Prozess und beziehen historische und gegenwärtige Machtverhältnisse, Benennungspraktiken und Gewaltbeziehungen dezidiert in ihre Forschungen mit ein. Geschichte wird diesem Verständnis folgend als vielschichtiges und rhizomatisches, teils traumatisches, Netzwerk vorgestellt, das von zahlreichen Verknüpfungen und Überlagerungen durchzogen ist und in welches wir unhintergehbar verstrickt sind (Verran 2017; Subramaniam 2014; hooks 1984).
In Anlehnung an Banu Subramaniams (2014) methodologische Entscheidung in „Ghost Stories for Darwin“, „to see ghosts – or, rather, her inability not to see them“ (Karkazis/Jordan-Young 2020: 764), wollen wir die verschleierte Verbindung christlicher Mission mit der Entstehung der biologischen Anthropologie am Beispiel der vergessenen, rassistisch fundierten Aneignung von human remains aufdecken. Die Suche nach dieser „Ghost Variable“ (Karkazis/Jordan-Young 2020) ist fragmentarisch und bruchstückhaft; sie entzieht sich: „Ghosts, rather than a superstitious legacy of a past, are a haunting reminder of an ignored past“ (Subramaniam 2014: 23). Gordon, Subramaniam und Karkazis/Jordan-Young nutzen die Metapher des haunting „for comprehending the occluded and repressed violence in modern systems of power“ (Karkazis/Jordan-Young 2020: 764). Sie fokussieren „operations of buried histories of power“ (ebd.) und eröffnen damit eine Perspektive auf Prozesse der (Un)sichtbarmachung der kolonial-rassistischen Grundlagen der Episteme der Naturwissenschaften. Diese Perspektive wollen wir in diesem Beitrag auf die materielle Basis des Wissens über human remains ausweiten.
Fadenfigur I – Spukende Geister
Die Geschichte von Mqhayis human remains ist eine, die schwer auszuhalten ist, die uns nicht loslässt und uns verfolgt. Avery Gordon schreibt, dass „haunting is a frightening experience“, und zugleich, „is distinctive for producing a something-to-be-done“. Haunting als Existenzweise entsteht, „when the people who are meant to be invisible show up without any sign of leaving, when disturbed feelings cannot be put away, when something else, something different from before, seems like it must be done“ (Gordon 2008: xvi).
Irgendetwas fühlte sich nicht in Ordnung an, als sich vor circa vier Jahren bei einer Besichtigung der als Meckelsche Sammlungen bekannten Kollektion von Skeletten, Schädeln und anatomischen Präparaten des Instituts für Anatomie und Zellbiologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg menschliche Schädel mit Aufschriften, wie „Glitsch“, „Hht“, „Becker“, „Labrador“, „Sarepta“ aufdrängten, die aus Forschungen zur Mission der Herrnhuter Brüdergemeine und ihrer Verbindung zur Naturgeschichte im 18. und 19. Jahrhundert als Ortsoder Personennamen bekannt waren.
Die Herrnhuter Brüdergemeine war und ist eine protestantische Freikirche, deren Geschichte 1722 mit der Gründung der namensgebenden Niederlassung Herrnhut begann. Seit 1732 übten ihre Mitglieder weltweit ihre christliche Missionstätigkeit aus. Als mit Abstand größte protestantische Missionsbewegung des 18. Jahrhunderts gründete sie Niederlassungen auf allen damals bekannten Kontinenten, u.a. in Grönland, Surinam oder Südindien und wurde zum Vorbild für die vielen Missionsvereine des 19. Jahrhunderts. Die Meckelschen Sammlungen unterstehen als eine der umfangreichsten anatomischen Universitätssammlungen Deutschlands mit 8.000 Präparaten, davon 831 Schädel (Klunker 2014: 2), dem Institut für Anatomie und Zellbiologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Auf einem dieser Schädel ist in großen Buchstaben ganz offensichtlich der Name der verstorbenen Person geschrieben: „Umkoÿi“ oder Mqhayi, wie der Name von Forscher*innen zur Geschichte Südafrikas gegenwärtig transliteriert wird und welchen Namen wir im Folgenden benutzen.2 Mit bräunlich-güldener Beschriftung steht „Caffer“, als rassistische Fremdzuschreibung, auf seiner Stirn. Die rechte Seite trägt in gleicher Farbe die Aufschrift: „Umkoÿi ein großer Heemraat des Mapasa fiel den 9. Juli 1846 als Mapasa Silo zerstören wollte“. Die Frage, ob die massive Verletzung auf der gleichen Seite – das Jochbein fehlt völlig – Ursache seines gewaltsamen Todes war, kommt Betrachter*innen sofort in den Sinn. Viel banaler wirkt das Etikett vor Mqhayis Kopf. Neben Nummern, Abkürzungen und Signaturen trägt es die Aufschrift „Coll. Becker, Herrnhut“. Dabei, so eine erste Vermutung, könnte es sich um die Sammlung des Arztes und Mitgliedes der Herrnhuter Brüdergemeine Carl Joseph Theodor Becker (1801-1884) aus Herrnhut in der Oberlausitz handeln (Riecke 2020). Recherchen brachten ein Verzeichnis seiner Sammlung mit 28 human remains zutage. Unter Nummer 21 erwähnt es einen „Kaffer (1 Hptlg Mapasas, †1846 im Kaffernkrieg) ohne Kinnlade.“3 Jahreszahl, Lokalisierung und Erwähnung einer Person namens „Mapasa“ bestätigten das „Itinerar“ (Hahn 2015: 27) von Mqhayis Schädel von Silo in Südafrika über die Sammlung Beckers in Herrnhut bis nach Halle.
An diese initiale Irritation anschließend, begann die Arbeit, das Netzwerk der Handelswege, Mittelsmänner und Beschaffungspraxen systematisch zu rekonstruieren, das zu Mqhayis Auftauchen in den Meckelschen Sammlungen führte. Erste Literaturrecherchen machten klar, dass die Verbindung der Herrnhuter Brüdergemeine mit der Sammlung von human remains im Dienst der rassistischen Anthropologie des 19. Jahrhunderts völlig unerforscht ist. Einzig bekannt ist, dass Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) aus Göttingen, der Begründer der Anthropologie und Besitzer der wohl ersten umfassenden wissenschaftlichen Schädelsammlung, die auch heute noch an der Georg-August-Universität Göttingen besteht (Böker 2019), 1791 bei der Herrnhuter Brüdergemeine nach Schädeln anfragte und 1794 zwei human remains aus Labrador erhielt (Augustin 1997: 162). Sollte sich hier eine kontinuierliche Tradition des Sammelns und Handels von human remains etabliert haben, die bis ins 19. oder 20. Jahrhundert Bestand hatte und deren Spuren und geisterhaftes Auftauchen es zu entwirren gilt? Und wie weit gelingt es, auf der Grundlager kolonialer Quellen mit den Ansätzen postkolonialer Provenienzforschung und Feministischer und Postkolonialer STS Mqhayi aus dem Sammlungskontext zu lösen und zu re-individualisieren?
1 Die historische Analyse enthält diskriminierende und rassistische Terminologien aus Quellenzitaten; diese entsprechen nicht der Meinung der Autor*innen und intendieren keinerlei Herabsetzung historischer oder lebender Personen.
2 Für Informationen zur Transliteration des Namens, der gleichermaßen als Mqhayi oder Mkoyi wiedergegeben werden kann, danken wir Anne Mager und Jeff Peires.
3 Verzeichnis der Schädelsamml[ung], Privatarchiv [PBB].
* * *
 Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist in Heft 2023 unserer Zeitschrift FZG – Freiburger Zeitschrift für GeschlechterStudien erschienen.
Sie möchten gerne weiterlesen? Dieser Beitrag ist in Heft 2023 unserer Zeitschrift FZG – Freiburger Zeitschrift für GeschlechterStudien erschienen.
Mehr Leseproben …
… finden Sie auf unserem Blog.
© Unsplash 2023, Foto: Chelms Varthoumlien