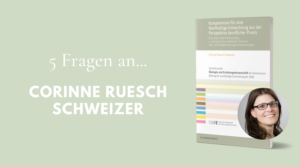Eine Leseprobe aus „Schreiben im Medizinstudium“ von Alexandra Fabisch – erschienen bei Budrich/utb.
***
Schreiben im Medizinstudium
Kapitel 5: Die medizinische Promotion
Sie haben geforscht, gerechnet und viel gelesen. Jetzt gilt es Ihr Wissen schriftlich festzuhalten. Dabei (Sie ahnen es schon) schreibt man nicht von oben links nach unten rechts, von vorn bis hinten in einem Rutsch durch. In der Regel gleicht das Schreiben eines akademischen Textes einer Puzzlearbeit. Und bis jedes Teil genau dort sitzt, wo Sie es haben wollen, braucht es Zeit, Geduld und viel Kaffee.
Als erstes (nach dem Kaffeekochen) nehmen wir uns die Grundstruktur vor, der eine wissenschaftliche Arbeit folgt. Die Einleitung macht den Anfang. Hier wird die Leserin in das Thema und die Fragestellung eingeführt. Danach folgt das Kapitel Material und Methoden, in dem Sie beschreiben, was Sie im Labor, auf der Station, im Archiv oder Leichenkeller gemacht haben. Nun kommt das Kernstück Ihrer Arbeit: der Ergebnisteil, der Ihre ausgewerteten Daten beherbergt. In der Diskussion erfolgt die Interpretation Ihrer Ergebnisse, der Bogen spannt sich zurück zur Fragestellung, Sie geben einen Ausblick auf den praktischen Nutzen Ihrer Arbeit. Für einen raschen Überblick sorgt die Zusammenfassung, die in der Kombination aus Kürze und Prägnanz recht knifflig zu verfassen ist.
Diese Einteilung finden Sie sowohl in medizinischen Promotionen wie auch in wissenschaftlichen Artikeln. Sie werden es sicher bei der Lektüre von Originalarbeiten bereits bemerkt haben.
Nun kennen Sie das Grundgerüst einer Dissertation. Doch wie geht es weiter, nachdem die Kapitelüberschriften gesetzt sind?
5.1 Material und Methoden
Viele Ratgeber (und ich auch, aus eigener Erfahrung) empfehlen, mit dem Methodenteil zu beginnen. Und zwar am besten bereits während man forscht. Man ist sowieso im Labor, kann nebenbei auf die Etiketten schauen, notieren (oder mit dem Handy abfotografieren), woher das Trinatriumcitratdihydrat kommt, und die MTA fragen, ob Sie einen Fehler in Ihrer Darstellung des Versuchsablaufs entdeckt. Sind Sie irgendwann im Praktischen Jahr am anderen Ende der Welt, haben Sie hoffentlich detaillierte Laborprotokolle in Ihren Koffer gepackt (vgl. Kapitel 4.2).
Doch was gehört nun in dieses Kapitel9? Kurz gesagt: Alles, was die Leserin wissen muss, um Ihre wissenschaftliche Arbeit nachvollziehen zu können, beziehungsweise was man bräuchte, um Ihren Versuch (oder Studie) zu wiederholen. Gern wird Material und Methoden mit einem Kochrezept verglichen, denn hier müssen alle „Zutaten“, deren Herkunft und der Ablauf der Forschungsarbeit aufgeführt werden.
Konkret bedeutet dies, dass unter Materialen die verwendeten Chemikalien (mit Angaben zu Hersteller, Ort und Land), Geräte, spezielle Software (inkl. der Versionsnummer), Zellen, Versuchstiere und Patientenmaterialen (Gewebetyp, Herkunft) aufgezeichnet werden.
Unter Methoden folgt dann die Beschreibung des Versuchsablaufs. Jeder Schritt, jede Einwirkzeit, jeder Mikroliter muss dabei notiert werden. Bei komplexen Versuchsanordnungen empfiehlt sich eventuell eine schematische Darstellung des Ablaufs. Bei neuen Methoden sollte die zugrundeliegende Theorie erklärt werden. Ist der Methode ein Paper gewidmet, können Sie darauf verweisen.
In der klinischen Forschung muss an dieser Stelle über das Patientenkollektiv berichtet werden. Die Ein- und Ausschlusskriterien gehören dazu, ebenso wie Rekrutierungszeitraum und -ort (teilnehmende Kliniken oder Praxen). Des Weiteren werden das Studiendesign sowie die Endpunkte der Studie erläutert. Die Interventionen müssen beschrieben werden, ebenso die Modalitäten der Datenerhebung.
Zuletzt folgt ein Abschnitt zur Statistik. Hier führen Sie auf, welche statistischen Tests Sie angewendet haben und mit welcher Software die Analysen durchgeführt wurden.
Wie Sie sich vielleicht denken können, ist die Informationsdichte in diesem Kapitel sehr hoch. Die Sprache ist sachlich-neutral, geschrieben wird im Präteritum. Um der Leserin die Orientierung zu erleichtern, können Zwischenüberschriften eingefügt werden. So könnte der Materialteil (2.1) beispielsweise in 2.1.1 Chemikalien, 2.1.2 Antikörper 2.1.3 Färbelösungen und 2.1.4 Geräte untergliedert werden.
Für ein besseres Verständnis, wie dieses Kapitel sowie die anderen Teile einer Promotion aussehen, sollten Sie bereits publizierte Forschungsarbeiten studieren, am besten solche, die ein ähnliches Thema wie die Ihre haben. Konsultieren Sie auch weiterführende Literatur. Viele Universitäten bieten Promotionsskripte an. Oder holen Sie sich Anregungen auf einschlägigen Webseiten – beispielsweise gibt es für randomisierte Studien Checklisten, nachzulesen unter www.consort-statement.org oder im BMJ publiziert von Schulz et al. (2010).
5.2 Ergebnisse
Nach dem Kapitel „Material und Methoden“ bietet es sich an, im nächsten Schritt den Ergebnisteil zu verfassen. Dafür sollte die Auswertung der Daten abgeschlossen sein. Im Idealfall haben Sie bereits während der statistischen Aufarbeitung aussagekräftige Sätze verfasst, haben sich dazu Gedanken gemacht, was Sie darstellen wollen und dementsprechend Tabellen, Grafiken und Fotos erstellt. Wenn nicht, sollten Sie das jetzt tun. Tragen Sie Ihre Ergebnisse zusammen, sortieren Sie sie nach Relevanz und überlegen Sie, was Sie davon in welcher Form präsentieren wollen (vgl. Kapitel 4.3). Nachdem Sie diese Vorarbeiten geleistet haben, bringen Sie Ihre Ergebnisse in eine sinnvolle Reihenfolge (Stichwort roter Faden). Überlegen Sie, wie Sie die Leserin durch Ihre Forschungsresultate führen wollen. Gab es Vorversuche, deren Ergebnisse relevant für das Hauptexperiment waren? Wollen Sie mit den wichtigsten Ergebnissen beginnen und danach interessante Nebenbefunde berichten? Oder die Leserin schrittweise zum entscheidenden Punkt bringen? Entlang welcher Logik Sie strukturieren, ergibt sich dabei manchmal aus den (aufeinander aufbauenden, voneinander abhängigen) Befunden selbst, überbleibt aber ein Stück weit auch Ihrem Geschmack.
Sollten Sie trotz aller Bemühungen doch in einem Zahlenwirrwarr enden, kann es wieder helfen, Zwischenüberschriften anzulegen, die Ihre Resultate in sinnvolle Abschnitte strukturieren.
Sobald Sie Ihre Befunde sortiert haben, können Sie die Daten in Fließtext einbetten. Nicht, dass es dafür viele Worte bräuchte. Sätze wie „entsprechend des TNM Schemas der UICC konnten 5 Fälle (12,2 %) dem Stadium T1, 24 Fälle (58,5 %) dem Stadium T2, 10 Fälle (24,4 %) dem Stadium T3 und 1 Fall (2,4 %) dem Stadium T4 zugeordnet werden“ verdeutlichen, wie hoch die Datendichte im Ergebnisteil ist. Umso wichtiger ist es, dass Ergebnisse, die grafisch aufbereitet wurden, nicht nochmals im Text in voller Detailtiefe präsentiert werden. Für den obigen Satz würde dies bedeuten: Haben Sie die TNM-Klassifikation bereits in einer Tabelle oder einem Diagramm zusammengefasst, taucht im Text nur noch der Hauptbefund auf („der Hauptanteil der Tumorfälle entfiel auf das Stadium T2“) mit einem Hinweis auf die entsprechende Abbildung (die dann alle weiteren Daten beherbergen sollte). Kurz gesagt: Achten Sie darauf, Redundanzen zu vermeiden. Es ist für die Leserin anstrengend genug, sich durch den Zahlendschungel zu wühlen.
Wenn Sie sich Ergebniskapitel von Beispielarbeiten ansehen, werden Sie Satzteile wie „konnte nachgewiesen werden“, „die statistische Analyse ergab“, „es fand sich“, „etwas zeigte sich“ oder „wies auf“, „war signifikant geringer (p<0,001)“ oder „betrug im arithmetischen Mittel irgendwas“. Der Sprachstil ist sachlich und nüchtern, berichtend. Da die Datenerhebung und die Analysen bereits gelaufen sind, wird auch hier im Präteritum geschrieben. Formulierungen wie „ich wies … nach“ sind eher unüblich. In der Regel fand sich irgendetwas, und nicht Sie fanden es.
Was ebenfalls nicht in den Ergebnisteil gehört sind Interpretationen der Daten. Auch Wertungen oder Schlussfolgerungen gehören hier nicht rein. Diese können Sie im nächsten Abschnitt Ihrer Promotion, der Diskussion, bringen.
___
9 Bei einer medizinischen Promotion sind Material und Methoden, ebenso wie die Einleitung, Ergebnisse und Diskussion, eigenständige Kapitel. In einem wissenschaftlichen Paper handelt es sich bei gleicher inhaltlicher Struktur jeweils um Abschnitte.
***
Sie möchten gern weiterlesen?
Jetzt „Schreiben im Medizinstudium“ versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
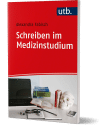
Schreiben im Studium, Band 10
Über „Schreiben im Medizinstudium“
Kompetent schreiben zu können ist unverzichtbar im medizinischen Alltag. Ärzt*innen müssen verschiedene Schriftsprachen beherrschen: in Forschung und Lehre, in der Kommunikation mit Kolleg*innen und Patient*innen. Komplexe Fragestellungen aus Klinik und Wissenschaft erschließen sich oft erst in der schriftlichen Analyse. Schreiben ist eine Schlüsselkompetenz, die hilft, strukturierter zu denken, klarer zu kommunizieren und Fachwissen fester zu verankern. Dieser Band behandelt medizinische Schreibaufgaben wie Promotion und Arztbrief und bietet Strategien zu deren Bewältigung.
Mehr Leseproben …
… finden Sie auf unserem Blog.
© Unsplash 2023 / Foto: National Cancer Institute