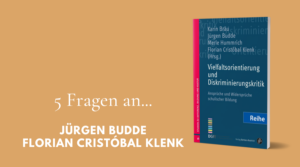Wie erkennt man naturwissenschaftliche Begabung bei Schüler*innen und wie kann sie gezielt gefördert werden? Eine Leseprobe aus Naturwissenschaftliche Begabung: Diagnostik und Förderung. Ein Praxisleitfaden für Lehramtsstudierende und Lehrkräfte von Claas Wegner, Maria Sophie Schäfers, Colin Peperkorn, Alena Schulte und Finja Rath (Hrsg.).
***
Naturwissenschaftliche Begabung, Kapitel 1: Was ist Begabung?
Sicher hat jede:r von uns schon von außergewöhnlich begabten Menschen gehört. Serien- und Filmcharakteren wird in einigen Drehbüchern eine hohe Begabung zugeschrieben, wie dem Physiker „Sheldon Cooper“ aus der Serie „The Big Bang Theory“, das Mädchen „Mary“ aus dem Film „Gifted“ (deutscher Titel: Begabt) oder der autistische Bruder „Raymond“ aus dem Film „Rain Man“. In solchen Rollen geht die Begabung des fiktiven Charakters häufig mit Schwierigkeiten im Verhalten, der Wahrnehmung oder der Kommunikation mit anderen Personen einher. Darüber hinaus kennt jede:r von uns Genies, die auf ihrem Gebiet wahre Meisterwerke schaffen, oder Talente, die uns mit ihrem außergewöhnlichen Können verblüffen. Aber was genau verbirgt sich hinter diesen bemerkenswerten Fähigkeiten? Sind Begabungen auf bestimmte Bereiche beschränkt, wie Musik, Sport oder Naturwissenschaften? Gehen Begabungen immer mit einem von der Norm abweichenden Verhalten in anderen Bereichen einher? Welche Möglichkeiten gibt es, eine Begabung zu erkennen? Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass begabte Menschen schon immer Bewunderung und Neugierde geweckt haben. Leonardo da Vinci, ein Genie mit beeindruckenden Fähigkeiten in der Kunst, oder Albert Einstein, dessen Ideen das Verständnis der Physik revolutionierten – sie alle hinterlassen uns mit dem Gefühl, dass Begabung etwas Außergewöhnliches ist.
Begabung ist somit ein faszinierendes und häufig stark diskutiertes Thema, das zum Nachdenken anregt und aus der Bildungslandschaft nicht mehr wegzudenken ist. Was macht eine Person zu einer begabten? Sind Begabungen angeboren oder formen sie sich erst im Laufe des Lebens? Ist die Begabung das Ergebnis harter Arbeit oder doch vielmehr unbeeinflussbarer Veranlagung? Was unterscheidet eine Begabung von einem Talent oder Intelligenz? Wie hängen die Begabung und die Kompetenzen von Personen zusammen? Wie kann Begabung gefördert werden? Diese und weitere Fragen werden im Folgenden genauer fokussiert.
1.1 Grundbegriffe der Begabungsforschung
Als Reaktion auf die uneinheitliche Definition von Begabung und die vielen verschiedenen Definitionsansätze versuchte Leonard J. Lucito bereits 1963 diese in fünf Kategorien einzuordnen und damit eine Übersicht zu schaffen. Die erste Kategorie nannte er „ex post facto definitions“ (S. 182), womit er Definitionen zusammenfasste, die Begabung als herausragende Leistungen in einem professionellen bzw. beruflichen Bereich beschreiben. Die Bezeichnung leitet sich also aus der retrospektiven Betrachtung von Begabung ab, die aus didaktischer Sicht wenig aufschlussreich ist, da diese in der Regel erst nach der Schulkarriere beobachtet werden kann (Lucito, 1963). Als zweite Kategorie beschreibt er die IQ-Definitionen, welche Begabung ab einem bestimmten IQ-Wert definieren, wobei zwischen den gewählten Testinstrumenten und der Höhe des cutoff-Wertes variiert wird. Die dritte Kategorie wird als Soziale Definitionen bezeichnet, welche Begabung als Leistung in einem gesellschaftlich anerkannten Bereich bezeichnen (u. a. Witty, 1958; iPEGE, 2009). Die vierte Kategorie fasst die Prozentsatz- Definitionen zusammen, welche eine Person als begabt identifizieren, sobald sie in einem spezifischen Merkmal, beispielsweise dem IQ, zum oberen Prozentsatz (üblicherweise 15-20 Prozent) einer Gesamtstichprobe gehören. Die fünfte Kategorie bezieht sich auf Kreativitäts-Definitionen und fasst Definitionen zusammen, die Kreativität als auschlaggebendes Merkmal für Begabung definieren. Bei genauerer Betrachtung der Kategorien wird deutlich, dass die zweite und fünfte Kategorie Spezialfälle der vierten Kategorie bilden, wobei entweder der IQ oder die Kreativität als spezifisches Merkmal angeführt werden (Rost, 2013).
Für eine fundierte und wissenschaftlich anerkannte Auseinandersetzung mit der Begabungsforschung und -förderung in den Naturwissenschaften ist es jedoch von grundlegender Bedeutung, zunächst die relevanten Begriffe, wie Kompetenz, Intelligenz und Kreativität, in diesem Fachbereich zu definieren. Dies trägt sowohl zum Verständnis als auch zur Einordnung des Themas in den wissenschaftlichen Diskurs bei und legt den Grundstein für eine präzise und differenzierte Betrachtung der Begabungen in den Naturwissenschaften.
1.1.1 (Naturwissenschaftliche) Kompetenz
Der Begriff Kompetenz stammt von dem lateinischen Ursprung competencia ab, was so viel bedeutet wie zu etwas geeignet, fähig oder befugt sein (North et al., 2018). Bereits in den 1970er Jahren etablierte sich dieser Begriff nicht zuletzt durch die Prägung des Linguisten Chomsky zu einer Schlüsselqualifikation (Kaufhold, 2006; Mertens, 1974), welche u. a. den kompetenten Umgang mit und die Anwendung von Wissen im Bildungsbereich eines Individuums beschreibt. Damit ergänzte und ersetzte dieser Begriff in einigen Bereichen den Qualifikationsbegriff, welcher objektive Ansprüche und Bedarfe, z. B. im Arbeits- und Berufsleben, aber auch in der Lebensgestaltung und Entwicklung fokussiert (Weiß, 2018). Seit der Einführung der kompetenzorientierten Bildungspläne in Deutschland (Künzli, 2010) hat sich die Bedeutung der Kompetenzförderung im deutschen Schulsystem manifestiert. So bedeutungsstark und relevant der Begriff „Kompetenz“ für viele Fachbereiche und Branchen zu sein scheint, so schwierig ist jedoch die Aufstellung einer einheitlichen und allgemeingültigen Definition dieses Begriffs (Erpenbeck & Rosenstiel, 2003). Eine vielseits anerkannte Begriffserklärung besonders in der Psychologie, Bildungsforschung und Erziehungswissenschaft bildet der Kompetenzbegriff nach Weinert (2001a), welchen er in einem Gutachten für die OECD aufstellte. Er beschreibt Kompetenz als …
„[…] die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernten kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert, 2001a, S. 27f.).
Daraus gehen drei Charakteristika von Kompetenz hervor, die für das Verständnis und die Anwendung des Begriffs von großer Bedeutung sind:
- Die „um […]“-Formulierung von Weinert (2001a) zeigt an, dass Kompetenzen nicht losgelöst von dem Kontext zu verstehen sind, sondern einen Zweck erfüllen und somit zielgerichtet sind. Daher geht die Definition von Weinert (2001a) über das reine, reproduzierbare Wissen hinaus, indem Kompetenzen immer einen Anwendungsbezug verfolgen.
- Durch die Nutzung der Begriffe „kognitive Fähigkeiten“, „Fertigkeiten“ und „Bereitschaften“ zeigt Weinert (2001a) in seiner Definition an, dass Kompetenzen demnach ein Zusammenschluss aus dem Wissen, der Anwendung und der Einstellung dem Problem oder der Aufgabe gegenüber sind. Dies impliziert, dass Kompetenzen subjektiv für jede Person zu beschreiben sind, da sich das handlungsorientierte Können sowie die Werte der Personen voneinander unterscheiden und somit auch die Kompetenzen beeinflussen. Soll dennoch einer der Faktoren stärker in den Fokus gestellt werden, wie z. B. das Wissen, dann kann in Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz unterschieden werden (Euler, 2020).
- Indem Weinert (2001a) in seiner Definition mit „[…] zu können“ formuliert, zeigt er für die Erfassung und Messung von Kompetenz ein grundlegendes Problem auf: wenn eine Person eine bestimmte Kompetenz besitzt, dann bedeutet dies nicht automatisch, dass diese jederzeit abrufbar ist oder gezeigt wird. Es handelt sich lediglich um das Potenzial, etwas durchführen zu können. Die Umsetzung der Aufgabe oder die Lösung des Problems muss jedoch nicht zwangsweise erfolgen. Damit kann eine Kompetenz-Performanz-Problematik einhergehen, da eine „Diskrepanz zwischen dem latent vorhandenen Leistungspotential (Kompetenz) und dem aktuell beobachtbaren Leistungsvollzug (Performanz) einer Person“ (Böhmig- Krumhaar, 1998, S. 27) vorherrschen kann.
***
Sie möchten gern weiterlesen?
Jetzt versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
 Claas Wegner, Maria Sophie Schäfers, Colin Peperkorn, Alena Schulte, Finja Rath:
Claas Wegner, Maria Sophie Schäfers, Colin Peperkorn, Alena Schulte, Finja Rath:
Die Herausgeber*innen
- Prof. Dr. Claas Wegner, Leitung des Osthushenrich-Zentrums für Hochbegabungsforschung an der Fakultät für Biologie der Universität Bielefeld (OZHB)
- Dr. Maria Sophie Schäfers, wissenschaftliche Mitarbeiterin im OZHB
- Colin Peperkorn, wissenschaftlicher Mitarbeiter im OZHB
- Dr. Alena Schulte, wissenschaftliche Mitarbeiterin im OZHB
- Finja Rath, wissenschaftliche Mitarbeiterin im OZHB
Über „Naturwissenschaftliche Begabung: Diagnostik und Förderung“
Wie erkennt man naturwissenschaftliche Begabung bei Schüler*innen? Wie kann sie gezielt gefördert werden? Diese Fragen behandeln die Autor*innen in diesem Buch eingehend für alle Akteur*innen des Bildungssystems, inklusive angehenden Lehrpersonen. Sie thematisieren dabei nicht nur fachdidaktische und theoretische Zugänge, sondern liefern konkrete Umsetzungsansätze für die Arbeit mit naturwissenschaftlich begabten Schüler*innen am Beispiel des Biologieunterrichts.
Mehr Leseproben …
… finden Sie auf unserem Blog.
© Titelbild gestaltet mit canva.com