von Katharina Resch
Über das Buch
Jede Schule ist aufgefordert, sich mit Inklusion auseinanderzusetzen, aber was bedeutet dies für die einzelne Lehrkraft? Das Buch bietet einen fundierten Einblick in aktuelle Problemlagen des Inklusionsanspruchs und der Inklusionsrealität mit den Schwerpunkten Kinderrechte, Anti-Diskriminierung, Bildungsgerechtigkeit, Anerkennung und pädagogische Fürsorgepflicht. Es bietet Lehrpersonen eine Orientierung und praktischen Fallbeispiele, Diskussionsfragen und Übungen, die direkt im Unterricht angewendet werden können.
Leseprobe aus den Seiten 80 bis 85
***
5.2 Folgen von Diskriminierung in der Schule
Die Folgen von Diskriminierung in der Schule können Gefühle von Fremdheit, Sprachlosigkeit, Konflikte oder Orientierungslosigkeit angesichts der Diskriminierung darstellen (von Hentig 2012). Oftmals sind (kulturelle) Fehlinformationen oder mangelndes Hintergrundwissen die Ursache für unbeabsichtigte Diskriminierung. In vielen Fällen erleben Personen, die von diskriminierendem Verhalten betroffen sind, ein nicht weiter zu benennendes Unbehagen, weil oft keine direkte Diskriminierung stattfindet, sondern lediglich subtile Bemerkungen gemacht werden. Diskriminierendes Verhalten zwischen Schüler*innen bzw. zwischen Schüler*innen und Lehrpersonen kann jedenfalls zu Konflikten in der Klasse führen:
- Interpersonelle Konflikte: Interpersonelle Konflikte finden zwischen zwei Schüler*innen statt (Neubauer 2017). Das Verhalten des einen Schülers oder der einen Schülerin behindert, blockiert oder stört das Verhalten des jeweils anderen, was zu negativen Gefühle führt und die freundschaftliche Beziehung belastet.
- Gruppenkonflikte: Konflikte und diskriminierendes Verhalten können zudem Gruppenkonflikte innerhalb einer Klassengemeinschaft, des Kollegiums, einer Lerngruppe oder einer Sportgruppe zur Folge haben (Resch 2021).
- Unterrichtsstörungen: Diskriminierendes Verhalten kann zu Konflikten innerhalb der Schüler*innenschaft führen, der innerhalb der Klasse vom Unterricht ablenkt. Dies kann störendes verbales Verhalten, das Werfen von Gegenständen oder das Beleidigen oder Hänseln von anderen Schüler* innen beinhalten (Schönbächler et al. 2009).
- Intrapersonelle Konflikte: Zuletzt können auch innere oder seelische Konflikte auftreten, die Schüler*innen, die von Diskriminierung betroffen sind, im inneren Dialog austragen und zu einem sozialen oder emotionalen Rückzug der Schüler*innen aus der Klassengemeinschaft führen können (Zaharna 1989). Häufig werden Abwertungserfahrungen, die diese Schüler*innen im Zuge von Diskriminierung erfahren, internalisiert.
5.3 Fallbeispiel „In welche Schule soll Leonie gehen?“
Ein Fallbeispiel für institutionelle Diskriminierung folgt in diesem Kapitel.
Leonie ist sechs Jahre alt und soll zum nächsten Schuljahr eingeschult werden. Das Besondere an ihr ist, dass sie ein Drilling mit Downsyndrom ist. Sie wird von ihrer Familie als ein glückliches, offenes, freundliches und hilfsbereites Kind beschrieben. Ihre Sprachentwicklung ist durch eine Muskelhypotonie beeinträchtigt und dennoch findet sie immer Wege, um mit ihrer Umwelt zu kommunizieren. Leonie ist bewegungsaktiv, läuft und springt viel herum. Mehrmals pro Woche erhält sie außerschulisch Logo- und Ergotherapie zur Förderung ihre Sprachentwicklung und Motorik. Ihre Geschwister haben keine Behinderungen und werden zum nächsten Schuljahr die nächstgelegene Volksschule im Nachbarort besuchen. Die Drillinge haben eine gute Beziehung zueinander. Zusätzlich zu ihren Drillingsgeschwistern hat Leonie noch zwei ältere Schwestern im Teenageralter. Ihre Eltern kommen aus Osteuropa und sind nach Deutschland immigriert. Sie sprechen gutes Deutsch. Die Kinder wachsen nicht bilingual auf, da sie Leonie nicht überfordern wollen. Nun stellen sich die Eltern die Frage, welche Schule für ihre Tochter Leonie die beste wäre. Da Leonie einen Regelkindergarten besucht, können die dort arbeitenden Pädagog*innen der Familie nur wenig beratend zur Seite stehen, da sie über inklusive Beschulung kaum Vorwissen haben.
Für die Familie kommen drei Schulen in Frage:
- Als Erstes steht die Regelvolksschule zur Auswahl, die auch Leonies Drillingsgeschwister besuchen werden. Diese Schule liegt im Nachbarort und ist somit auch die Schule für alle anderen Vorschulkinder des Kindergartens. Demnach würde Leonie schon einen Teil ihrer Klasse kennen und würde mit ihren Geschwistern gemeinsam beschult werden, was ihr eine gewisse Sicherheit im schulischen Alltag geben würde. Somit sind jedoch keine weiteren beeinträchtigten Kinder auf dieser Schule, mit denen sich Leonie identifizieren könnte. Die Schule müsste der Aufnahme von Leonie explizit zustimmen, da keine Verpflichtung besteht, sie dort zu beschulen. Dazu müsste extra für sie eine Förderkraft eingestellt werden, da diese Schule normalerweise nicht explizit integrativ bzw. inklusiv arbeitet.
- Als Zweites gibt es eine Schwerpunktschule, die 15 Minuten Autofahrt vom Wohnort der Familie entfernt liegt. Dort würde Leonie niemanden kennen, würde aber mit weiteren beeinträchtigten Kindern inklusiv beschult werden. Die Schule wäre für ihre Bedürfnisse ausgestattet und sie würde für eine optimale Förderung eine Integrationskraft zur Unterstützung bekommen. Zudem käme sie zum ersten Mal mit weiteren beeinträchtigten Kindern in Kontakt.
- Als Drittes steht noch eine Sonderschule für ganzheitliche Entwicklung zur Auswahl, die für Leonie einen geeigneten Schonraum darstellen könnte und verpflichtet wäre, sie zu beschulen. Durch die kleinen Klassen und die gute Besetzung durch ausgebildete Lehr- und Förderkräfte würde sie bestmöglich gefördert werden. Außerdem käme sie zum ersten Mal mit weiteren Kindern mit Downsyndrom in Kontakt. Die Schule liegt jedoch 40 Minuten vom Wohnort der Familie entfernt und kann nur mit dem Auto erreicht werden. Somit würde Leonie aus ihrem bekannten Umfeld gerissen werden und müsste jeden Tag eine weite Fahrt auf sich nehmen, was im Familiengefüge zu vermehrtem Stress führen würde oder ein Fahrtdienst genutzt werden müsste.
5.4 Diskussion des Fallbeispiels
Diskussion in Kleingruppen: Die Schüler*innen oder Studierenden lesen das Fallbeispiel in Kleingruppen und beantworten anschließend die Diskussionsfragen. Die Fragen müssen auf die jeweilige Lerngruppe zugeschnitten und adaptiert werden.
Diskussionsfragen:
- Welche Vorteile und Nachteile ergeben sich bei der Wahl der drei Schulen? Erstellen Sie eine Liste.
- Für welche Beschulung würden Sie sich entscheiden und warum? Welche persönliche Haltung zu Inklusion steckt hinter dieser Entscheidung? (s.u.)
- Angenommen, die Regelvolksschule im Nachbarort lehnt Leonies Einschulung ab, würde dann eine Form der institutionellen Diskriminierung vorliegen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
Die Beschulung von Kindern mit Downsyndrom erfolgte bereits in den 1970er Jahren durch erste integrative Schulversuche. Schüler*innen mit Downsyndrom bilden eine heterogene Gruppe, daher ist die individuelle Abklärung des Förderbedarfs vor der Entscheidung über eine Beschulung wichtig. Relevante Entscheidungskriterien sind etwa die Form der Trisomie, mögliche zusätzliche Beeinträchtigungen, Geschlecht, Aktivitätsniveau, Neugierde und Ausdauer des Kindes, voraussichtliche soziale Akzeptanz des Kindes, schulische Lernbedingungen und allgemeine kognitive, soziale und emotionale Grundbedingungen. Bei einer Entscheidung für eine bestimmte Form der Beschulung spielen die Einstellungen der Eltern bzw. der Lehrpersonen eine entscheidende Rolle. Diese können am Beispiel von Leonies Schultypentscheidung aufgezeigt werden: Wenn eine segregative Haltung vorliegt, dann werden die Vorteile der Sonderschule für Leonie herausgestrichen, die Ausbildung der dort tätigen Lehrpersonen und das dort mögliche besondere Eingehen auf Leonies Bedürfnisse. Eventuell spielt bei einer segregativen Haltung ein medizinisch-orientiertes Verständnis von Behinderung mit (Zinsmeister 2016). Bei einer fürsorglich-helfenden Haltung stünde die Schule im Vordergrund, die besser auf die Bedürfnisse von Leonie eingehen kann bzw. in der die familiäre Unterstützung durch Eltern und Geschwister am besten gegeben wäre. Steht das Lernen im Vordergrund, so könnte eine individuell-differenzierende Haltung dazu beitragen, die Sonderschule oder zumindest die Schwerpunktschule zu wählen, da Leonie in diesen Schultypen von einer Lehrkraft gefördert wird, die häufig mit Kindern mit Downsyndrom lernt. In einer ideologischen Haltung für Inklusion würde jede Form der Beschulung, die zwischen Kindern mit und ohne Behinderungen trennt, abgelehnt werden. In einer solchen Haltung kommt nur die Regelschule in Frage. Bei einer ganzheitlichen Haltung würden verschiedene Aspekte von Leonies Situation abgewogen werden, etwa die Form der Beschulung, die Anfahrtszeit oder die soziale Eingebundenheit von Leonie. Zuletzt könnte man eine rein pragmatische Haltung an den Tag legen und nach der Anfahrtszeit, der dadurch entstehenden Belastung in der Familie oder finanziellen Aspekten entscheiden.
Ein medizinisch-defizitorientiertes Verständnis von Behinderung würde eine separate Beschulung von Leonie vorsehen:
„Es versteht unter einer Behinderung eine körperliche, intellektuelle oder psychische Abweichung von der ableistischen Norm eines Menschen, die mit der Einschränkung seiner Handlungsmöglichkeiten einhergeht und ihn an der Wahrnehmung seiner Menschenrechte und in seiner gesellschaftlichen Teilhabe behindert.“ (Zinsmeister 2016, S. 4).
Leonies Behinderung würde in diesem Verständnis als Beeinträchtigung wahrgenommen werden, die durch die medizinische Diagnose festgestellt wurde und somit Ausgangspunkt für ihre weitere Bildungs- und Schullaufbahn darstellt. Dabei geht die Diagnose stets von einem angenommenen „Normalzustand“ gesunder Menschen aus: die ableistische Norm (Müller 2018, S. 24). Mediziner*innen kommt durch dieses Modell automatisch eine Machtposition zu, da sie Behinderungen benennen und eine Person der Kategorie „behindert“ zuschreiben können.
„Durch Diskriminierung erfolgen soziale Positionszuweisungen, die Beziehungen zwischen Mehrheit und Minderheiten, Mächtigen und Machtunterworfenen, ökonomisch Privilegierten und Benachteiligten, Etablierten und Außenseitern, Einheimischen und Fremden, Normalen und Abweichenden hervorgebracht bzw. aufrechterhalten.“ (Scherr 2011, S. 36).
Die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung von Menschen mit Behinderungen äußerte bereits in den 1970er Jahren im deutschsprachigen Raum erstmals Kritik am medizinischen Modell und identifizierte sich mit einem sozialen Modell von Behinderung als Gegenentwurf. Aus dem Blickwinkel des sozialen Modells sind Menschen nicht behindert, sondern werden behindert (Lindmeier & Lindmeier 2012; Zinsmeister 2016). Leonie ist die Kategorie „Behinderung“ zugeschrieben worden. Damit ist die Chancengleichheit zwischen ihr und ihren Geschwistern nicht mehr gegeben. Eine Behinderung zu benennen und somit eine Person der Kategorie „behindert“ zuzuschreiben, entspricht dem medizinischen Modell (Müller 2018), das per se Chancengerechtigkeit und Inklusion verhindert.
„Gesellschaftliche Barrieren sind zu Strukturen geronnene Diskriminierungen, durch die die Betroffenen absichtlich oder – wahrscheinlich viel öfter – unabsichtlich ausgegrenzt werden. U-Bahnschächte ohne Fahrstühle, Bücherregale, die von einem Rollstuhl aus unerreichbar sind, Witze über geistig Behinderte, das fast totale Fehlen von Gebärdendolmetschern in der Universität und zahlreiche andere Barrieren vermitteln Behinderten alltäglich die Botschaft, dass sie nicht dazugehören und dass man ihr kreatives Potenzial nicht wahrnimmt.“ (Bielefeldt 2010, S. 28).
Leonie ist keiner direkten Diskriminierung ausgesetzt, da ihre Familie und die Lehrpersonen das Beste für sie im Sinne haben. Neben direkten Diskriminierungsformen gibt es zahlreiche institutionelle und strukturelle Diskriminierungen (Bielefeldt 2010, S. 30).
„Institutionelle Diskriminierung bezeichnet Strukturen und Praktiken von Organisationen (Schulen, Betrieben, Sozialämtern usw.), die auch ohne Absicht zur Benachteiligung derer führen, die dort handeln, und die auch nicht durch individuelle Vorurteile von Organisationsmitgliedern erklärbar sind.“ (Scherr 2011, S. 36).
Diese Form der Diskriminierung kann dementsprechend nicht auf einzelne Personen zurückgeführt werden, sondern beschreibt äußere Umstände, die diskriminierend wirken (Gomolla & Radtke 2009). Bei Leonie erfolgt eine Positionszuweisung: „Du gehörst an eine andere Schule.“ Diese Positionszuweisung kann zu sozialem Ausschluss führen. Durch die Konstruktion von Behinderung und Normalität werden gesellschaftliche Machtverhältnisse hergestellt, die sich im Alltag von Menschen mit Behinderungen einfach reproduzieren (Köbsell 2015). Dadurch werden der Ableismus und seine Auswirkungen oftmals nicht (mehr) wahrgenommen, so verinnerlicht sind die zugeschriebenen gesellschaftlichen Positionen.
Gerade Schüler*innen mit Behinderungen sind in ihrem Alltag oftmals besonders von Institutionen und deren Unterstützungsstrukturen abhängig. Leonie ist von schulischen Institutionen, die ihren Lebensweg, ihre Sozialkontakte und letztlich ihre Berufschancen prägen, abhängig. Dementsprechend machen sie auch vielfältige Erfahrungen mit institutioneller Diskriminierung, wie etwa Leonie, wenn die Regelvolksschule sie ablehnt.
Das Ziel der UN-BRK ist die menschenrechtlich begründete volle und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen inklusive einer gleichberechtigten Teilnahme am Schulwesen und dem Postulat der Anti-Diskriminierung. Es verpflichtet die Vertragsstaaten u. a. dazu, Diskriminierung aufgrund von Behinderungen zu verbieten und Menschen mit Behinderungen rechtlichen Schutz vor Diskriminierung zu gewährleisten (Abschnitt 2.2). Daraus folgt, dass niemand aufgrund seiner Behinderung aus dem allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden darf, da einer der Grundpfeiler der Kinderrechte das Recht auf Bildung und Entwicklung darstellt. Das bedeutet wiederum, dass Kinder wie Leonie jede Schule besuchen dürfen, egal ob diese integrativ bzw. inklusiv arbeitet oder nicht. Als Ziel eines inklusiven Schulsystems gilt die gemeinsame Beschulung aller Kinder in einem differenzierten Unterricht.
***
Sie möchten gern weiterlesen?
Jetzt versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
© Titelbild: gestaltet mit canva.com


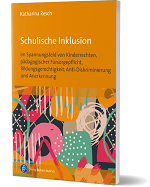 Katharina Resch:
Katharina Resch: