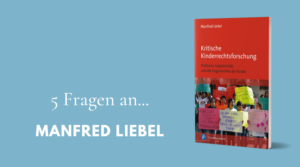Politische Subjektivität und die Gegenrechte der Kinder
von Manfred Liebel
Über das Buch
Manfred Liebel beleuchtet die Debatte und Forschung zu Kinderrechten. Er macht auf Themen aufmerksam, die bisher vernachlässigt wurden, und skizziert neue Konturen und ethische ebenso wie politische Herausforderungen einer kritischen Kinderrechtsforschung, die sich den Kindern als sozialen Subjekten verpflichtet sieht. Der Autor greift hierzu Diskussionen auf, die im Globalen Süden, insbesondere in Lateinamerika, geführt werden.
Leseprobe aus den Seiten 23 bis 28
***
1 Kinderrechte und die Perspektiven des Subjekts
1.1 Einleitung
Unter denjenigen, die Kinderrechte für eine wichtige Errungenschaft halten und sich für sie einsetzen, besteht Übereinstimmung, dass Kinder als Subjekte zu achten und ernst zu nehmen sind. Dabei geht es nicht nur um das Subjekt im rechtlichen, sondern auch im soziologischen und psychologischen Sinn. Aus der Anerkennung der Kinder als Subjekte ergibt sich die Schlussfolgerung, nicht das zu betonen, was Kinder noch nicht können, sondern den Blick auf ihre bereits vorhandenen oder entstehenden Fähigkeiten zum eigenen Urteil und selbstbestimmtem Handeln zu richten. Der Begriff des Subjekts ist also für die Kinderrechtspraxis unverzichtbar. Aber ich finde es auch wichtig, auf einige blinde Flecken und Probleme aufmerksam zu machen, die mit ihm verbunden sind. Diese erschließen sich nicht aus dem Begriff selbst, sondern erst in einer genaueren Analyse der gesellschaftlichen Kontexte und Lebenslagen, in denen sich Kinder befinden. In diesem Sinn werde ich mit Blick auf Kinder und ihre Rechte den Begriff des Subjekts genauer beleuchten und mit einigen Überlegungen zu seinen Ambivalenzen und Paradoxien sowie möglichen Erweiterungen und Konkretisierungen verbinden.
1.2 Das Kind als Rechtssubjekt
Im Kinderrechtsdiskurs hat der Begriff des Subjekts eine zentrale und durchweg positive Bedeutung. Er dient dazu, Kindern einen eigenen rechtlichen und sozialen Status zuzuschreiben, der von der Gesellschaft zu respektieren ist. Indem Kinder als Rechtssubjekte oder Subjekte eigenen Rechts bezeichnet werden, wird unterstrichen, dass sie nicht auf das Wohlwollen von Personen angewiesen sind, die mehr Macht haben als sie und Macht über sie ausüben, sondern dass diese Personen ebenso wie der Staat rechtlich und moralisch verpflichtet sind, Kinder als Personen mit eigener Würde zu achten. Als international verbürgte Menschenrechte sind Kinderrechte gleichermaßen objektive und subjektive Rechte. Mit dem Verweis auf objektive Rechte werden die Verpflichtungen der Gesellschaft oder des Staats gegenüber den Kindern betont; mit dem Verweis auf subjektive Rechte wird hervorgehoben, dass Kinder selbst ihre Rechte einfordern und in Anspruch nehmen können. Die Annahme, dass Kinderrechte nicht nur als objektive, sondern auch als subjektive Rechte zu verstehen sind, geht mit der Annahme einher, dass Kinder als soziale Subjekte auch über Eigenschaften verfügen, die sie in die Lage versetzen, ihre Rechte zu erkennen, einzufordern und auszuüben. Die Gesellschaften sind verpflichtet, diese Fähigkeiten anzuerkennen und zu fördern.
Ich bin der Auffassung, dass es notwendig ist, Kinderrechte in diesem Sinn nicht nur als objektive, sondern auch als subjektive Rechte zu verstehen. Geschieht dies nicht, bleibt die Rede von Kinderrechten hohl, denn faktisch führt dies dazu, dass Erwachsene oder staatliche Institutionen sich das Monopol vorbehalten, besser als die Kinder zu wissen, was für sie angemessen und gut ist oder ihrem „Wohl“ oder „besten Interesse“ entspricht (vgl. Archard 2015, S. 112 ff.). Sie handeln dann zwar im Namen der Kinderrechte, aber die Inhaber* innen dieser Rechte bleiben außen vor und haben „nichts zu sagen“. Der oft erhobene Einwand, Kinder müssten erst die nötigen Fähigkeiten entwickeln, bevor sie ihre Rechte verstehen und von ihnen Gebrauch machen können, trägt nicht. Sehr junge Kinder haben gewiss noch kein explizites Verständnis von „Rechten“, aber sie erlangen schon früh ein Gefühl dafür, was gut für sie und was gerecht ist (vgl. Liebel 2017; 2013a, S. 117 ff.). Kinder lernen nur dann, mit ihren Rechten umzugehen und sie zu schätzen, wenn sie die Erfahrung machen können, dass Erwachsene sie als Subjekte achten und ihnen Gelegenheit geben, ihre Rechte im eigenen individuellen und kollektiven Interesse zu nutzen. Zum Verständnis des subjektiven Charakters der Kinderrechte gehört deshalb, dass Erwachsene sich bemühen, die Sichtweisen der Kinder zu verstehen und den Kindern die notwendigen Bedingungen zu verschaffen, die es ihnen erlauben, den Sinn eigener Rechte zu erkennen und sie letztlich auch einzufordern und in Anspruch zu nehmen.
Allerdings ist auch zu bedenken, dass es nicht ausreicht und sogar problematische Folgen haben kann, Kinder ausschließlich als Rechtssubjekte zu verstehen. Wie ich zeigen werde, wird In der rechtsphilosophischen und rechtssoziologischen Diskussion immer wieder darauf hingewiesen, dass mit der historisch entstandenen Figur subjektiver Rechte manche Probleme verbunden sind. Eines dieser Probleme besteht darin, dass die Vorstellung menschlicher Beziehungen als Rechtsverhältnisse die Menschen einander entfremdet, da in ihnen individuelle Interessen dominieren, die anderen gegenüber beansprucht werden.
Einen Menschen nur als Rechtssubjekt zu verstehen, bedeutet, seine Qualitäten als Mensch auf rechtliche Aspekte zu reduzieren. Unter diesen Aspekten wird der Mensch einerseits als Person gesehen, die bestimmten gesetzten Regeln (Gesetze, durch den Staat kodifizierte Normen) verpflichtet oder gar unterworfen ist, andererseits als Person, die anderen Personen oder Institutionen gegenüber Ansprüche hat und diese einfordern kann. In jedem Fall bedeutet die Beziehung zwischen der Person und anderen Personen oder staatlichen Institutionen eine Reduktion des menschlichen Lebens und Zusammenlebens auf Fragen des Gehorchens oder Forderns. Sie macht es schwer, sich Beziehungen der Liebe, Freundschaft oder Solidarität vorzustellen, und kann somit zu einer Verarmung der menschlichen Beziehungen beitragen.
Bei dem Versuch, eigene Rechte in Anspruch zu nehmen, werden gerade diejenigen, die marginalisiert sind und deren Rechte massiv verletzt werden, genötigt, von ihre konkreten Alltagserfahrungen zu abstrahieren und sich auf ein Terrain zu begeben, auf dem sie zuvor schon benachteiligt waren. Dies gilt allemal für Kinder. Der Sozialphilosoph Daniel Loick (2017) bezeichnet ein solches Rechtsdenken als „Juridismus“1 und plädiert ebenso wie andere Kritiker* innen des mit der bürgerlichen Gesellschaft entstandenen „Schemas subjektiver Rechte“ (Fischer-Lescano 2018, S. 378) dafür, die dem Individuum zugeschriebenen Rechte in „soziale und politische Gegenrechte“ (Mencke 2018) zu „transformieren“ und zu einem „postjuridischen Recht“ (Loick 2017, S. 22) zu gelangen.2 Um emanzipatorische Bedeutung zu erlangen, müssten „die atomisierenden und disziplinarischen Momente des Rechts“ (a.a.O., S. 181) zurückgedrängt oder neutralisiert werden.
Die Sozialphilosophin Wendy Brown weist aus feministischer Perspektive darauf hin, dass die Berufung von Frauen auf subjektive Rechte oder die Forderung nach „Gleichberechtigung“ zu Paradoxien führen kann.
Rechte sichern unsere Geltung als Individuen, verschleiern zugleich aber die tückischen Wege, auf denen diese Geltung erlangt und reglementiert wird. Sie müssen spezifisch und konkret sein, um die Unterordnung von Frauen sichtbar zu machen und ihr Abhilfe zu schaffen, können aber durch diese Bestimmtheit unsere Unterordnung befestigen. Sie versprechen eine Steigerung individueller Souveränität, aber um den Preis einer Verstärkung der Fiktion souveräner Subjekte. Sie emanzipieren uns und ermöglichen uns so, andere politische Ziele zu verfolgen, unterwerfen diese politischen Ziele aber zugleich dem liberalen Diskurs. Sie bewegen sich in einem übergeschichtlichen Register, obwohl sie aus spezifischen geschichtlichen Umständen erwachsen. Sie versprechen, unserem Leiden als Frauen Abhilfe zu schaffen, tun dies aber nur, indem sie dieses Leiden – und uns – in einzelne Bestandteile aufsplittern, eine Aufsplitterung, die einem Leben, das bereits durch die Verflechtung der Mächte von Rasse, Klasse, Sexualität und Gender verletzt ist, weitere Verletzungen zufügt (Brown 2011, S. 469 f.).
Um den subjektiven Rechten größere Bedeutung zukommen zu lassen, reicht es deshalb nicht, auf die „Ambivalenzen der Verrechtlichung“ aufmerksam zu machen – wie zum Beispiel in den Rechtsanalysen von Jürgen Habermas (1992) –, sondern es ist notwendig, „von einer staatszentrierten zu einer lebensformzentrierten Perspektive“ zu gelangen (Loick 2017, S. 250; kursiv im Orig.). Aus dieser Sicht gäbe ein solcher Perspektivenwechsel „auch der Analyse der ambivalenten Effekte von Verrechtlichungen eine andere Fassung: Statt als Dilemmata, die sich aus der Umsetzung staatlicher Maßnahmen ergeben, erscheinen sie als Paradoxien, die daraus resultieren, dass die lebensweltlich situierten Akteur*innen Rechte zugleich sowohl fordern als auch zurückweisen müssen“ (a.a.O., S. 250 f.; kursiv im Orig.). Ein Grund der Paradoxien liegt darin, dass die durch subjektive Rechte abstrakt versprochene Freiheit und Macht auf nicht-egalitäre Voraussetzungen trifft.
Die Absicherung der faktischen nichtegalitären Vorbedingungen in der Normativität des egalitären Rechts ist der Preis für die Rechtesicherung liberaler Gesellschaften in Gestalt subjektiver Rechte. Subjektive Rechte bezeichnen insofern die Gerechtigkeitsstandards, aber auch die Grenzen der Gerechtigkeit liberaler Gesellschaften (Hilgendorf & Zabel 2021, S. 3; kursiv im Orig.).
Dabei kommt zum Tragen, dass die Funktion der subjektiven Rechte, Politik zu ermöglichen, „eine formale und eine materielle Dimension [hat]. Formal sind die subjektiven Rechte, weil sie unabhängig davon bestehen können, dass die materiellen Voraussetzungen zu ihrer Inanspruchnahme überhaupt gegeben sind“ (Schmidt 2021, S. 150). Mit anderen Worten, der juridische Schutz und die Gleichheit, die die subjektiven Rechte versprechen, enthält „keinen Anspruch auf die materiellen Voraussetzungen der Rechte, wenn diese nicht schon gegeben sind“ (ebd.).
In ähnlicher Weise macht der Rechtswissenschaftler Matías Cordero Arce (2015a; 2018) in Bezug auf Kinder darauf aufmerksam, dass die Konzeption und das Verständnis von Kinderrechten sich nicht auf ein abstraktes Verständnis des Kindes als Rechtssubjekt beschränken kann, sondern eine „dialektische“ Vision von Kindern in ihren gelebten Kontexten gewinnen muss. Demnach ist die Lebenswirklichkeit von Kindern durch „autonome Interdependenz“ gekennzeichnet. Zum Beispiel sollte die in vielen nicht-westlichen Kulturen praktizierte Mitverantwortung von Kindern nicht als Einschränkung, sondern als Erweiterung der Kinderrechte verstanden werden. Auf diese Weise seien Kinder sowohl Nutznießer*innen als auch Akteur*innen ihrer Rechte, oder mit anderen Worten: „Subjekte als Bürger*innen“.3
Ein Ansatz, der Kinder als Subjekte begreift und ihre subjektiven Rechte betont, ist also nicht ohne Risiken. Er steht in der Gefahr, strukturelle Zwänge zu verharmlosen, die sich hinter dem Rücken und jenseits der Urteile und Handlungskompetenzen der Kinder durchsetzen.4 Er könnte auch von „interessierten Kreisen“ oder „der Gesellschaft“ dazu benutzt werden, sich ihrer Verantwortung für die Kinder zu entledigen und sie auf die Eigenkräfte und die Eigeninitiative der Kinder abzuschieben. Dies geschieht beispielsweise, wenn im neoliberal geprägten Staat Menschen von Hilfsbedürftigen in vermeintlich souveräne „Kunden“ (Künzel-Schön 1996) oder auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft Angewiesene in „Arbeitskraftunternehmer“ (Voss & Pongratz 1998) umdefiniert werden. Auf diese Weise werden Rechte als Anspruch auf staatliche Garantien für ein menschenwürdiges Leben zu einem folgenlosen Konglomerat von „Post-Rechten“ (Luciani 2010) pervertiert, analog zur Umwandlung demokratischer Regierungsformen in eine „Postdemokratie“ (Crouch 2008).
Aber solche Risiken lassen sich nicht dadurch umgehen, dass Kinder nur als Opfer betrachtet werden, die rundum zu schützen und vor jeglichen Risiken zu bewahren sind. Dies würde die Kinder in einer Objektposition fixieren, käme ihrer Entmündigung gleich und würde vor allem dem heute weltweit bei jungen Menschen wachsenden Anspruch entgegenstehen, selbstständig handeln zu können und in den sie betreffenden Angelegenheiten ein Wörtchen mitzureden. Ein subjektorientierter Zugang erfordert, sich bewusst zu sein, dass alle Kinder „Kinder der Gesellschaft“ sind, in der sie leben. Ihre Sichtweisen, Urteile und Wünsche entwickeln sich nicht im gesellschaftsfreien Raum und sind von den Ideologien und normativen Vorgaben dieser Gesellschaft beeinflusst.
Das Subjektsein ist in allen Gesellschaften mehr oder minder ausgeprägten strukturellen, kulturellen und sozialen Begrenzungen konfrontiert und bildet sich erst in Auseinandersetzung mit diesen. Einen unverzichtbaren Bestandteil des subjektorientierten Umgangs sehe ich deshalb darin, sich seinerseits mit diesen Begrenzungen auseinanderzusetzen. Zu ihnen gehört, dass Kinder oft gar nicht entscheiden können, wie und unter welchen Bedingungen sie leben wollen oder dass sie oft unter Bedingungen leben müssen, die ihren persönlichen Interessen oder Entwicklungsbedürfnissen wenig oder keinen Raum lassen. Dann ist es wichtig zu hinterfragen, wodurch diese Begrenzungen entstehen, inwiefern sie zum Beispiel auf extreme Armut, herrschaftsbedingte Abhängigkeitsverhältnisse, Altershierarchien, Kindheitsideologien oder/und eine bestimmte Produktionsweise zurückzuführen sind.
Doch auch und gerade angesichts der vorgegebenen Begrenzungen des Subjektseins bleibt die Frage zentral, welche Rolle die Kinder selbst in der Auseinandersetzung mit diesen Bedingungen spielen (können). Auch eine theoretische Analyse muss sich der (möglichen) Urteile und des (möglichen) Handelns der Kinder versichern. Dies ist mehr als nur eine Frage der Forschungsmethodologie. Es handelt sich um die Frage, wer an einer Überwindung der Begrenzungen des Subjektseins am ehesten ein Interesse hat und wie theoretische Reflexion und empirische Forschung am ehesten dazu beitragen können, dies tatsächlich zu erreichen.
___
1 „Der Juridismus blockiert ein gutes menschliches Leben als Zusammenleben deshalb, weil er ein spezifisches Subjektivierungsregime darstellt: Er erzeugt Existenz- und Koexistenzweisen, die dem menschlichen Gedeihen nicht zuträglich sind“ (Loick 2017, S. 289). In der juristischen und sozialphilosophischen Debatte zu subjektiven Rechten wird allerdings sehr selten auf Kinder Bezug genommen. In einem neueren Sammelband zur Idee subjektiver Rechte (Hilgendorf & Zabel 2021) ist zwar viel von „allen Menschen“ oder dem Menschen im Allgemeinen die Rede, aber die spezifischen Bedingungen und Herausforderungen, die sich für Kinder als Träger subjektiver Rechte ergeben, werden mit keinem Wort angesprochen.
2 Zur Diskussion siehe die Beiträge in dem Sammelband Gegenrechte. Recht jenseits des Subjekts (Fischer-Lescano, Franzki&Horst 2018). Auch in diesem Band wird allerdings an keiner Stelle auf Kinder und ihre Rechte eingegangen.
3 Siehe dazu meine Überlegungen zu einer „Bürgerschaft von unten“, die aus selbstorganisierten Kinderbewegungen hervorgeht und sich nicht mit einen formalen Rechtsstatus begnügt, in Liebel (2020a, S. 274ff.). Zur Idee einer „aufständischen“ oder „aufrührerischen“ Staatsbürgerschaft vgl. Balibar (2012, S. 68 f.).
4 Diese Problematik ergibt sich aus dem liberalen Verständnis subjektiver Rechte, da in ihm die Subjekte nicht in ihren Lebenszusammenhängen und auf soziale Beziehungen angewiesene Menschen, sondern als isolierte Monaden konzipiert werden. Um die „in der Rechtlichkeit angelegten emanzipatorischen Potentiale“ freizusetzen, muss deshalb „die Sozialität der menschlichen Subjektivität“ beachtet werden (Loick 2017, S. 332f.). Dieser Gedanke liegt auch dem Konzept der „Gegenrechte“ zugrunde.
***
Sie möchten gern weiterlesen?
Jetzt versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen

© Titelbild: gestaltet mit canva.com