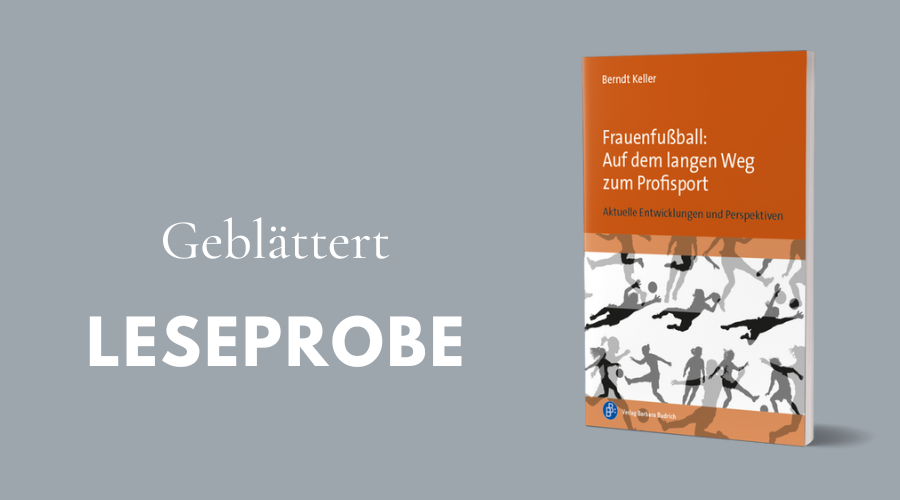von Berndt Keller
Über das Buch
Frauenfußball ist aus dem deutschen Sportgeschehen nicht mehr wegzudenken und wird doch oft vergessen. Seine aktuellen Entwicklungen haben bisher in Öffentlichkeit, Medien und Wissenschaft zu wenig Beachtung gefunden. Dieses Buch befasst sich deshalb mit einer Vielzahl von Entwicklungen im Frauenfußball, vor allem mit der allmählichen Professionalisierung. Dabei haben sich nicht nur Organisation und Qualität erheblich verändert, sondern vor allem im vergangenen Jahrzehnt auch seine wirtschaftlichen Wettbewerbsbedingungen und Rezeption. Der Autor analysiert zudem ein breites Spektrum finanzieller Fragen im Frauenfußball, das von Vereinsbudgets über Gehälter bis hin zur rasch fortschreitenden Kommerzialisierung und internationalen Entwicklungen reicht.
Leseprobe aus den Seiten 7 bis 9
***
1 Einleitung und Problemstellung
Die Geschichte des modernen Frauenfußballs reicht zurück bis ins späte 19. Jahrhundert. Seine diversen, nationalen wie internationalen Aspekte sind in der sportwissenschaftlichen bzw. sporthistorischen Literatur vielfach dokumentiert (für andere Eisenberg 2006, Brüggemeier et al. 2000, Hennies/Meuren 2011, Herzog 2013). Ein aktueller, international-komparativer Übersichtsartikel diagnostiziert sogar zunehmendes Interesse, „an increasing trend of journal publications since 1998, with a large representation of studies related to historical ad sociological research, where qualitative methods are dominant“ (Valenti et al. 2018, 511).
Aktuellere Entwicklungen des Frauenfußballs finden hingegen wenig Beachtung in Öffentlichkeit, Medien und Wissenschaft. Die offensichtlichen, anhaltenden Trends seiner allmählich fortschreitenden Professionalisierung stehen daher im Mittelpunkt dieses aus der Meso- und Makroperspektive argumentierenden Beitrags, der im Spektrum der verschiedenen Sozialwissenschaften inter- bzw. wenigstens multidisziplinär angelegt ist. Ich konzentriere mich ausschließlich auf die bisher kaum analysierten Entwicklungen im professionalisierten Segment des Frauenfußballs, ohne ausführlich auf den Amateur- sowie Mädchen- und Jugendbereich einzugehen (zusammenfassend Meier 2021). Meine sekundärempirische Analyse basiert auf einer qualitativen Auswertung der deutsch- und englischsprachigen Literatur einschl. Presseartikeln, umfangreichen Internetrecherchen sowie ausgewählten teil-strukturierten Interviews.
Ich behandle zunächst Veränderungen der Organisationsformen und -strukturen (Spielbetrieb und Ligen sowie Dachverband) (Kap. 2). Anschließend gehe ich ausführlich auf aktuellere Verschiebungen der Kräfteverhältnisse ein (organisatorische Bedingungen, wirtschaftliche Voraussetzungen, internationaler Wettbewerb) (Kap. 3). Danach analysiere ich die spezifischen Entwicklungen von Arbeitsmarkt und Arbeitsbeziehungen (Kap. 4). Dann steht die aktuell fortschreitende Kommerzialisierung durch intensivierte Strategien der Vermarktung im Mittelpunkt (Kap. 5). Ein knapp gehaltener Exkurs zu Entwicklungen in anderen Ländern skizziert Besonderheiten der deutschen Entwicklung (Kap. 6). Zusammenfassung und Ausblick beschließen das Manuskript (Kap. 7).
Einzelne Spielerinnen oder einzelne Spiele, etwa bei internationalen Turnieren, finden keine Berücksichtigung. Ausgeklammert bleiben auch die üblichen „Statistiken“ im Rahmen der in den vergangenen Jahren in der medialen Sportberichterstattung eingetretenen Datenfixierung und Quantifizierung durch big data.1 Weiterhin befasse ich mich nicht mit reinen Erlebnisberichten fußballaffiner Autoren und Autorinnen sowie – nicht ausführlich – mit „Traditionsvereinen“. Last but not least klammere ich zweifellos relevante, aber anderswo ausführlich und kompetent behandelte Probleme aus, wie Identität und/durch Sport, Sexismus und sexualisierte Gewalt, Homophobie und Geschlechterdiskriminierung bzw. -gerechtigkeit (für andere Sobiech 2006, Müller 2009, Pfister/Pope 2018, Meier 2021).2
(Einige) Parallelen zum Männerfußball lassen sich nicht vermeiden. Ich stelle sie jedoch nicht, wie zumeist, reflexartig und/ oder systematisch, sondern nur gelegentlich an, wenn sie sich unerwartet ergeben. Sie dienen ausschließlich der Verdeutlichung von Trends der allmählichen Professionalisierung, nicht einer als wünschenswert oder gar als notwendig erachteten normativen Zukunftsorientierung des Frauenfußballs.
Ich verweise auf eine aktuelle Studie mit Event- und Positionsdaten, die – im Gegensatz zu nach wie vor weit verbreiteten Ansichten – belegt, dass sich beim Frauenfußball, wenn man physische Unterschiede wie Ausdauer und Schnelligkeit ausklammert, in taktischer und kognitiver Leistungsfähigkeit keine deutlichen Unterschiede zum Männerfußball ergeben (Memmert 2021). Die häufig stattfindende Relativierung des Frauenfußballs durch Vergleiche mit dem Männerfußball ist folglich unbegründet (Diketmüller 2012). Es handelt sich nicht um eine weitere (Rand-)Sportart, sondern um dieselbe, eigenständige Sportart; eine Aufteilung nach Geschlecht ist unbegründet. Frauenfußball kann bei entsprechender Anerkennung einen „Mehrwert“ für den Fußball insgesamt leisten.
Ich verwende – im Sinn einer (Nominal-)Definition – den Begriff Frauenfußball, obwohl er umstritten ist. Dies geschieht ausschließlich im Sinn gendergerechter Sprache sowie zur Abgrenzung vom Männerfußball, den ich im Gegensatz zum üblichen Sprachgebrauch auch so und nicht nur Fußball nenne.3 Weiterhin gebrauche ich den Begriff Lizenzverein durchgängig und ausschließlich für Vereine, deren Männermannschaften in einer der obersten drei Ligen, vor allem der ersten oder zweiten Bundesliga, spielen. Mit dem Begriff Frauenverein bezeichne ich hingegen Vereine, die entweder ausschließlich über Frauenmannschaften verfügen oder bei denen die Frauenmannschaften das „Aushängeschild“ sind.4 Wichtig ist schließlich die Unterscheidung zwischen internen und externen Trends der Professionalisierung. Neben die internen, welche die Vereine und Verbände selbst entwickeln und umsetzen, treten externe, die durch Vermittlung in den Medien sowie durch gezielte Akquirierung von Sponsoren gefördert werden.5 Ich gehe zunächst ausführlich auf die internen ein.
___
1 U. a. Ergebnisse, Tabellen, Heim- und Auswärtstabellen, ewige Tabellen, Abseitsstellungen, Tore, Torvorlagen, Torschüsse und -schützen, Torjäger, Laufleistungen/ zurückgelegte Distanzen. Auch die inzwischen umfangreiche Literatur zu Sportökonomie (Weimar 2019), Sportmanagement (Shilbury 2022a) sowie Sportrecht klammere ich weitgehend aus.
2 Außerdem beabsichtige ich nicht, einen Beitrag zu einer derzeit nur in Ansätzen bestehenden Theorie der Sportverbände zu leisten (Thieme/Wojciechowski 2021). Im Übrigen sind auch wissenschaftliche Beiträge über Frauenfußball (leider) deutlich seltener als über Männerfußball (Eisenberg 2006).
3 Im Gegensatz zum Fußball findet in anderen Sportarten stets explizit und nicht hinterfragt die Unterscheidung statt, etwa bei Radsport, Tennis und Volleyball.
4 Auch die UEFA verwendet in aktuellen Publikationen die Begrifflichkeit ‚integrated clubs‘ und ‚stand-alone clubs‘ (UEFA 2022).
5 Ein Konzept zur spezifischen Analyse des Frauenfußballs unterscheidet zwischen „professionalization ‚from within‘ and ‚from above‘ “ (Bagger/Agergaard 2013, 823).
***
Sie möchten gern weiterlesen?
Jetzt versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen

Frauenfußball: Auf dem langen Weg zum Profisport. Aktuelle Entwicklungen und Perspektiven
© Titelbild: gestaltet mit canva.com