Inwiefern können, sollen, dürfen oder sogar müssen Zugänge zur NS-Zeit für Grundschulkinder bereitgestellt werden? Eine Leseprobe aus Holocaust Education in der Grundschule. Historisch-politisches Lernen im sozialwissenschaftlichen Sachunterricht von Caterina Quintini.
***
Einleitung
„Lieber Herr Kralovitz, wir möchten zum Anfang uns Bedanken, dass wir Ihnen Fragen stellen dürfen. Wir hoffen, dass wir Sie mit unseren Fragen nicht verletzen oder traurig machen. In den letzten 5 Wochen haben wir uns mit dem Thema Nazi-Zeit beschäftigt. Aber vieles ist für uns kaum vorstellbar. Wir beschäftigen uns mit dem Thema, weil viele aus unserer Klasse Ausländer sind und einige schon bedroht wurden. Wir möchten verhindern, dass so etwas, wie die Nazi-Zeit noch einmal passiert.“ (Auszug aus dem Interview der Ponyklasse 1994).1
Mit diesen Worten beginnt ein Schüler aus der Ponyklasse in Gießen das Interview mit dem Holocaust-Überlebenden Rolf Kralovitz, der als junger Häftling als einziger seiner Familie das Konzentrationslager Buchenwald überlebte. Anschließend bitten vier weitere Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren Rolf Kralovitz, von der Zeit zu erzählen, in der er genauso alt war, wie die Kinder der Ponyklasse. Die Kinder wollen wissen, wie es ihm im Konzentrationslager (KZ) erging, wer ihn aus diesem befreite und wie sein Leben danach weiterging. Die letzte Frage der Kinder lautet:
„Was können wir Kinder Ihrer Meinung nach tun, damit so etwas nicht noch einmal passiert? Damit jeder in Deutschland ohne Angst leben kann?“ (vgl. ebd. 00:01:36 − 00:01:44).
Daraufhin beginnt Rolf Kralovitz zu erzählen, von dem Tag an, an dem er plötzlich auf eine andere Schule gehen musste, nicht mehr wie die anderen Kinder ins Schwimmbad durfte und wie er beim Fußballspielen von seinen Kumpels verschlagen wurde. Er erzählt von der schweren Arbeit im Lager und dem ständigen Hunger, aber auch von den Menschen, die ihm geholfen haben und dem Moment der Befreiung, den er erst Wochen später wirklich begreifen konnte. Er beantwortet alle Fragen der Kinder und weiß nur bei der letzten Frage keine eindeutige Antwort zu geben (ebd. 00:58:45–01:01:56). Die Zeitzeugenerzählung von Rolf Kralovitz bildet den Abschluss einer ausführlich dokumentieren Unterrichtseinheit zum Nationalsozialismus, die Rita Rohrbach bereits im Jahre 1994 mit einer Grundschulklasse in Gießen durchführte (Rohrbach 2005). Erstaunlich dabei ist, dass ihr Unterrichtsprojekt stattfand, ehe es einen breiten fachdidaktischen Diskurs zu dem Spannungsfeld Holocaust und Kinder gab. Sind Kinder in der Lage, solchen Erzählungen zu folgen, können sie verstehen, was „damals“ passiert ist oder führen solche Erzählungen nicht doch zur befürchteten Abwehrhaltung, die auch einen späteren Zugang zu diesem Thema verwehrt? Inwiefern können, sollen, dürfen oder vielleicht sogar müssen Zugänge zu diesem Kapitel der deutschen Vergangenheit für junge Lernende, sprich Kinder ab der dritten Grundschulklasse zugänglich gemacht werden?
Der Beginn der fachdidaktischen Diskussion über eine frühe Thematisierung des Holocaust und Nationalsozialismus wird in der in Hamburg 1997 stattgefundenen internationalen Tagung mit dem Titel „Der Holocaust. Ein Thema für Kindergarten und Grundschule?“ (Heyl und Moysich 1998) gesehen. In den nachfolgenden zehn Jahren wurden verschiedene empirische Studien durchgeführt, die Vorwissen, Verarbeitungsstrukturen und Interesse junger Lernender zu Nationalsozialismus und Holocaust untersuchten, um darauf aufbauend didaktische Prinzipien für eine Thematisierung in der Schule abzuleiten. Eine qualitative Studie von Klätte (2012a) zeigt, dass die Mehrheit aller Viertklässler*innen in Berlin und Nordrhein-Westfalen den Themen „Holocaust und Nationalsozialismus“ im Unterricht begegnet, obwohl sich die verpflichtende Verankerung erst in den Curricula für die Sekundarstufe findet. Diese Arbeit möchte den Fragen nachgehen, warum und wann eine Thematisierung mit jungen Lernenden sinnvoll ist und wie diese aussehen kann. Der Ort einer Thematisierung in der Primarstufe ist dabei das allgemeinbildende Fach Sachunterricht. Im ersten Kapitel dieser Arbeit soll daher eine konzeptionelle Einordung des sozialwissenschaftlichen Sachunterrichts stattfinden. Dabei werden die Bildungsziele und Aufgaben des Sachunterrichts, insbesondere des historisch-politischen Lernens in der Grundschule, näher bestimmt. Im zweiten Kapitel findet zunächst eine allgemeine Betrachtung des gesamtgesellschaftlichen Umgangs mit der NS-Vergangenheit statt sowie eine Einordnung des Holocaust und Nationalsozialismus als historisch-politischer Lerngegenstand (Kapitel 2.1 und 2.2), um dann den Diskurs um eine Thematisierung in der Grundschule nachzuzeichnen (Kapitel 2.3). Infolgedessen sollen empirische Studien angeschaut werden, die das Interesse, Vorwissen und Vorstellungen von Grundschulkindern zum Thema NS-Zeit und Holocaust in den Blick nehmen (Kapitel 2.4). Nachdem betrachtet wurde, weshalb eine Thematisierung in der Grundschule stattfindet, beschäftigt sich das vierte Kapitel mit den Fragen der Lerninhalte und den Möglichkeiten der Vermittlung. Aufbauend auf fachdidaktischen Vorüberlegungen wird hierbei eine eigene Unterrichtseinheit konzipiert. Abschließend werden die wichtigsten Erkenntnisse und Überlegungen im Fazit zusammengefasst.
___
1 Die Kassette der Interviewaufnahme hat Frau Rohrbach digitalisieren lassen und mir als Datei zugänglich gemacht. Eine nicht wortgetreue Transkription der Lebensgeschichte findet sich in Rohrbach 2005 (S. 347–363). Im Online-Anhang dieser Arbeit findet sich die wortgetreue Transkription von dem Interview, um die Erzählstruktur des Zeitzeugen besser nachvollziehen zu können.
***
Sie möchten gern weiterlesen?
Jetzt versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
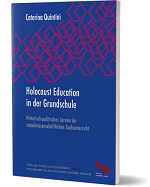 Caterina Quintini:
Caterina Quintini:
Freiburger Studien zur Politikdidaktik, Band 4
Die Autorin
 Caterina Quintini, M.Ed., Konstanz
Caterina Quintini, M.Ed., Konstanz
Über „Holocaust Education in der Grundschule“
Kann man Grundschulkinder mit der NS-Zeit, der Judenverfolgung und dem Holocaust konfrontieren? Können Kinder mittels Biografien lernen und verstehen, was damals passiert ist, oder führt eine frühe Auseinandersetzung damit zur befürchteten Abwehrhaltung, die einen Zugang zu diesem Thema verwehrt? Inwiefern können, sollen, dürfen oder sogar müssen Zugänge zu diesem Kapitel der deutschen Vergangenheit für Grundschulkinder bereitgestellt werden? Die Autorin zeichnet den Forschungsstand nach und entwickelt eine eigene Unterrichtskonzeption für eine vierte Grundschulklasse.
Mehr Leseproben …
… finden Sie auf unserem Blog.
© Foto Caterina Quintini | Titelbild: gestaltet mit canva.com


