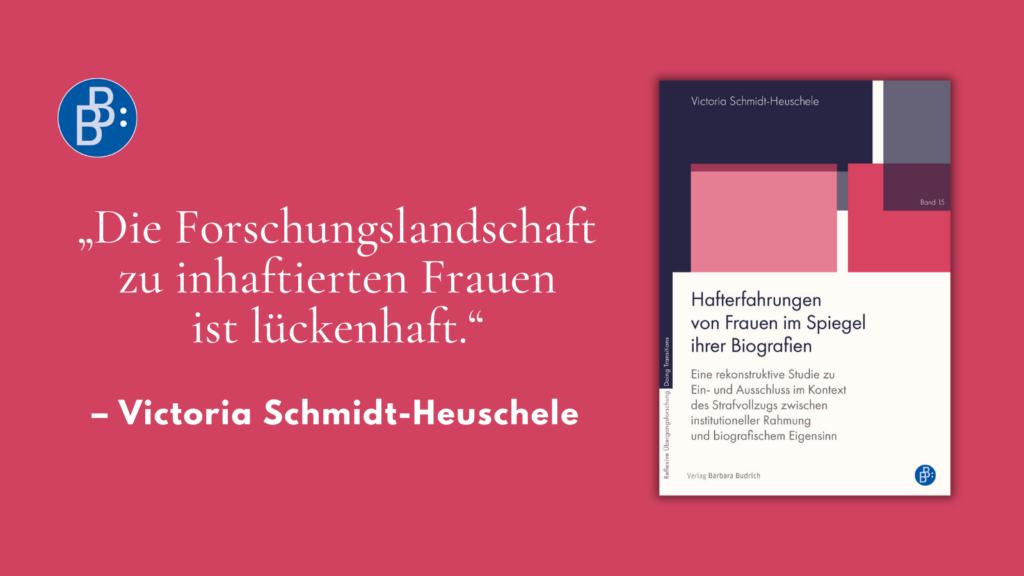Wie ordnen ehemals inhaftierte Frauen die Erfahrung des Strafvollzugs rückblickend ein? Wir haben ein Interview mit Victoria Schmidt-Heuschele zu ihrem Buch Hafterfahrungen von Frauen im Spiegel ihrer Biografien. Eine rekonstruktive Studie zu Ein- und Ausschluss im Kontext des Strafvollzugs zwischen institutioneller Rahmung und biografischem Eigensinn geführt.
Interview zum Buch „Hafterfahrungen von Frauen im Spiegel ihrer Biografien“
Liebe Victoria Schmidt-Heuschele, worum geht es in Ihrem Buch?
Die biografieanalytische Studie wirft ein Licht auf eine Personengruppe, mit der die Mehrheitsgesellschaft in der Regel kaum Berührungspunkte aufweist: hafterfahrene bzw. straffällig gewordene Frauen, die ein oder mehrere Male im Strafvollzug inhaftiert waren und insbesondere über diese Lebensphase erzählen.
Die Studie beschäftigt sich kurzgefasst mit der Leitfrage, wie hafterfahrene Frauen ihre Erfahrungen des Freiheitsentzugs rückblickend deuten, biografisch verarbeiten und bewerten.
Wie kamen Sie auf die Idee, eine Studie zu diesem Thema durchzuführen? Gab es einen „Stein des Anstoßes“?
Sowohl als Sozialarbeiterin als auch als Wissenschaftlerin interessiere ich mich für Soziale Arbeit im Kontext des Strafvollzugs und mit straffällig gewordenen Menschen. Dieser Personenkreis stellt nicht nur eine gesellschaftliche Randgruppe dar, sondern ist auch im erziehungswissenschaftlichen bzw. sozialpädagogischen (Fach-)Diskurs kaum Thema.
Diese Vernachlässigung wird am Beispiel straffällig gewordener Frauen noch deutlicher: In Deutschland machen Frauen jährlich lediglich 5 bis 6 % der Gesamtinhaftierten aus. Im Jahr 2022 entsprach dieser Anteil etwa 2406 weiblichen Gefangenen. Diese quantitative Bedeutungslosigkeit von inhaftierten Frauen spiegelt sich auch in entsprechend lückenhafter Forschungslandschaft wider.
Dies hat zur Folge, dass Erkenntnisse aus Studien zum Männervollzug häufig auf den Frauenvollzug übertragen werden – ein Ansatz, der den spezifischen Erfahrungen und Bedürfnissen von Frauen nicht gerecht wird. Umgekehrt rückt Frauenkriminalität vor allem dann ins Zentrum der Aufmerksamkeit, wenn von Frauen besonders grausame, spektakuläre, schwere und damit verbunden meist seltene Straftaten, wie z. B. Kindstötung (Neonatizid), Ehegattenmorde oder Straftaten im Kontext des Gesundheits- und Pflegewesens begangen werden.
Ein weiterer Impuls für meine Forschung ergab sich aus der besonderen Organisation des Strafvollzugs und seinen äußerlich-baulichen Merkmalen als geschlossene Einrichtung, die oft negative Assoziationen und Unbehagen hervorrufen. Bislang wurde jedoch wenig untersucht, wie Menschen sich mit diesem tiefgreifenden Eingriff in ihre Autonomie auseinandersetzen und diese Ausnahmeerfahrung biografisch verarbeiten. Stattdessen fokussieren viele Studien auf Rückfallquoten sowie auf die Wirksamkeit, Effizienz und Effektivität des Strafvollzugs.
Eine biografische Studie, die die persönlichen Erzählungen hafterfahrener Frauen in den Mittelpunkt stellt, leistet daher einen wertvollen Beitrag, indem sie die bisherigen Ansätze aus der Kriminologie, Soziologie und Sozialpsychologie durch eine konsequente Adressatinnenperspektive ergänzt.
Wie ist die Erhebung methodisch aufgebaut?
Im Rahmen meiner Promotion habe ich mit acht straffällig gewordenen und hafterfahrenen Frauen narrative Interviews geführt. Damit war zugleich die schwierigste Hürde in der Durchführung des Promotionsvorhabens geschafft: die Suche nach gesprächsbereiten Interviewpartnerinnen.
Das offene Format des narrativen Interviews ermöglichte es, die Stimmen einer marginalisierten Personengruppe einzufangen und als Ausgangspunkt der Auswertung zu nutzen. Die Interviewmethode wählte ich bewusst als emanzipatorische sowie empowernde Forschungszugang im Kontext mit stigmatisierten Personengruppen, deren Stimmen häufig hinter den Gefängnismauern im gesellschaftlichen Diskurs verstummen oder im Nachhinein in Verbindung mit dieser Zeit diskreditiert werden.
Die lebensgeschichtlichen Erzählungen bieten eindrucksvolle, teils auch bedrückende Einblicke in die Lebenswirklichkeiten sowie die Welt- und Selbstwahrnehmungen hafterfahrener Frauen. Neben Leidensprozessen treten in den vielfältigen Erzählungen auch Hoffnungen, Zukunftsperspektiven und Neuorientierungen der Biografinnen für ihr weiteres Leben in den Vordergrund. In den biografisch-narrativen Interviews haben die Frauen den Strafvollzug als biografisch bedeutsame Erfahrung thematisieren können – ohne dass dieser zwangsläufig den einzigen oder alles bestimmenden Fokus ihrer Erzählungen darstellt.
Das Herzstück der Arbeit bilden schließlich drei ausführlich analysierte Falldarstellungen. Diese wurden einer narrations- und prozessanalytischen Auswertungsmethode unterzogen. Vereinfacht gesagt liegt der Fokus der Analyse darauf, wie Menschen über die Ereignisse ihres Lebens erzählen. Besonders die Prozessstrukturen des Lebenslauf als Heuristik sensibilisieren dafür, ob sich Menschen eher als passiv Erleidende oder aktiv Handelnde ihres Lebens wahrnehmen.
Wie würden Sie die Ergebnisse zu Hafterfahrungen von Frauen in maximal drei Sätzen zusammenfassen?
Erstens: Ein Aufenthalt im Strafvollzug wird in den Biografien der Frauen vor allem in seinem ambivalenten Charakter rekonstruiert.
Zweitens: Die Befunde regen aus pädagogischer Sicht dazu an, über Sozialarbeiter*innen und deren Bedeutung als potenziell signifikant Andere in den Biografien von hafterfahrenen Frauen nachzudenken.
Drittens: Die Lebensverläufe und Erzählungen der Frauen machen sichtbar, wie schwierig es noch immer sein kann, in einer nach wie vor heteronormativ geprägten Gesellschaft zu leben und darin das Leben mit all seinen spezifischen Belastungen (bspw. als Tochter, als Mutter, als Ehefrau) zu bewältigen.
Darum bin ich Autorin bei Budrich
Als ehemalige Kollegiatin des DFG-Graduiertenkollegs „Doing Transitions – Formen der Gestaltung von Übergängen im Lebenslauf“ hatte ich die Gelegenheit, meine Studie in der Reihe „Reflexive Übergangsforschung“ beim Verlag Barbara Budrich als Band 15 zu publizieren. Dank der kompetenten Beratung und der zuverlässigen Begleitung durch feste Ansprechpartnerinnen im Verlag verlief der Publikationsprozess reibungslos. Ich hoffe, dass die Veröffentlichung dazu beiträgt, dem Thema eine größere Sichtbarkeit zu verschaffen.
Jetzt versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
 Victoria Schmidt-Heuschele:
Victoria Schmidt-Heuschele:
Reflexive Übergangsforschung – Doing Transitions, Band 15
Die Autorin
 Dr. Victoria Schmidt-Heuschele war von 01/2020 bis 08/2023 als Kollegiatin der 2. Kohorte des Graduiertenkollegs Doing Transitions wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Erziehungswissenschaft der Eberhard Karls Universität Tübingen. Zuvor studierte sie an der Hochschule Esslingen im Bachelor Soziale Arbeit und darauf aufbauend den Master Forschung und Entwicklung in der Sozialpädagogik/Sozialen Arbeit in Tübingen. Parallel zu ihren beiden Studienphasen war sie u. a. als Honorarkraft im Beruflichen Ausbildungszentrum Esslingen (BAZ) in der Arbeit mit Langzeitarbeitslosen (Projekt MOVE) sowie beim Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg in der Betreuung und Begleitung von Freiwilligen angestellt. Zuletzt arbeitete sie als Sozialarbeiterin im Projekt „HoMe – Hilfen für ordnungsrechtlich untergebrachte Menschen“ bei der AWO Reutlingen und war zudem Lehrbeauftragte an der Hochschule Esslingen.
Dr. Victoria Schmidt-Heuschele war von 01/2020 bis 08/2023 als Kollegiatin der 2. Kohorte des Graduiertenkollegs Doing Transitions wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Erziehungswissenschaft der Eberhard Karls Universität Tübingen. Zuvor studierte sie an der Hochschule Esslingen im Bachelor Soziale Arbeit und darauf aufbauend den Master Forschung und Entwicklung in der Sozialpädagogik/Sozialen Arbeit in Tübingen. Parallel zu ihren beiden Studienphasen war sie u. a. als Honorarkraft im Beruflichen Ausbildungszentrum Esslingen (BAZ) in der Arbeit mit Langzeitarbeitslosen (Projekt MOVE) sowie beim Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg in der Betreuung und Begleitung von Freiwilligen angestellt. Zuletzt arbeitete sie als Sozialarbeiterin im Projekt „HoMe – Hilfen für ordnungsrechtlich untergebrachte Menschen“ bei der AWO Reutlingen und war zudem Lehrbeauftragte an der Hochschule Esslingen.
Über „Hafterfahrungen von Frauen im Spiegel ihrer Biografien“
Der staatlich angeordnete Freiheitsentzug stellt einen tiefgreifenden Eingriff in die Grundrechte dar. Wie ordnen ehemals inhaftierte Frauen diese Erfahrung rückblickend ein? Die qualitativ-rekonstruktive Studie beschäftigt sich mit biografischen Erzählungen hafterfahrener Frauen, die von ihrem Leben, insbesondere ihrem Biografieabschnitt im Strafvollzug, erzählen. Im Fokus der Studie steht die Frage, wie Erfahrungen des Freiheitsentzugs im lebensgeschichtlichen Zusammenhang retrospektiv gedeutet und verarbeitet werden.
Mehr Autor*innen-Interviews …
… finden Sie in der Blog-Kategorie 5 Fragen an.
© Foto Victoria Schmidt-Heuschele: privat | Titelbild gestaltet mit canva.com