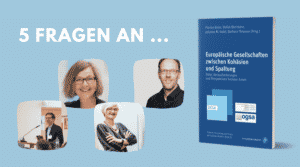von Marina Chernivsky und Friederike Lorenz-Sinai (Hrsg.)
Über das Buch
Die Zeit des Nationalsozialismus hat bis heute Nachwirkungen auf die Gesellschaft. Doch wie wird die Shoah im Studium und in der Lehre thematisiert? Dieses Buch untersucht multiperspektivisch die Wirkungsgeschichte der Shoah in verschiedenen Settings von Erziehung und Bildung und reflektiert die bisherige theoretische und empirische Forschung. Das Wissen über und Bezüge zur Shoah vermitteln sich zwischen den Generationen weiter und aktualisieren sich zugleich fortlaufend in institutionellen und diskursiven Kontexten der Gegenwartsgesellschaft. Dies betrifft Pädagog*innen in mehrfacher Hinsicht: In ihrer eigenen Biographie und Lerngeschichte und in ihrer späteren Vermittlungspraxis. Die Autor*innen beschäftigen sich u.a. mit der Erinnerungspolitik, Gefühlserbschaften und der Thematisierbarkeit der Shoah in verschiedenen Sozialisierungsprozessen.
Leseprobe aus den Seiten 119-124
Shoah und Nationalsozialismus in der Lehrer*innenbildung
von Aysun Doğmuş
„Weil Geschichte denen ausgeliefert ist, die sich an sie erinnern, ist sie offen für Vereinnahmungen und Aneignungen, die mehr mit den Bedürfnissen der Gegenwart zu tun haben als mit dem Versuch, sich mit der Vergangenheit zu konfrontieren“ (Messerschmidt 2007: 47).
1 Einleitung
Ohne Zweifel stellen die Shoah und der Nationalsozialismus eine zentrale Bildungsdimension in schulischen Lehr-Lern-Settings dar. Für Schulen sind bildungspolitische Beschlüsse der Kultusministerkonferenz (KMK) wegweisend (etwa KMK 1978, 1980, 2014), wie auch die im Jahre 2013 unterzeichnete Absichtserklärung mit der internationalen Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem. Vereinbart wurde, „den Unterricht zum Thema Holocaust in den Lehrplänen aller sechzehn Länder in der Bundesrepublik Deutschland weiter zu verankern“ (KMK 2013).1 In ihrer Länderumfrage zum „Unterricht über Nationalsozialismus und Holocaust“ weist die KMK dann auch darauf hin, dass keine Schüler*in die Schule verlasse, „ohne etwas über dieses Kapitel deutscher Geschichte erfahren zu haben“ (KMK 2005: 4).
Die Shoah und der Nationalsozialismus kommen folglich als pädagogisch relevanter, fachspezifischer Vermittlungsgegenstand zur Geltung. Länderübergreifend ist das Unterrichtsfach Geschichte von Bedeutung, zuweilen sind die Unterrichtsfächer Sozialkunde, Politik, Religion/Ethik, Deutsch oder Geographie Orte eines zeitlich begrenzten Lehr-Lern-Settings. Entsprechend finden sich bildungspolitische Empfehlungen, wie etwa von der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) „für das Lehren und Lernen über den Holocaust“ (ebd. 2019), mit der argumentative Grundlagen für den Unterricht, thematische, sowie methodisch-didaktische Hinweise gegeben werden. Auch finden sich fachspezifische Auseinandersetzungen (vgl. Benedikt 2011; Ramm/Keuffe 2020), die sich dem Vermittlungsgegenstand und der Professionalisierung von Lehrer*innen widmen.
In der Konsequenz kommt der Lehrer*innenbildung die professionalisierungsrelevante Vermittlung der fachspezifischen Vermittlung im Unterricht zu. Auch wenn nicht der Eindruck entstehen sollte, dass es keinen curricularen Handlungsbedarf für die schulische Praxis gäbe, kann festgehalten werden, dass alle Schüler*innen als Lernende zu diesem „Kapitel deutscher Geschichte“ (KMK 2005: 4) adressiert werden, während die Adressierung von Lehrer*innen in ihrer fachspezifischen Vermittlungsaufgabe verbleibt. Der Professionalisierungsprozess und die Relevanz einer Professionalisierungsbedürftigkeit aller (angehender) Lehrer*innen bleibt ausgespart, damit auch für die Schulpraxis relevante diskursive Verwobenheiten und biografisch bedeutsame (transgenerationale) Verstrickungen.
Mit diesem Beitrag wird die Professionalisierungsbedürftigkeit als eine wegweisende Leerstelle der Lehrer*innenbildung markiert und für die fächerübergreifende, erziehungswissenschaftliche Verankerung der Shoah und des Nationalsozialismus als zentrale Reflexionsdimension in der Lehrer*innenbildung argumentiert, die Verbindungen zu einer antisemitismus- und rassismuskritischen Lehrer*innenbildung auslotet. Skizziert werden diskursive Verwobenheiten und Gleichsetzungen in der schulischen Praxis, sowie strukturelle Dimensionen der Lehrer*innenbildung, die resümierend über professionalisierungstheoretische Dimensionen verknüpft werden.
Die Professionalisierungsbedürftigkeit aller Lehrer*innen wird der fachspezifischen Vermittlungsaufgabe nicht gegenübergestellt. Vielmehr wird auf das vielschichtige Potential der fächerübergreifenden, erziehungswissenschaftlichen Reflexivität verwiesen. Denn wie auch in diesem Sammelband hervorgehoben wird, stellen biografisch-gesellschaftlich vermittelte Narrationen und Wissensbestände maßgebliche, nicht zwangsläufig bewusst und bewusst intendierte Strukturierungselemente pädagogisch-professionellen Handelns dar und nehmen im Zusammenhang der Shoah und des Nationalsozialismus spezifische Ausdruckgestalten an. Von Bedeutung ist dabei auch die biografisch-gesellschaftliche Standortgebundenheit und Standortreflexivität (angehender) Lehrer*innen.
Der Beitrag versteht sich in diesem bisher kaum beleuchteten Diskurs als Momentaufnahme einer Suchbewegung, mit der diese Leerstelle der Lehrer* innenbildung und die Notwendigkeit gekennzeichnet wird, diese Leerstelle durch theoretisch-analytische, konzeptionelle und forschungspraktische Initiativen zu füllen, zu hinterfragen und zu diskutieren.
2 Diskursive Verwobenheiten und Gleichsetzungen in der Schulpraxis
Mit ihrer Analyse zu Rassismus und Antisemitismus in gesellschaftlichen Aushandlungen der Gegenwart verweist Astrid Messerschmidt (2007) auf eine effektvolle Gleichsetzung von Rassismus, Antisemitismus, dem Nationalsozialismus und seiner Staatsideologie. Diese Gleichsetzung dokumentiert einen migrationsgesellschaftlich und postkolonial relevanten Diskurs im „postnationalsozialistischen“ Deutschland (Messerschmidt 2009: 60f.); auf Verhältnisse also, die nicht nur ein danach markieren, sondern auf die gegenwärtigen Nachwirkungen aufmerksam machen. Die Gleichsetzung verbindet die Thematisierbarkeit von Rassismus und Antisemitismus mit Praktiken der Dethematisierung und ermöglicht, die Thematisierbarkeit der Shoah und des Nationalsozialismus auf vielschichtige Weise zu vereinnahmen (vgl. Messerschmidt 2007) und dadurch zu blockieren. Wirksam ist die Auseinandersetzung mit der Shoah im „Fixpunkt nationaler Identität“ (ebd.: 55) und Versuche nationaler Selbstvergewisserung, die Messerschmidt als Wiederholung des „ausschließende[ n] Gestus des deutschen Nationalprojektes“ (ebd.) problematisiert. Als eine Gemeinsamkeit der Erscheinungsformen von Rassismus und Antisemitismus kann daher „das Sprechen über Andere“ (Messerschmidt 2013: 15) herausgestellt werden, die erst über dieses Sprechen „zu Fremden gemacht werden“ (ebd.) und als Feind- und Gegenbilder fungieren (ebd.; vgl. auch Attia 2018). Messerschmidt (2007) plädiert daher für eine „selbstkritische Praxis von Erinnerung […], die nicht Identität stiftet, sondern immer wieder herausfordert, nach der gegenwärtigen Beschaffenheit der politischen Kultur und der Demokratie zu fragen“ (ebd.: 55). Die Kritik an Gleichsetzungen impliziert folglich auch eine vereindeutigende Reduktion.
In diese Mechanismen sind schulische Akteur*innen involviert. Sie werden in Lehr-Lern-Settings – bewusst-aktiv oder als implizites Handlungswissen – aufgegriffen, irritiert oder bestätigend (re‐)produziert. Für den Umgang mit gegenwärtigen Erscheinungsformen des Antisemitismus an Schulen analysiert Chernivsky (2018) vier Traditionslinien (vgl. auch Chernivsky/Lorenz 2020): Historisierung, Distanzierung, Perspektivendivergenz und Objektivierung. Mit der Historisierung zeigt sich die Gleichsetzung der Shoah, des Nationalsozialismus und des Antisemitismus insofern, als er als ein vergangenes Phänomen hergestellt und in der Konsequenz für den eigenen schulischen Alltag für irrelevant erklärt werden kann. Eigenbiografischer und emotionaler Aufladung kommt dabei ein zentraler Einfluss zu:
„Das Konstatieren antisemitischer Haltungen kann […] als beschämend und bedrückend erlebt werden, was dazu führt, dass aktuelle Übergriffe nicht erkannt, sondern negiert oder relativiert werden – mit dem Argument, dass andere Diskriminierungsformen an 1hoah und Nationalsozialismus in der Lehrer*innenbildung 12 der Schule relevanter seien oder Schüler*innen lediglich pubertätsbedingt provozieren wollten“ (ebd.: 24).
Die sich darin widerspiegelnde Distanzierung mit Gelegenheiten der Kompensation eines Unbehagens kann sich auch als sekundärer Antisemitismus entfalten, dessen Repertoire
„von der Leugnung oder Relativierung des Holocaust über die Abwehr der Beschäftigung mit dem Thema und die Forderung nach einem Schlussstrich bis hin zur Täter- Opfer-Umkehr (reicht) [und] „dem Juden“ unterstellt, selbst schuld zu sein an seiner Verfolgung, bis heute Vorteile aus dem Holocaust zu ziehen, „die Deutschen“ quälen und bluten lassen zu wollen und dabei im Grunde heute mit den Palästinensern auch nichts anders zu machen, als das, was er doch selbst von den Nazis erleiden musste“ (Goldenbogen 2013: 34).
Die Distanzierung korrespondiert mit einem national-gesellschaftlichen Selbstverständnis, das die Shoah und den Nationalsozialismus als abgeschlossene, historisch eingrenzbare Geschichte ohne Genese und Nachwirkungen konstruiert. Die dominierende Nachkriegsnarration kann an einem „Mythos des Neuanfangs“ (Ha 2003: 56) festhalten und ein demokratisches Selbstverständnis mit Anschlüssen an die Ideale der Aufklärung herstellen, sodass der Anspruch verteidigt wird, nicht (mehr) antisemitisch – in der Gleichsetzung von Antisemitismus und Rassismus – nicht mehr rassistisch zu sein (Messerschmidt 2009: 61).
Die Perspektivendivergenz verweist darauf, dass die Perspektive im „Erleben von Antisemitismus aus der Sicht von jüdischen Communities“ weder öffentlich noch in wissenschaftlichen Diskursen eingebunden und hörbar artikuliert wurden (Chernivsky/Lorenz 2020: 24 f.). Mit der Objektifizierung hingegen wird deutlich, dass „Jüdinnen*Juden als Objekte der Bedürfnisse einer nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft“ behandelt werden (ebd.: 25). Dazu gehören öffentliche Sprechakte, Erinnerungsrituale sowie eine „Unfähigkeit, die selbstverständliche Präsenz, Heterogenität und Selbstbestimmtheit von Jüdinnen*Juden als Einzelne und Gemeinschaft zu verinnerlichen und anzuerkennen“ (ebd.). Dies potenziert sich in einer vereindeutigenden Reduktion, sodass „gegenwartsbezogene Belange der jüdischen Gemeinschaft“ und die „Kultivierung der Erinnerung“ (ebd.) nicht als zusammenhängende und notwendigerweise differenzierbare Gleichzeitigkeiten verhandelt werden können.
In ihrer Studie zu Deutungen und Umgangsweisen von Lehrer*innen mit Antisemitismus an Berliner Schulen zeigen Chernivsky und Lorenz auf, dass zwar ein Problembewusstsein über Antisemitismus an Schulen vorhanden ist (ebd.: 152), Lehrer*innen sich jedoch in einem „Spannungsfeld zwischen moralischen Ansprüchen und einem Distanzierungsbedürfnis von allen Fragen und Inhalten, die mit Antisemitismus einhergehen können, (bewegen)“ (ebd.: 154). Wirksam ist „eine starke biografische und emotionale Distanz von Antisemitismus als gegenwärtige Machtstruktur mit subjektiven und strukturellen Wirkungen und Gewalterfahrungen“ (ebd.).
Dieser Zusammenhang ist auch für den Umgang mit gegenwärtigen Erscheinungsformen des Rassismus an Schulen bedeutsam. Die Gleichsetzung der Shoah, des Nationalsozialismus und Rassismus führt dabei zu einer Negation, migrationsgesellschaftliche und gegenwärtige Erscheinungsformen des Rassismus als solche zu analysieren. Rassismus wird in die Vergangenheit der Staatsideologie des Nationalsozialismus verschoben (Messerschmidt 2010) und zugleich über eine Opfer-Konkurrenz-Logik verhandelt, sodass Differenzund Machtverhältnisse in ihrer zu historisierenden Sozialität, ihren Unterschieden, Verknüpfungen und Intersektionalitäten ausgeblendet werden. Sowohl für den gesellschaftlichen als auch wissenschaftlichen Diskurs seit den 1980er Jahre ist kennzeichnend, dass zwar „Vorbehalte in der einheimischen Bevölkerung und rechtsradikale Terroranschläge gegen Migranten“ (Terkessidis 2004: 13) diskutiert, der Rassismusbegriff jedoch aufgrund seiner Gleichsetzung mit der Shoah für nicht geeignet festgestellt wurde. Die Problematik besteht nicht darin, „Rassismus und [den] nationalsozialistischen, auf Vernichtung zielenden Antisemitismus aufeinander zu beziehen“ (Messerschmidt 2009: 62), sondern zu meinen, mit der Vergangenheit des Holocaust sei auch Rassismus Vergangenheit“ (ebd.: 62).
Diese Verwobenheiten und Gleichsetzungen verweisen neben der strukturellen Stabilität des Rassismus und des Antisemitismus und ihrer reproduzierenden Wirkungskraft auf drei für die schulische Praxis und für die Lehrer* innenbildung bedeutsame Mechanismen: (1) Nicht nur im Umgang mit Rassismus erfolgt eine Verschiebung in die Vergangenheit, die strukturelle Dimensionen des Rassismus, seine Kontinuitäten, flexiblen Erscheinungsformen und positionalen Involviertheiten sozialer Akteur*innen ausblendet. Auch für den gegenwärtigen Antisemitismus problematisieren Chernivsky und Lorenz (2020) die sich etablierende Verwendung des antisemitischen Vorfalls. Zwar ermögliche er antisemitische Gewaltdynamiken und Ausmaße antisemitischer Exzesse zu erfassen, allerdings suggeriert er, „eine vermeintliche Unregelmäßigkeit oder auch Abgegrenztheit einzelner Vorfälle und vermag damit die Kontinuität, Struktur und Alltäglichkeit des Antisemitismus nicht ausreichend zu vermitteln“ (ebd.: 11).
(2) Der schulische Umgang mit Rassismus und Antisemitismus kann sich mit schul- und familienbiografischen Erfahrungskonstellationen der Lehrer* innen verstricken. Marina Chernivsky (2018) zeigt für die Bildungsarbeit zu Antisemitismus auf, dass familienbiografische und affektive Verstrickungen als Folgewirkungen des Nationalsozialismus kaum berücksichtigt werden, sodass deren Einflüsse auf Bildungsprozesse und pädagogische Gestaltungsmöglichkeiten ausgeblendet werden. Eine These, die aus eigenen Erfahrungen in der rassismuskritischen Lehre im Lehramtsstudium bestätigt werden kann, jedoch ein zentrales Desiderat in der erziehungswissenschaftlichen Professionalisierungsforschung darstellt.
(3) In dieser Gemengelage zwischen alltagsrelevanten Verständnisweisen des Rassismus und Antisemitismus sowie schul- und familienbiografischen Verstrickungen konstituiert sich die fachspezifische Vermittlung der Shoah und des Nationalsozialismus. Analysen zeigen, dass die unterrichtspraktische Auseinandersetzung mit der Shoah und dem Nationalsozialismus maßgeblich im Einsatz gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus umgesetzt wird (etwa Eckmann/Kößler 2020). Wirkmächtig ist „die Vorstellung […], das Lernen über den Nationalsozialismus und die Shoah (…) zwangsläufig gegen Antisemitismus immunisieren (könne)“ (Chernivsky/Lorenz 2020: 21). Diese Verknüpfung ist aufgrund eines Lehr-Lern-Settings problematisch, der potentiell von „widersprüchlichen Narrationen, diffusen und unbehaglichen Emotionen und Schweigepraktiken begleitet wird“ (ebd.). So könne die „Holocaust-Erziehung“ junge Menschen zwar „für die Gefahren des Antisemitismus sensibilisieren, aber nie dagegen ‚immunisieren‘“ (Wetzel 2008).
Reflexionswürdig ist zudem die Erwartung an Schüler*innen (Gryglewski 2018), Empathie mit Opfern des Genozids zu entwickeln, die für das professionelle Handeln in Schulen allerdings kaum didaktisch aufbereitet ist. Daher betonen auch Eckmann und Kößler (2020) die Notwendigkeit, in Lehr-Lern- Settings zwischen Nationalsozialismus, Holocaust und gegenwärtigen Erscheinungsformen des Antisemitismus zu differenzieren. Das Potential einer historischen Auseinandersetzung, „Bewusstsein und Wissen über politische Prozesse der Radikalisierung von Rassismus und Antisemitismus zu schaffen […] verfehlt häufig genau diese Chance, weil sie die Forderung von Empathie mit politischer Bildung verwechselt“ (ebd.: 13). Dennoch bleibt eine beständige Aufforderung, eine schulisch Praxis der Erinnerung zu kultivieren (Chernivsky/ Lorenz 2020: 25), die nicht der Illusion aufsitzt, die Vergangenheit vollends hinter sich gelassen zu haben (vgl. Brumlik/Chernivsky/Czollek/Peaceman/ Schapira/Wohl von Haselberg 2018).
___
1 Die Begriffsverwendungen Shoah und Holocaust sind nicht identisch. Vielmehr dokumentiert sich an ihnen ein kontroverser Diskurs um problematisierende Bezeichnungen (vgl. Benedikt 2011; Wetzel 2008).
***
Sie möchten gern weiterlesen?