Wie lässt sich Sexualität im Ausbildungskontext von Care-Fachkräften erfassen und als Thematik angemessen in den Arbeitskontext intergrieren? Eine Leseprobe aus Angewandte Sexualwissenschaft für Care-Berufe. Ein Lehr- und Arbeitsbuch von Stefan Hierholzer.
***
1 Sexualität geht nur interdisziplinär – Annäherung an einen schwammigen Begriff
Sexualität ist eine lebenslange humane Entwicklungsaufgabe, die zwischen Kultur und Natur verortet ist. Im Gegensatz zum Tier sind Menschen nicht ausschließlich Instinktwesen, sie sind vielmehr instinktarme Wesen, die auf Bildung und Sozialisation essenziell angewiesen sind, wie Roth (1991) auf den Punkt bringt: „Dem Menschen sind […] keine festgelegten Triebziele angeboren; er bringt keine festgelegten Wertehaltungen und Werteeinstellungen mit auf die Welt“ (Roth 1991: 117). Rüdiger Lautmann argumentiert gar, dass der Sexualbegriff nicht definierbar sei (vgl. Lautmann 2002). Daher ist es sinnvoll, keine Definition des Sexualbegriffs anzubieten, sondern vielmehr eine interdisziplinäre Begriffsannäherung zu unternehmen, die die menschliche Soziosexualität herausarbeitet (vgl. Kentler 1973).
1.1 Dimensionsperspektive 1: (Sozial-)Pädagogik
Es ist eine zentrale Grundannahme der Pädagogik, dass Menschen gelehrige Wesen sind, die zwischen Lernbegeisterung („Man kann nicht nicht lernen“) und Lernnotwendigkeit stehen. Goerttler (1984) begründet eine Sonderstellung gegenüber dem Tier biologisch, da der Mensch spezifische Merkmale besitze, die ihm eine Sonderstellung ermöglichten, und zwar:
- Aufrechte Körperhaltung
- Wortsprache
- Denkvermögen
- Planvolles Handeln
- Umweltbeherrschung
- Lernfähigkeit
Gerade die große Lernfähigkeit, die den Menschen ein Leben lang gegeben ist, macht sie zu Gehirnwesen (vgl. Treml 1987): „Der Mensch ist also in erster Linie ein Gehirnwesen und kein Sinnwesen. […] Die interne Umweltverarbeitung des Menschen ist um das 100.000-Fache leistungsfähiger als die externe durch die Sinne. […] Das Gehirn ist also des Menschen wichtigstes Sinnesorgan!“ (ebd.: 48).
Die Fähigkeiten des Gehirns sind aber nicht biologisch abgeschlossen, sondern bedürfen der Interaktion mit einem Außen, damit das biologisch determinierte Material seine Fähigkeiten entfalten kann: „In Gang gebracht wird die Selbstorganisation des Gehirns durch seine Interaktion mit der Umwelt. Diese Umweltabhängigkeit macht das Gehirn zu einem […] sozialen Organ. Man spricht auch vom ‚sozialen Gehirn‘“ (Speck 2008: 17). Diese soziale Perspektive auf neuronale Abläufe ist im Zusammenhang mit Sexualität unverzichtbar, da sie den Weg für pädagogische Interventionen eröffnet. Menschliche Existenz als Lernexistenz, die auch biologisch auf soziales Lernen determiniert ist, stellt eine Grundlage sexueller Bildung dar. Evolutionsbiologische Anleihen, die der Mensch in Form von Instinktresten mitbringt, spielen für Fragen von Sexualität und Lust ebenfalls eine Rolle. Auch wenn der Mensch als instinktreduziertes Wesen bezeichnet werden kann, sind Teile dieser Instinkte weiterhin in ihm angelegt. „Dem Menschen sind […] keine festgelegten Triebziele angeboren; er bringt keine festgelegten Wertehaltungen und Werteeinstellungen mit auf die Welt“ (Roth 1991: 117).
Zugleich ist der Mensch sowohl organisch unspezialisiert als auch unfertig, d.h., seine Entwicklung geht auch nach der Geburt sowohl in körperlicher als auch in geistiger Hinsicht weiter: „Es fehlt das Haarkleid und damit der natürliche Witterungsschutz; es fehlen natürliche Angriffsorgane, aber auch eine zur Flucht geeignete Körperbildung; […] er hat einen geradezu lebensgefährlichen Mangel an echten Instinkten […] mit anderen Worten: innerhalb natürlicher, urwüchsiger Bedingungen würde er als bodenlebend inmitten der gewandtesten Fluchttiere und der gefährlichsten Raubtiere schon längst ausgerottet sein“ (Gehlen 2009: 33). Unter dieser Perspektive und aufgrund seiner physiologischen Frühgeburt ist der Mensch anderen Tieren, bspw. Meerschweinchen, unterlegen. Portmann bezeichnet den Menschen daher als hilflosen Nestflüchter, der nur in der Gruppe überlebensfähig wird (vgl. Portmann 1956). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Mensch bereits als biologisches Mangelwesen auf Hilfeleistungen durch seinesgleichen angewiesen oder auch erziehungsbedürftig ist. „Erziehungsbedürftigkeit meint: Der Mensch braucht Erziehung, um das ihm als Aufgabe gegebene Menschsein ausformen, ausprägen zu können. Der Mensch kommt nicht als ‚fertiges Lebewesen‘ in die Existenz, sondern als ‚lebendige Möglichkeit‘; Menschsein heißt Mensch-Werden“ (Badry 2003: 166).
Mit dem von Badry formulierten Menschwerden ist eine zentrale pädagogisch-philosophische Annahme formuliert, die den Menschen als prozesshaft-lernendes Subjekt versteht, das sich seine Welt (mit anderen) aneignet. Dieses Paradigma wird heute als ko-konstruktivistische Perspektive bezeichnet. Folglich wird davon ausgegangen, dass Menschen miteinander und voneinander lernen, zugleich aber immer auch individuelle Weltkonstruktionen erschaffen. Diese Konstruktionsleistung erbringt der Mensch auch bezogen auf Sexualität.
Der Mensch ist aus evolutionsbiologischer Perspektive einerseits ein instinktarmes und unfertiges Wesen, das in nicht urbaner Umgebung tierischen Lebewesen unterlegen wäre. Zeitgleich hat er eine Sonderstellung inne, da sein Gehirn eine hohe Neuroplastizität aufweist, was den Menschen neugierig und lernfähig macht. Voraussetzung zur vollen Entfaltung der geistigen Leistungsfähigkeit ist ein aktivierendes Gegenüber, das Bildungs- und Lernprozesse anregt.
Der Begriff der Sexualität wird erstmals 1820 vom Botaniker August Henschel in dessen Werk Von der Sexualität der Pflanze verwendet. In dieser Publikation unterscheidet Henschel männliche und weibliche Pflanzen voneinander und beschreibt deren gegensätzlichen Aufgaben bei der Fortpflanzung (vgl. Bange 2000). Dieser aus der Biologie stammende Sexualbegriff hat bis heute Auswirkungen. Dies zeigt sich beispielsweise an der immer noch bestehenden binären Geschlechtervorstellung, wenngleich seit den 1990er Jahren die geschlechtliche Polarisierung von männlich vs. weiblich immer mehr in Frage gestellt wird und sexuelle Vielfalt und Diversität an Bedeutung im Diskurs gewinnen (vgl. Tudier et al. 2012; Voß 2011). Vor allem durch das Christentum hat sich in den letzten Jahrtausenden die Biologisierung und Verengung von Sexualität auf Fortpflanzungssexualität zu einem starken Narrativ entwickelt. Dieser Weltzugang ist jedoch für die menschliche Soziosexualität zu unterkomplex. Dass Sexualität vielfältig ist, zeigt bereits Offit: „Sexualität ist, was wir daraus machen. Eine teure oder eine billige Ware, Mittel zur Fortpflanzung, Abwehr gegen Einsamkeit, eine Form der Kommunikation, ein Werkzeug der Aggression (der Herrschaft, der Macht, der Strafe und der Unterdrückung), ein kurzweiliger Zeitvertreib, Liebe, Kunst, Schönheit, ein idealer Zustand, das Böse oder das Gute, Luxus oder Entspannung, Belohnung, Flucht, ein Grund der Selbstachtung, eine Form von Zärtlichkeit, eine Art der Regression, eine Quelle der Freiheit, Pflicht, Vergnügen, Vereinigung mit dem Universum, mystische Ekstase, Todeswunsch oder Todeserleben, ein Weg zum Frieden, eine juristische Streitsache, eine Form, Neugier und Forschungsdrang zu befriedigen, eine Technik, eine biologische Funktion, Ausdruck psychischer Gesundheit oder Krankheit oder einfach eine sinnliche Erfahrung“ (Offit 1979: 16).
Offits Darstellung der sexuellen Vielfalt macht deutlich, dass Sexualität historischen und kulturellen Wandlungen unterliegt und divergierende menschliche Bedürfnisse umfasst. Demnach wird auch das Sexuelle individuell konstruiert und erlernt und zugleich in gesellschaftliche Rahmungen eingebettet. Sexualität kann als zentrales Bedürfnis menschlicher Existenz gelten, das an der Schnittstelle zwischen natürlich gegebenen (trieb- bzw. instinkthaft) und gesellschaftlich-individuell hergestellten Denk- und Handlungsweisen verstanden werden kann (vgl. Schmerl et al. 2000: 11).
Der Wahrnehmung der Sexualität kommt gerade im sozialen Kontext eine zentrale Bedeutung zu. In organisierten Settings wie Kindergärten, Altenheimen oder Einrichtungen der Behindertenhilfe wird Sexualität jedoch häufig negiert, da Menschen in diesen Settings noch nicht, nicht mehr oder noch nie in der Lage waren, ihre sexuellen Bedürfnisse angemessen zu formulieren. Auch in Einrichtungen der Straffälligenhilfe oder in Heimen besteht die Gefahr, sexuelle Grundbedürfnisse in Anlehnung an totale Institutionen zu unterdrücken oder unsichtbar zu machen (vgl. Goffman 1973; Geifrig 2003; Stöver 2012; Döring 2006). Ausgehend von der anthropologischen, bedürfnisorientierten und biologischen Perspektive und der Tatsache, dass Organisationen dazu neigen, Sexualität zu tabuisieren oder zu negieren, muss Sozialpädagogik als Menschenrechtsprofession Sexualität und sexuelle Bildung gewährleisten (vgl. Staub-Bernasconi 2018).
***
Sie möchten gern weiterlesen?

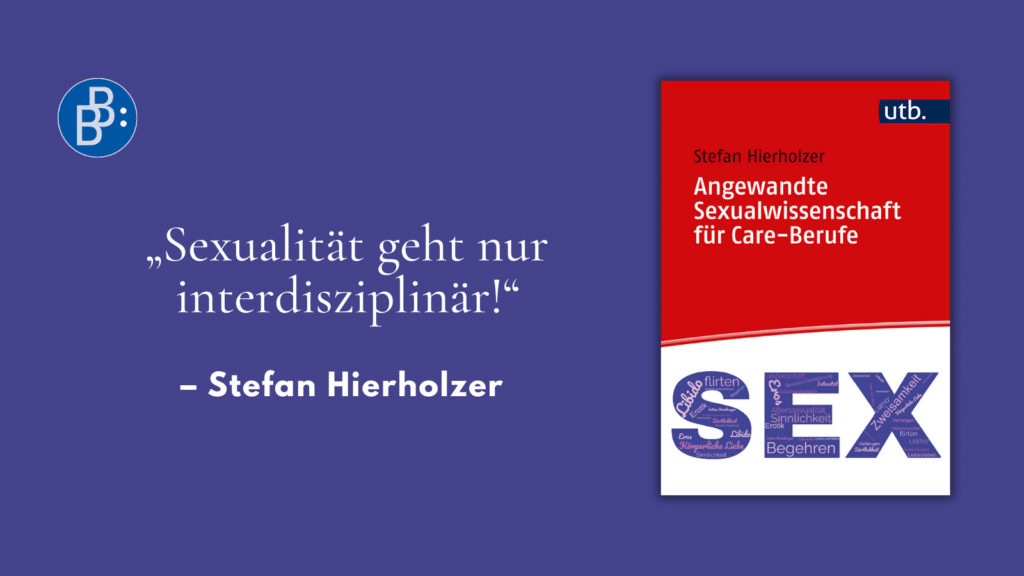
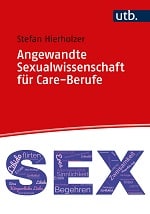 Stefan Hierholzer:
Stefan Hierholzer: