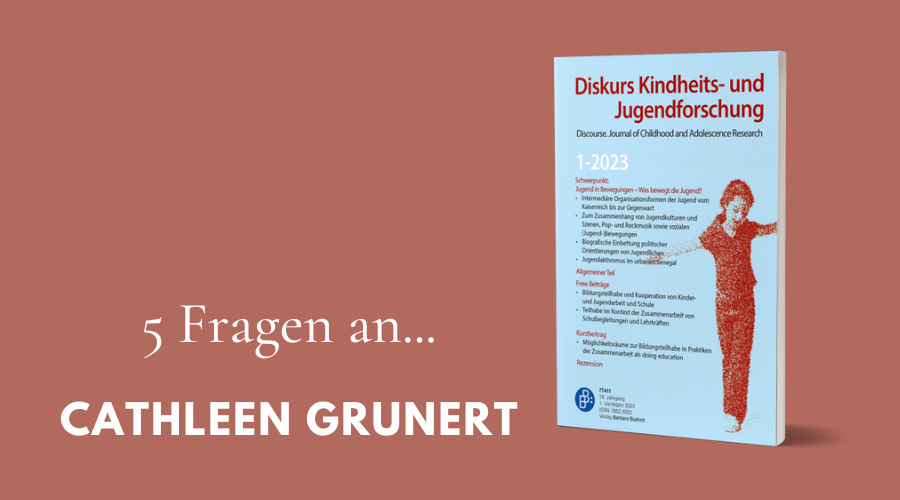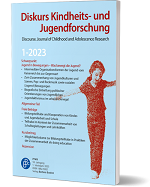Wie ist die Beitragsauswahl bei der Zeitschrift Diskurs Kindheits- und Jugendforschung strukturiert und organisiert? Worauf legt die Redaktion bei eingereichten Beiträgen besonderen Wert? Wir haben mit der geschäftsführenden Herausgeberin Cathleen Grunert gesprochen.
Über die Zeitschrift Diskurs Kindheits- und Jugendforschung
Die Anfang 2006 gegründete Zeitschrift Diskurs Kindheits- und Jugendforschung | Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research beleuchtet die Situation und die zukünftige Entwicklung der nachwachsenden Generationen in den modernen Gesellschaften sowie die besonderen sozialen und politischen Problemlagen, in denen sich Kinder und Jugendliche heute mitunter befinden.
Liebe Cathleen Grunert, womit befasst sich die Zeitschrift Diskurs Kindheits- und Jugendforschung thematisch?
Die Zeitschrift versteht sich als Forum für wichtige Ergebnisse der Kindheits- und Jugendforschung, für Theoriebildung und für Fragen der gesellschafts- und bildungspolitischen sowie pädagogischen Praxis. Sie widmet sich damit also Themen rund um die Phasen im Lebenslauf, die wir als Kindheit und Jugend bezeichnen und ist deshalb ein Publikationsmedium für wissenschaftliche Beiträge, die sich aus ganz unterschiedlichen theoretischen, empirischen und disziplinären Perspektiven diesem Gegenstandsfeld nähern. Den Gründer:innen der Zeitschrift war es damals, im Jahr 2006, wichtig, einen wissenschaftlichen Ort zu schaffen, an dem gerade Kinder und Jugendliche in ihren differenten lebensweltlichen Realitäten, ihren institutionellen Einbindungen und ihren Entwicklungsverläufen im Zentrum stehen. Begründet wurde das damals damit, dass Kinder und Jugendliche in modernen Gesellschaften „unter zuvor nie gekannten, komplizierten Bedingungen“ aufwachsen und die „technisch und kommunikativ entgrenzte Wissensgesellschaft und die fortschreitende ökonomische und kulturelle Globalisierung“ Heranwachsende herausfordern. Das hat sich sicher bis heute weiter potenziert. Hinzu kommen die vielfältigen Folgeprobleme von Klimawandel und Krieg, die junge Menschen global gesehen ganz besonders betreffen. Insofern besteht der Anlass für eine solche Zeitschrift mehr denn je. Zu Wort kommen bei uns deutsche und internationale Autor:innen aus den einschlägigen Disziplinen Erziehungswissenschaft, Soziologie oder Psychologie, wobei das inter- und transdisziplinäre Gespräch auch mit anderen Disziplinen wie etwa der Ethnologie, der Kommunikations- und Medienwissenschaft oder auch der Sozialgeographie gesucht wird.
Welche Rolle und Aufgaben haben Sie innerhalb des Herausgeber*innen-Kreises inne? Seit wann sind Sie dabei und welche Bereiche betreuen Sie?
Im Herausgebendenkreis bin ich eigentliche erst seit 2020. Vorher war ich lange Zeit Mitglied im Beirat der Zeitschrift. Nach meinem Wechsel von der Fernuniversität in Hagen nach Halle bin ich dann auch gleich geschäftsführende Herausgeberin geworden. Die Geschäftsführung wechselt beim Diskurs in zeitlichen Abständen, da leider niemand die Ressourcen hat, diese arbeits- und zeitintensive Aufgabe auf Dauer zu bewältigen. Man macht das ja sozusagen im Ehrenamt und setzt dafür auch seine Mitarbeiter:innen ein. In diesem Zusammenhang möchte ich mich gleich ganz besonders bei Janine Stoeck bedanken, die in den letzten 2,5 Jahren die Redaktion übernommen hat und mit mir gemeinsam das Projekt gestemmt hat, das gleiche gilt für Kilian Hüfner und Anne Schippling im Lektorat und Petra Olk, die sich um die Rezensionen und Kurzbeiträge gekümmert hat. Geschäftsführung und Redaktion heißt, man kümmert sich eigentliches um alles, was mit dem Erscheinen der Hefte zu tun hat: man organisiert die Begutachtung der Beiträge, schätzt ein, ob ein Beitrag schon druckreif ist, stellt die Hefte jeweils zusammen, lektoriert und unterhält die Verbindung zum Verlag. Ohne ein hohes Engagement der Beteiligten ist das gar nicht machbar. Wir werden jetzt zum 1. Oktober 2023 den Staffelstab an Prof. Dr. Johanna Mierendorff übergeben. Da wir am selben Institut arbeiten, haben wir einen kurzen Draht, um den Übergang gut hinzubekommen.
Wie ist die Beitragsauswahl beim Diskurs strukturiert und organisiert? Worauf legen Sie und die Redaktion bei eingereichten Beiträgen besonderen Wert?
Die Zeitschrift Diskurs Kindheits- und Jugendforschung arbeitet mit Schwerpunktausgaben, um spezifische Themen in der nötigen Breite und Differenziertheit behandeln zu können. Weitere Beiträge erscheinen im „Freien Teil“. Kurzberichte informieren über aktuelle, interessante Projekte und mitunter über Konfliktthemen sowie vernachlässigten Forschungsbereiche. Der Rezensionsteil widmet sich der Vorstellung und Einschätzung aktueller, ausgewählter, thematisch relevanter Literatur.
Zu den einzelnen Teilen vielleicht noch etwas mehr: Vorschläge für Schwerpunkthefte kommen nicht nur aus dem Herausgebendenkreis, sondern Forschende, die im Themenfeld der Zeitschrift tätig sind, können Vorschläge einreichen und Hefte, auch gemeinsam mit den Herausgebenden der Zeitschrift, verantworten. Dazu braucht es ein Konzept und Ideen für etwa 8 Beiträge und potentielle Autor:innen. Im Herausgebendenkreis besprechen wir das dann und entscheiden darüber, ob daraus ein Schwerpunktheft werden kann. Die Gastherausgebenden sind dann in den ganzen Prozess bis zum Erscheinen mit eingebunden. Die Schwerpunkt- und die Freien Beiträge gehen dann ins Reviewverfahren, das als Double-Blind-Verfahren angelegt ist, also weder die Autor:innen wissen, wer die Gutachtenden sind, noch die Gutachtenden wer die Autor:innen sind. Bei den Beiträgen legen wir nicht nur Wert auf thematische Passung zur Zeitschrift, sondern auch auf nachvollziehbare und begründete methodische und theoretische Zugänge sowie die Relationierung des eigenen Zugangs zu bestehenden Forschungsbefunde und Theoriediskussionen.
Freie Beiträge kann man jederzeit einreichen, ebenso wie Kurzbeiträge und Rezensionen.
Es sind also alle herzlich eingeladen, sich am Diskurs Kindheits- und Jugendforschung mit Beiträgen zu beteiligen.
Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage und die Zukunft von wissenschaftlichen Zeitschriften? Wo sehen Sie hierbei den Diskurs?
Wissenschaftliche Zeitschriften sind eine sehr gute Möglichkeit, aktuelle wissenschaftliche Befunde in der Community zur Diskussion zu stellen. Vor allem weil sie nicht auf bereits geronnenes Handbuchfähiges Wissen fokussieren, fördern sie den kritischen wissenschaftlichen Austausch. Wissenschaftliche Zeitschriften wie der Diskurs haben auch die Möglichkeit, aktuelle Themen schneller in den Blick zu nehmen und neue Forschungsfelder zu erschließen. Dabei halte ich es aber für wichtig, dass Zeitschriften nicht in einer konkreten Perspektive auf das jeweilige wissenschaftliche Feld verharren, sondern möglichst einen breiten Diskurs im Hinblick auf methodische, theoretische und disziplinäre Zugänge als auch inhaltliche Themen abbilden. Der Diskurs versucht hier Kindheits- und Jugendforschung in ihrer Vielfalt zu präsentieren und in immer wieder neuen Perspektiven aufzugreifen.
Welche Rolle spielt das Thema Open Access innerhalb des Herausgeber*innen-Kreises und der Redaktion?
Für die herausgebenden ist Open Access durchaus eine wichtige Option, um Beiträge schneller und kostenlos einem breiteren Publikum zugänglich machen zu können. Das senkt Zugriffshürden und minimiert Ungleichheiten im Zugang zu wissenschaftlichen Befunden. Der Diskurs ermöglicht zumindest nach 2 Jahren einen Open Access Zugang für alle Beiträge, das ist schon eine sehr gute Sache, aber eben leider eben nicht so aktuell. Ein schnelleres Open-Access Verfahren wäre durchaus wünschenswert, kollidiert aber natürlich mit den Interessen des Verlages oder von Verlagen generell, was auch sehr gut nachvollziehbar ist. Die Frage der Finanzierung steht hier natürlich an erster Stelle. Open-Access-Publikationen können dann sicher nur in Teilen sinnvoll sein und bestehende Angebote zwar ergänzen, aber nicht ersetzen. Hier stehen aus meiner Sicht tragfähige Lösungen für alle Beteiligten noch aus.
Kurzvita von Cathleen Grunert in eigenen Worten

Ich war, nachdem ich lange Zeit in Halle tätig war, für 5 Jahre auf einer Professur für Allgemeine Bildungswissenschaft an der FernUniversität in Hagen. Das war ein spannende Zeit, da Uni dort ganz anders funktioniert und man sich erst einmal neu in Sachen Lehre orientieren muss. Die Studierenden arbeiten dort v.a. online, bekommen aber sogenannte Studienbriefe als Arbeitsgrundlage. In meiner Zeit dort habe ich zusammen mit externen Autor:innen solche Studienbriefe erstellt, die alle auch bei Barbara Budrich in 2 UTB-Reihen erschienen sind. Das war eine tolle Zusammenarbeit und ich freue mich sehr, dass die Studienbriefe so ein breiteres Publikum erreichen können. Eine Reihe gibt es zu den Grundlagen der Erziehungswissenschaft mit 4 Bänden von Heinz-Hermann Krüger, Birgitta Fuchs, Peter Vogel und Arnd-Michael Nohl. Eine zweite zu Professionalisierung und professionellem Handeln mit 3 Bänden von Werner Helsper, Fritz Schütze, Jörg Dinkelaker, Till-Sebastian Idel, Kai-Uwe Hugger, Anna Schütz und Silvia Thünemann.
In dieser Zeit war ich auch Mitglied der Sachverständigenkommission zur Erstellung des 15. Kinder- und Jugendberichts und danach auch in der des 3. Engagementberichts der Bundersregierung. Beides spannende Aufgaben, bei denen ich meinen Forschungsschwerpunkt Jugendforschung noch einmal auf andere Weise einbringen konnte. Ich war in dieser Zeit aber mit einem DFG-Projekt befasst, dass sich mit Frage beschäftigt hat, wie sich die Hochschulreform im Zuge der Bolognaerklärung auf die Entwicklung der Disziplin Erziehungswissenschaft auswirkt, ob und wie sich also durch solche externen Eingriffe auch Wissenschaftsdisziplinen wandeln. 2020 bin ich dann mitten im Coronalockdown auf die Professur für ‚Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt soziokulturelle Bedingungen von Erziehung und Bildung‘ nach Halle gewechselt. Hier habe ich in den letzten drei Jahren zwei von verschiedenen Bundesministerien finanzierte Projekte zu Jugend in ländlichen Regionen durchgeführt, einmal mit Blick auf kulturelle Bildung und einmal mit Fokus auf Jugendengagement und Digitalisierung. Dies hat spannende Einblicke in die Herstellungsprozesse von Möglichkeits-, aber auch Begrenzungsräumen für kulturelle Bildung und Engagement von Jugendlichen unter den Bedingungen strukturschwacher ländlicher Regionen eröffnet. Im Mai diesen Jahres habe ich zusammen mir Prof. Dr. Heinz-Hermann Krüger und Dr. Katja Ludwig ein DFG-gefördertes Projekt begonnen, in dem wir uns den politischen Orientierungen von Jugendlichen und ihren Herstellungskontexten im Spannungsfeld von Peergroups und der Familie anschauen. Dies ist sicher vor dem Hintergrund der aktueller Entwicklungen im politischen und gesellschaftlichen Miteinander ein wichtiges Thema, da es auf die Frage nach der Entwicklung gesellschaftlicher Ordnungsvorstellungen im Jugendalter zielt.
Jetzt im Budrich-Shop bestellen
© Foto Cathleen Grunert: privat | Titelbild gestaltet mit canva.com