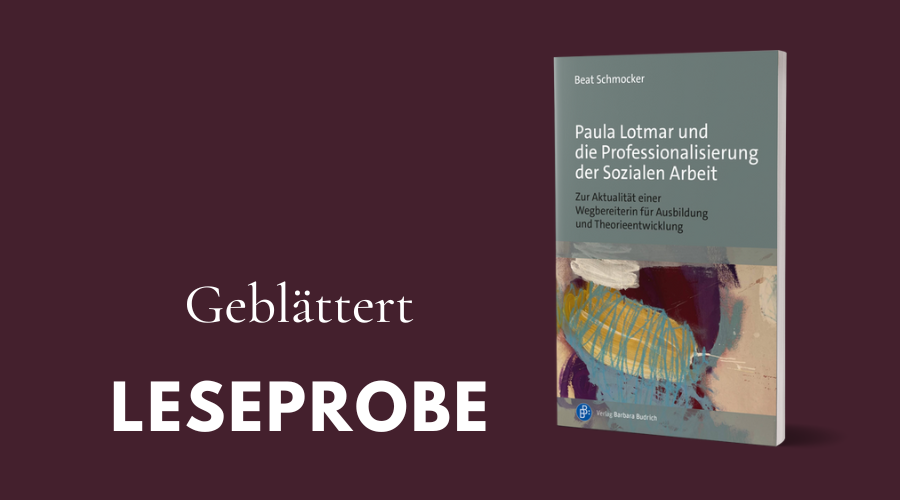Einblick in die wegweisenden Texte einer der bedeutendsten Fachpersonen der Sozialen Arbeit in der Schweiz: eine Leseprobe aus Paula Lotmar und die Professionalisierung der Sozialen Arbeit. Zur Aktualität einer Wegbereiterin für Ausbildung und Theorieentwicklung von Beat Schmocker.
***
Paula Lotmar und die Professionalisierung der Sozialen Arbeit: Prolog
Wenn in meinem Seminar zur Geschichte der Sozialen Arbeit jeweils von den international bekannten Pionierinnen, z.B. den amerikanischen Jane Addams und Mary Richmond, der deutschen Alice Salomon oder der österreichisch-ungarischen Ilse Arlt (vgl. PV, S. 111) die Rede war, stand häufig die Frage im Raum: Und, wer sind denn die schweizerischen Pionierinnen der Sozialen Arbeit? Welche wegweisenden Entwicklungen für die Soziale Arbeit, für ihre Lehre oder ihre Praxis, haben ›unsere‹ Avantgardistinnen angestoßen?
Einige Studentinnen stellten 2002 dann eigene Recherchen an und stießen auf die Gründerinnen der Schulen für Soziale Arbeit in der Schweiz, Maria Croenlein in Luzern, Marguerite Wagner-Beck in Genf und Mentona Moser, Maria Fierz und Marta von Meyenburg in Zürich. Doch sie gaben sich nicht zufrieden; das seien lediglich Pionierinnen im Bereich der Schulgründungen, aber noch keine Avantgardistinnen der Theorieentwicklung der Sozialen Arbeit.
Und als dann einige noch tiefer gruben, fanden sie eine vage Spur. Sie machten eine Laudatio auf eine gewisse Paula Lotmar aus Zürich ausfindig. Die sei ab den 1960er-Jahren für die Schulen der Sozialen Arbeit außerordentlich bedeutsam gewesen, habe auf internationaler Ebene durchaus mitgehalten und dort wichtige Beiträge für die Entwicklung ihres Faches beigesteuert. Und sie sei damals – dieser Laudatio nach – die wohl interessanteste, anregend klügste und wichtigste Fachfrau der Sozialen Arbeit in der Schweiz gewesen. Ihre gelehrten, lebensklugen und kultivierten Texte hätten von ihrer gründlichen wissenschaftlichen Bildung gezeugt. Vor allem aber würden Generationen von Studierenden ihrer Lehre und Lernbegleitung beruflich nahezu alles verdanken.
Und meine Studentinnen fragten mich, weshalb sie von dieser Paula Lotmar nichts zu wissen bekämen; ob sie denn wenigstens mir bekannt sei.
Tatsächlich bin ich Paula Lotmar zu Beginn meines Studiums an ›ihrer‹ Schule in Zürich lediglich wenige Male persönlich begegnet. Aber wir kamen nicht zusammen; zwischen uns lagen ›Welten‹. Für sie war es das Ende einer langjährigen, förderlichen und ertragreichen Lehrtätigkeit. Für mich war es der Beginn einer spannenden Reise in völlig unbekanntem Neuland, wozu mir noch jegliche Orientierung fehlte. Was sie mir zu sagen gehabt hätte, konnte ich noch nicht verstehen. Jedenfalls gab es damals einfach keine Veranlassung, mich mit ihr und ihrem Werk auseinanderzusetzen.
Doch auch gut zwanzig Jahre später, als mir die Studentinnen den Ball zuspielten und mich direkt aufforderten, dieser Schweizer Pionierin nachzugehen, sah ich dazu immer noch keine Veranlassung. Auch nicht nochmals ein Dutzend Jahre später, als ich im Rahmen einer Recherche zur Entstehungsgeschichte der internationalen IFSW/ IASSW-Definitionen der Sozialen Arbeit (vgl. Schmocker, in: Portmann & Wyrsch 2019:74ff.) auf eine Studie von Paula Lotmar aus dem Jahr 1963 stieß, die sich dieser Thematik annahm. Immerhin führte mir diese Studie, vor dem Hintergrund des damaligen weltweiten Fachdiskurses, aus der dann eine nachhaltige Expertise für eine globale Definition hervor ging, deutlich vor Augen, dass Paula Lotmar mit ihrer Sicht auf die Soziale Arbeit ihrer Zeit weit voraus gewesen sein musste. Nach und nach entdeckte ich sogar einige Spuren ihrer aktiven Teilnahme an diesem Diskurs.
Und als ich weitere Zeugnisse über sie las, konnte ich deutlich erkennen, mit wieviel Liberalität, Weisheit und Nachsicht sie es offensichtlich immer wieder aufs Neue erreichte, die angehenden Fachpersonen der Sozialen Arbeit ›richtig auf die Schiene zu stellen‹ und ihnen den von ihrer eigenen Leidenschaft genährten Funken zu übertragen, mit dem sich manche ihrer Studierenden das Feuer einer starken und tragfähigen Berufsidentität entfachen konnten.
Weil auch dies nicht zum entscheidenden Impuls reichte, mich gezielt mit Paula Lotmar und ihrem Werk auseinander zu setzen, vergingen weitere Jahre, während denen ich noch mit einigen ihrer Wegbegleiterinnen und Zeit-Zeugen hätte sprechen können. Erst 2016 machte ich mich dann gezielt auf eine Spurensuche nach dem Werk dieser Schweizer Pionierin der Sozialen Arbeit.
Dass sich anfänglich nichts finden ließ, das auch nur annähernd auf das ›Große‹ hingedeutet hätte, was Paula Lotmar für die Soziale Arbeit leistete, überraschte mich nicht so sehr: es schien zunächst nur ein weiteres bedenkliches Zeugnis des andauernden ›Unsichtbar- Machens‹ der Leistungen von Frauen zu sein. Bei der Sichtung des Nachlasses von Paula Lotmar musste ich dann allerdings zutiefst erstaunt feststellen, dass sie diesen eigenhändig, übertrieben selbstkritisch, selektiert hatte.
Hingegen machte bereits ein erstes flüchtiges Einlesen in ihre noch zugänglichen Texte (vgl. WV, S. 115) sofort deutlich, dass hier offensichtlich ein Fundus vorliegt, der sich problemlos in den aktuellen Fachdiskurs würde eingliedern lassen. Diese Kostbarkeit wollte ich wenigstens ans Licht holen.
***
Sie möchten gern weiterlesen?
Jetzt versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
 Beat Schmocker:
Beat Schmocker:
Der Autor
Beat Schmocker, Sozialarbeiter und Sozialarbeitswissenschaftler, Professor für Theorie und Ethik Sozialer Arbeit, Emeritus an der Hochschule Luzern, Schweiz
Über „Paula Lotmar und die Professionalisierung der Sozialen Arbeit“
Wieso eigentlich wird Paula Lotmar verunsichtbart? Der vorliegende Band gibt einen Einblick in die wegweisenden Texte einer der bedeutendsten Fachpersonen der Sozialen Arbeit in der Schweiz. Lotmars innovative und inspirierende Werke prägten Generationen von Studierenden und stellen auch heute eine Bereicherung für Lehre und Forschung dar.
Mehr Leseproben …
… finden Sie auf unserem Blog.
© Titelbild: gestaltet mit canva.com