von Jürgen Beushausen
Über das Buch
Der Umgang mit traumatisierten Personen – in vielen psychosozialen Arbeitsfeldern gehört das zum Berufsalltag. Die Notwendigkeit, wichtige Personen, insbesondere Familienangehörige, in die Beratung einzubeziehen, bildet die Grundannahme dieses Buchs. Der Autor stellt typische familiäre Problemmuster vor und erörtert verschiedene Interventionsebenen: die Psychoedukation, die akuten Hilfen, die Krisenintervention, die Stabilisierung und die Emotionsregulierung. Der Band bietet damit eine kompakte Einführung für Studierende und psychosoziale Fachkräfte.
Leseprobe aus den Seiten 65 bis 68
***
5 Hinweise für die Beratung
In diesem Kapitel werden verschiedenste Hinweise im Kontext der Beratung von traumatisierten Menschen gegeben. Akute Hilfen sollten frühzeitig erfolgen, hierauf wird im Kapitel 6.1 näher eingegangen. Bei vielen der im Weiteren vorgestellten Thematiken können Paar- oder Familienberatungen (bzw. Therapien) nützlich sein. Eine traumasensible Beratung kann z.B. helfen Streitmuster zu unterbrechen oder Formen eines Dissoziationsstopps vermitteln. Traumaberatung richtet sich zunächst an die Familienangehörigen, wobei auch die Geschwistersubsysteme zu fokussieren sind. Die Beratung kann sich jedoch an weitere relevante Personen, wie zum Beispiel Freund*innen der betroffenen Kinder oder die Großeltern richten. Oftmals werden von den Angehörigen oder Mitgliedern der sozialen Netzwerke typische Symptome einer Traumatisierung nicht richtig eingeordnet und verstanden. Dieses mangelnde Verständnis oder auch Desinteresse kann zu weiteren Problemen und Spannungen in den Familien beitragen. Für die Praxis bedeutet dies, dass eventuell psychoedukative Interventionen (s. Kap. 5.2.) in den Familien oder weiteren sozialen Netzwerken angebracht sind.
Generell sollten die Angehörigen und eventuell weitere Personen einer traumatisierten Person proaktiv gefragt werden, ob sie Unterstützung wünschen. Im Mittelpunkt jeder Unterstützung steht der Aufbau einer tragfähigen beraterischen Beziehung. Jede Traumaberatung beginnt mit einer Stabilisierung und häufig zudem in einer Einschätzung möglicher Selbst- und Fremdgefährdungstendenzen. Weitere allgemeine Ziele sind die Abklärung der Affektregulation, ein Selbst- und Beziehungsmanagement und der Aufbau von intra- und interpersonellen Ressourcen, möglicherweise mit Methoden der imaginativen Selbstberuhigung (z.B. mit Hilfe eines Entspannungstrainings). Des Weiteren sollte überlegt werden, ob neben einer Stützung des sozialen Netzwerkes, Hilfen einer Symptomkontrolle (z. B. durch Distanzierungstechniken) oder Kunst- und Gestaltungs-, Ergo- sowie körpertherapeutische Verfahren hilfreich sind.
Frühzeitig sollte erörtert werden, ob eine Vermittlung in eine Traumatherapie passend ist, bzw. wann der richtige Zeitpunkt hierfür vorhanden ist. Leider bestehen oftmals für Traumatherapien erhebliche Wartezeiten, sodass auch zu überlegen ist ob bereits mit einer Traumaberatung begonnen werden sollte. Für eine Konfrontation mit dem Trauma in einer Therapie gilt: Während Wissenschaftler früher glaubten, dass eine Auseinandersetzung mit einem Trauma frühzeitig erfolgen sollte, gilt heute, dass Menschen selbst über den richtigen Zeitpunkt entscheiden sollen. Oftmals wird von den Betroffenen keine Konfrontation gewünscht.
Wenn die Eltern Probleme haben die Erziehungsaufgaben angemessen zu übernehmen, ist proaktiv u.a. zu überlegen:
- ob die Eltern die Bedürfnisse der Kinder wahrnehmen und sie angemessen unterstützen können,
- ob eigene Traumata bei den Eltern „angetriggert“ oder sich eigene Problematiken in ihrer Lebensgeschichte entwickelt haben (z.B. psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen). Eventuell kann es hier zu einer erneuten „Erkrankung“ kommen,
- ob bereits eine Bindungsproblematik bei den Eltern vorliegt.
- Wissen die Eltern um den Einfluss ihrer eigenen belastenden oder auch traumatischen Erfahrungen sind sie eher in der Lage ihre Verhaltensweisen zu reflektieren und entsprechend Verantwortung zu übernehmen,
- übernehmen die Kinder eine unangemessene Rolle39 im Familienleben (insbesondere, wenn sie unangemessene Verantwortung für Geschwister oder die Elternteile übernehmen), ist dies zu thematisieren. Kindern kann die Rolle des umworbenen oder umstrittenen Bundesgenossen zugewiesen werden oder es können auf ein Familienmitglied negative Impulse übertragen werden (z.B. als „Sündenbock“). Problematisch sind zudem zu beobachtende Substitute. Das Kind kann einerseits ein Substitut für einen anderen Partner (Gattensubstitut) sein oder das Kind übernimmt die Elternrolle für die Eltern bzw. für einen Elternteil (Elternsubstitut). Dies beinhaltet eine Generations-, bzw. Rollenumkehr.
Generell sind die psychosozialen Helfer*innen bei massiven Problemen gefordert zu überprüfen (oder bei Verdacht gegebenenfalls prüfen zu lassen), ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Zudem ist partizipativ zu erörtern, welche weiteren Hilfsangebote entwickelt werden könnten. Hilfen zur Erziehung müssen oftmals ganzheitlich und langfristig geplant werden. Dies benötigt eine flexible Kooperation verschiedenster Institutionen und beinhaltet Psychoedukation, spezifische Krisenintervention, Diagnostik, ebenso wie möglicherweise eine psychotherapeutische Traumatherapie.
Den Institutionen Kitas und Schule kommt als sicherem Ort eine besondere Bedeutung zu (Abt 2018). Schulen und Kitas stehen vor der Aufgabe pädagogische Antworten und Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen zu finden. Manchmal sind die Kinder und Jugendlichen auch kaum ansprechbar, sie „explodieren“ bei Kleinigkeiten und verhalten sich nicht mehr altersgemäß (z.B. erneutes Einnässen). Sicherheit gestaltet sich einerseits durch die äußere Sicherheit, durch räumliche Gegebenheiten die Rückzugsmöglichkeiten bieten und einen offenen Umgang mit dem Thema Gewalt. Sichere Beziehungen zu den Erzieher*innen, Lehrer*innen und Sozialpädagog*innen sind äußerst bedeutsam. Möglicherweise ist die erlittene Traumatisierung auch mit der ganzen Klasse zu thematisieren. Hieraus können sich auch Unterstützungsangebote durch Freund*innen oder die Mitschüler*innen ergeben (Abt 2018).
Erzieher*innen und Lehrer*innen benötigen oftmals Informationen über Traumata um mit den herausfordernden Verhaltensweisen angemessen umgehen zu können. Schulen und Kitas sind besonders gefordert, wenn es zu aggressiven Verhaltensweisen oder zu Vermeidungsverhalten (z. B. plötzliches Weglaufen) kommt.
Zu wenig beachtet werden häufig die Belastungen für die Geschwister. So neigen bspw. die nicht traumatisierten Geschwisterkinder dazu, eigene Belastungen zu verleugnen oder sie entwickeln Schuldgefühle, wenn sie daran denken, dass das „Schlimme“ dem Geschwisterkind zugestoßen ist. Größere Geschwisterkinder können für das kleinere Geschwisterkind „Beschützerinstinkte“ entwickeln, die zu einer übersteigerten Identifizierung mit dem kleinen Kind führen. Oftmals erhalten die Geschwisterkinder zu wenig Zuwendung durch die Eltern.
Bevor weitere Interventionen in der Beratung erörtert werden, soll das sogenannte Traumaviereck nach Hantke und Görges (2012) vorgestellt werden. Mit diesem Modell können zum einen familiäre Dynamiken und zum anderen zugleich die der Helfer* innen, bzw. in den Helfer*innensystemen beschrieben werden. Es bietet somit die Möglichkeit die wirkenden Ansteckungsprozesse und Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse der Helfer*innen zu reflektieren.
Zunächst soll nochmals betont werden: Traumatisierungen, die durch Menschen verursacht wurden, finden immer auch in einem Beziehungsgeflecht statt, welches u.a. durch Übertragungsphänomene Einfluss auf die Dynamiken im Hilfesystem nimmt. Helfer* innen übernehmen typischerweise (unbewusst) Rollen, die oftmals aus dem Herkunftssystem der traumatisierten Kinder oder Eltern stammen. Auch das eigene Involviert-Sein, mögliche eigene belastende Erfahrungen, fließen immer wieder ein.
___
39 Im unmittelbaren Interaktionsgeschehen äußern sich Rollen durch bestimmte Handlungen und Verhaltensweisen. Die für die Funktionstüchtigkeit des Systems Familie bedeutsamsten Rollentypen sind die Geschlechts- und Generationsrollen. Bei der Beurteilung der Rollen in Familien kann unterschieden werden, ob diese wechseln (langsam oder schnell) oder ob sie dauerhaft festgelegt sind. Informelle Rollen, die durch eine Rollenzuweisung zustande kommen (z.B. Schwarzes Schaf, Außenseiter*in u.a.) sind zu unterscheiden von formal bestimmten Familienrollen (Mutter, Vater, Großmutter u.a.). Je besser die Rollen innerhalb eines Systems aufeinander abgestimmt sind, desto eher werden Störungen des Zusammenlebens und der Sozialisation vermieden. Widerspricht die Rolleneinnahme den vorgegebenen Erwartungen oder sind die Rollen in sich widersprüchlich, kann es zu Konflikten und in deren Folge zu „Pathologien“ kommen. Zu problematischen Wirkungen kommt es besonders dann, wenn Rollendefinitionen angesichts fälliger Entwicklungen erstarren und es zu Triangulierungen und zu Parentifizierungen kommt. Der Begriff der Triangulierung meint zum einen lediglich eine Beschreibung der Beziehungen zwischen mindestens drei Personen und zum anderen die Erweiterung einer konflikthaften Zweierbeziehung um eine dritte Person, die den Konflikt verdecken oder entschärfen soll. Parentifizierung meint eine Umkehr der sozialen Rollen zwischen Elternteilen und ihrem Kind. Es kommt zu einer Diffusion der Generationsgrenzen im Familiensystem, oftmals übernimmt das Kind in überzogenem Maße „Eltern-Funktionen“.
***
Sie möchten gern weiterlesen?
Jetzt versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen

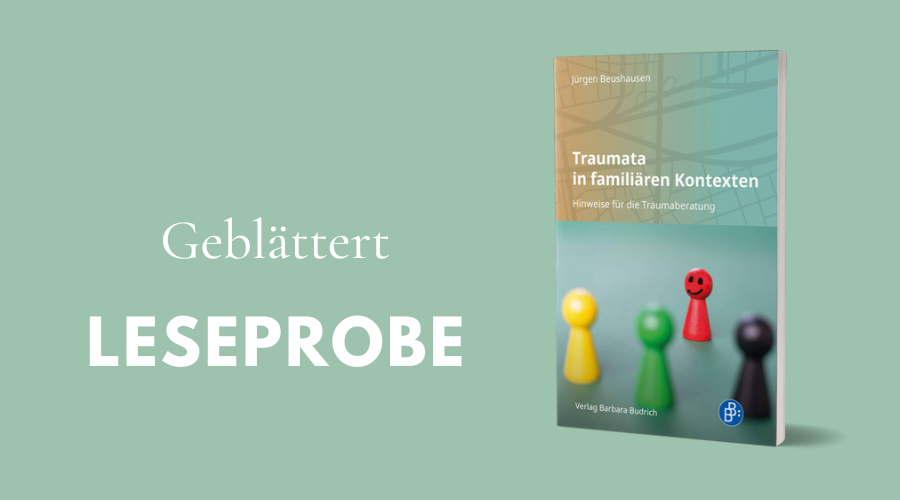
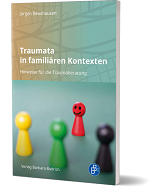 Jürgen Beushausen:
Jürgen Beushausen: