Schreiben in Sozialarbeits- und Gesundheitswissenschaften
Erfolgreich in interdisziplinären Studiengängen
von Petra Kolip und Bettina Schmidt
Über das Buch
Während es in anderen Fächern ausreicht, eine Disziplin zu durchdringen, müssen sich Studierende der Sozialarbeits- und Gesundheitswissenschaften in vielen Disziplinen zurechtfinden und zu einer multidisziplinären Gesamtperspektive gelangen. Petra Kolip und Bettina Schmidt erklären u.a. mithilfe solider Zeitmanagement-Tipps und Checklisten, wie dies schon ab der Themenfindung gelingt.
Leseprobe aus den Seiten 73 bis 79
***
5.2.2 Literatur im eigenen Text wiedergeben
Im vergangenen Unterkapitel haben wir uns mit der Leistung beschäftigt, die Sie erbringen müssen, wenn Sie aus einer Vielzahl von Fremdtexten einen eigenen Text erstellen wollen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Sachverhalte, die Sie Fremdtexten entnehmen, korrekt darstellen. Hierbei geht es vor allem um die formal korrekte Darstellung, denn die inhaltlich korrekte Darstellung – also die präzise inhaltliche Wiedergabe dessen, was im Fremdtext geschrieben steht – sollte selbstverständlich sein. Die einwandfreie Darstellung von Fremdtext-Inhalten im eigenen Text ist unabdingbar, einerseits um zu belegen, dass Sie sich die dargestellten Sachverhalte nicht ausgedacht haben, andererseits um Ihre wissenschaftliche Redlichkeit zu beglaubigen durch ordnungsgemäße Wiedergabe aller Sachverhalte und ihrer Quellen.
Zwei verschiedene Möglichkeiten existieren, um Sachverhalte aus Fremdtexten ordnungsgemäß wiederzugeben: das wörtliche Zitieren, also die exakte Wiedergabe von Sätzen oder Satzteilen aus Fremdtexten, und das Paraphrasieren, also die Wiedergabe von Sachverhalten aus Fremdtexten in eigenen Worten.
Die Verwendung von Literatur durch wörtliche Zitate
Das wörtliche Zitieren ist leicht erklärt: Schreiben Sie buchstabengetreu ab, was im Ursprungstext steht, und setzen das Zitat in Anführungsstriche. Nennen Sie im Kurzverweis den Autor*innennamen, das Publikationsjahr und außerdem die Seitenangabe des direkten Zitats. Falls Sie in Ihrem direkten Zitat nicht jedes Wort zitieren, sondern Satzteile auslassen, dann kennzeichnen Sie die Auslassung mit eckigen Klammern und drei Punkten: […]. Folgendes Beispiel illustriert ein wörtliches Zitat: „Das wörtliche Zitieren ist leicht erklärt“ (Kolip & Schmidt 2023, S. 73).
Ein wörtliches Zitat ist nicht nur schnell erklärt, sondern auch schnell geschrieben. Das verführt dazu, wörtliche Zitate aneinander zu reihen. Doch nur weil das wörtliche Zitieren leicht ist, ist es nicht auch gut. Sie irren sich, wenn Sie der Ansicht sind, dass vor allem wörtliche Zitate Ihre Fähigkeit bezeugen, wissenschaftlich zu schreiben. Das Gegenteil ist der Fall. Ihre Fähigkeit zum wissenschaftlichen Schreiben bezeugen Sie dadurch, dass es Ihnen gelingt, aus der Vielzahl der von Ihnen gelesenen Fachtexte einen eigenständigen Text zu erstellen, der nicht nur durch seine fachliche Qualität überzeugt, sondern auch dadurch, dass ein gut lesbarer Fließtext entstanden ist, in dem alle dargestellten Inhalte gewandt ausgedrückt sind.
Wörtliche Zitate sollten Sie sparsam und nur im Ausnahmefall verwenden, also z. B. dann, wenn ein Satz von besonderer sprachlicher Schönheit und darum zitierwürdig ist, oder wenn eine Definition verwendet wird, die im Wortlaut wiedergegeben werden soll. Wenn ein Satz oder Absatz lediglich gut geschrieben ist und Sie nicht wissen, wie Sie es anders ausdrücken können, ist das kein Grund für ein wörtliches Zitat, sondern ein Grund für mehr Gedankenarbeit und Kreativität beim Formulieren der eigenen Sätze.
Die Verwendung von Literatur in eigenen Worten, also durch Paraphrasieren
Wie bereits gesagt, kann man professionelle Texte mit einer gemauerten Pyramide vergleichen, in der Sachverhalte wie Bausteine neben- und aufeinander geschichtet werden, um auf diese Weise eine bestimmte Fragestellung in belastbarer Weise zu beantworten (siehe Abbildung 6). Und ähnlich wie verschiedene Pyramiden aus verschiedenen Materialien (Beton, Sandstein, Holz etc.) gebaut sein können, sind verschiedene Fachtexte in verschiedenen Textstilen verfasst: Manche Texte sind sehr knapp formuliert, andere etwas ausführlicher im Sprachstil; in manchen Texten werden viele, in anderen wiederum wenige Fremdwörter benutzt etc. Natürlich sollten alle Fachtexte nüchtern und prägnant geschrieben sein, dennoch unterscheiden sich Autor*innen in ihrem Schreibstil (zum wissenschaftlichen Sprachstil siehe Kapitel 5.1). Das gilt umso mehr in multidisziplinären Studiengängen, in denen sich Formulierungsgewohnheiten zum Teil deutlich voneinander unterscheiden – in der Rechtswissenschaft herrscht ein anderer Stil als in der Psychologie, in den Politikwissenschaften ist ein anderer Stil üblich als in der Ethik.
Wenn Sie aus einem Sammelsurium von unterschiedlich formulierten Fremdtexten einen eigenständigen, flüssig lesbaren Text erstellen wollen, dann gelingt das nur, wenn Sie nicht in den Formulierungen der Fremdtexte verhaftet bleiben, sondern die relevanten Sachverhalte in eigenen Worten wiedergeben und auf diese Weise die unterschiedlichen Fremdtext-Stile zu einem möglichst einheitlichen Stil zusammenfügen. Die eigenen Formulierungen befreien Sie allerdings nicht davon, auch diese mit den zugehörigen Kurzverweisen zu versehen, um über die zugrunde liegenden Fremdtext-Quellen zu informieren (siehe Kapitel 5.2.3).
Wenn Sie lernen, in eigenen Worten zu schreiben und einen eigenen Stil zu entwickeln, dann schützt Sie das vor der Gefahr, unwillentlich ein Plagiat zu begehen. Die Aneignung fremden geistigen Eigentums ist kein Kavaliersdelikt, sondern kann im schlimmsten Fall zur Exmatrikulation oder Aberkennung des akademischen Grades führen.
Beim wörtlichen Zitieren ist das Risiko für unwillentliches Plagiieren klein, denn dort gibt es einfach zu befolgende Regeln, um sich keinem Plagiatsvorwurf auszusetzen: Setzen Sie jedes wörtliche Zitat in Anführungsstriche und kennzeichnen Sie es mit dem zugehörigen Kurzverweis. Bei Wiedergabe in eigenen Worten ist das Risiko unwillentlichen Plagiierens größer, denn es gibt keine präzisen Kriterien, die die wörtliche von der nichtwörtlichen Wiedergabe unterscheiden. Dass es keine präzisen Kriterien gibt, bedeutet allerdings nicht, dass es gestattet ist, Originaltexte nur rudimentär zu verändern, um sie dann als eigene Formulierungen auszugeben – etwa, indem Sie in einem längeren Zitat lediglich drei Worte durch Synonyme ersetzen und diesen reformulierten Satz dann als Paraphrase ausgeben. Wenn Sie fremde Textbausteine also nur ganz unwesentlich umformulierten, dann laufen Sie Gefahr, dass an dieser Stelle ein Plagiatsvorbehalt angemeldet wird.
Gewöhnen Sie sich also gleich zu Beginn des Studiums an, sich von den Formulierungen der Fremdtexte zu befreien, und finden Sie Ihren eigenen Stil. Schreiben Sie Ihre Notizen und die Abschnitte Ihrer Hausarbeiten in Ihren eigenen Worten, und würzen Sie Ihren Text in Ausnahmefällen mit lesenswerten wörtlichen Zitaten. Das Schreiben in eigenen Worten wird Ihnen anfangs vermutlich schwerfallen, doch je mehr Sie das üben, desto routinierter werden Sie. Denken Sie daran, dass Sie nicht nur einen fachlich überzeugenden Text erstellen sollen, sondern auch einen Text, der sprachlich prägnant und flüssig zu lesen ist. Gerade in den Sozialarbeits- und Gesundheitswissenschaften, in denen die Berufstätigkeit häufig von Adressat*innen-Kontakten geprägt ist, gehört eine klare und verständliche Sprache zu den unverzichtbaren Schlüsselkompetenzen – und das klare Schreiben schult das klare Sprechen.
5.2.3 Literatur im Text sachgemäß zitieren und Literaturverzeichnis erstellen
Das Fundament jeder Haus- oder Abschlussarbeit basiert auf den Publikationen, die Sie für Ihre Schrift verwendet haben. Wir benutzen hier absichtlich den Begriff „verwendet“ und nicht „gelesen“, denn sicherlich werden Sie für Ihre Hausarbeit mehr Publikationen lesen als Sie tatsächlich verwenden, um Ihren Text zu schreiben. Doch nur die Publikationen, die Sie für das Schreiben Ihres Textes verwenden, gehören zu Ihrem Literaturfundament. Denn nur diese Publikationen haben Sie nachweislich verwendet und zitiert, und entsprechend können nur diese Publikationen von Ihren Leser*innen nachvollzogen werden.
Die von Ihnen verwendeten Publikationen müssen einerseits in Ihrem Text selbst durch Kurzverweis nachgewiesen werden und andererseits müssen Sie im Literaturverzeichnis mit vollständigen Angaben aufgeführt werden. In den folgenden beiden Unterkapiteln werden beide Schritte dargestellt.
Literatur sachgemäß im Text zitieren
Jeder wissenschaftliche Text, z. B. der Text Ihrer Hausarbeit oder Abschlussarbeit, basiert auf der zusammengestellten Faktenlage der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dem Thema, über das Sie Ihre Arbeit schreiben. Eine Hausarbeit hat also nicht das Ziel, Ihre Meinung darzulegen (diese gehört ggf. ins Fazit Ihrer Arbeit) oder persönliche Erfahrungen zu schildern, sondern die verfügbaren Fakten zum Thema zusammenzutragen und zu verschriftlichen. Dazu gehört zwingend, dass Sie alle Fakten, die Sie in Ihrer Arbeit darstellen, durch wissenschaftlich belastbare Quellen beglaubigen. In einer Arbeit, in der Sie sich z. B. mit dem Gesundheitszustand von Frauen und Männern befassen, können Sie also nicht einfach schreiben, dass Frauen älter werden als Männer, sondern Sie müssen diesen Sachverhalt mit einer aktuellen wissenschaftlichen Quelle belegen. Wie bereits in Kapitel 4.2 dargelegt, kann das etwa folgendermaßen aussehen: „Die Lebenserwartung von Frauen liegt mit 83,3 Jahren knapp fünf Jahre über jener der Männer mit 78,5 Jahren (Statistisches Bundesamt, 2019, S. 39).“
Um Quellenangaben im Text anzugeben, gibt es je nach Fach unterschiedliche Versionen: In einer Version geben Sie sie in Form eines Kurzverweises als Fußnote an. In einer zweiten Version geben Sie die Quellenangabe in Form eines Kurzverweises direkt im Text an, und zwar am Ende des dargestellten Sachverhalts (sogenannte Autor-Jahr-Zitierweise, auch Harvard-Zitation genannt). In einer weiteren Version wird der Kurznachweis mit Zahlen eingefügt (hochgestellt oder in eckigen Klammern, so genannte Vancouver-Zitation). Informieren Sie sich darüber, welche Zitierweise in Ihrem Studienfach üblich ist – das kann in multidisziplinären Studiengängen unter Umständen auch variieren je nach Disziplin, in der Sie gerade Ihre Arbeit verfassen.
Sowohl für die Zitierweise mit Fußnoten als auch mit Textverweisen gilt in der Regel, dass lediglich ein Kurzverweis über die zugrunde liegende Quelle – also z. B. den Zeitschriftenartikel, das Buch oder ein Kapitel in einem Herausgeberband – informiert, der vollständige Quellenhinweis erfolgt erst im Literaturverzeichnis. Ausreichend für den Kurzverweis sind die folgenden Informationen: Der Nachname der Autor*innen, das Publikationsjahr, je nach Fach auch die Seitenzahl. Am Lebenserwartungsbeispiel werden die beiden unterschiedlichen Vorgehensweisen illustriert:
- Kurzverweis per Fußnote: Die Lebenserwartung von Frauen und Männern beträgt aktuell 83,3 und 78,5 Jahre1.
- Kurzverweis im Text: Die Lebenserwartung von Frauen und Männern beträgt aktuell 83,3 und 78,5 Jahre (Statistisches Bundesamt, 2019). Da die Quellenangabe noch mit zu dem dargestellten Sachverhalt gehört, erfolgt der satzabschließende Punkt erst hinter dem Fußnoten- bzw. Text-Kurzverweis.
In manchen Fächern wird danach unterschieden, ob sich der Kurzverweis auf eine wörtliche oder paraphrasierte Wiedergabe eines Quellentextes bezieht. In manchen Disziplinen ist es üblich, die Seitenzahl im Kurzverweis nur anzugeben, wenn Sie einen Sachverhalt wörtlich zitieren; die Seitenzahl wird also nicht angegeben, wenn Sie den Sachverhalt in eigenen Worten darstellen. In Zeiten von Fake- News und Plagiaten empfiehlt es sich, sowohl bei wörtlichen als auch bei paraphrasierten Text-Wiedergaben die Seitenzahl mit zu notieren, um eine exakte Nachprüfbarkeit des dargestellten Sachverhalts zu erleichtern.
Falls Sie einen Sachverhalt darstellen, der sich in der Originalquelle nicht auf eine, sondern zwei Seiten bezieht (das kommt natürlich häufiger bei paraphrasierten Sachverhalten vor), dann sieht die Quellenangabe folgendermaßen aus: „Die Lebenserwartung von Frauen und Männern beträgt aktuell 83,3 und 78,5 Jahre, und gestorben sind im Jahr 2017 457.756 Männer und 474.507 Frauen (Statistisches Bundesamt, 2019, S. 39f.).“ Das „f.“ steht für „folgende“ und bedeutet, dass hier die Seiten 39 und 40 zitiert wurden. Wenn sich der dargestellte Sachverhalt außerdem noch mindestens auf die Seite 41 bezieht, dann lautet die korrekte Zitierweise „S. 39ff.“. Die Dopplung „ff.“ schließt alle weiteren nachfolgenden Seiten ein – es ist also nicht üblich „S. 39fff.“ zu schreiben, wenn Sie drei weitere Seiten zitieren, auch hier genügt „S. 39ff.“.
Achten Sie darauf, dass in unterschiedlichen Fachdisziplinen unterschiedliche Regularien darüber bestehen, wie der Kurzverweis zu gestalten ist – ob z. B. zwischen dem Nachnamen des*der Autor*in und dem Publikationsjahr ein Komma gesetzt wird oder nicht. Halten Sie sich stets an die Vorgaben, die für Ihren Studiengang bzw. die jeweilige Fachdisziplin gelten.
Üblich ist für die meisten Fachdisziplinen, dass Publikationen, die von einem*einer, zwei oder drei Autor*innen verfasst wurden, im Kurzverweis alle Autor*innen genannt werden, also z. B. „Kolip & Schmidt, 2023“. Bei mehr als drei Autor*innen wird im Kurzverweis oft lediglich der*die erste Autor*in genannt, die übrigen Autor*innen werden mit „et al.“ (für: et alii, lat. „und andere“) abgekürzt – das funktioniert dann folgendermaßen: „Die Lebenserwartungsunterschiede zwischen Männern mit geringem und hohem Einkommen sind fast doppelt so groß (8,4 Jahre) wie zwischen Frauen mit geringen und hohem Einkommen, hier beträgt der Unterschied 4,4 Jahre“ (Lampert et al., 2021, S. 335). Im Literaturverzeichnis müssen dann alle Autor*innen (bzw. je nach Fach: nur die ersten sechs Autor*innen) genannt werden. In manchen Fächern werden bei der ersten Erwähnung im Text bis zu sechs Autor*innen genannt, erst ab der zweiten Nennung wird mit „et al.“ abgekürzt. Erkundigen Sie sich in Ihrem Fach, welche Regeln für Ihre Arbeit gelten.
___
1 Statistisches Bundesamt, 2019
***
Sie möchten gern weiterlesen?
Jetzt versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
© Titelbild: gestaltet mit canva.com


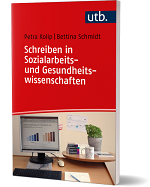 Petra Kolip, Bettina Schmidt:
Petra Kolip, Bettina Schmidt: