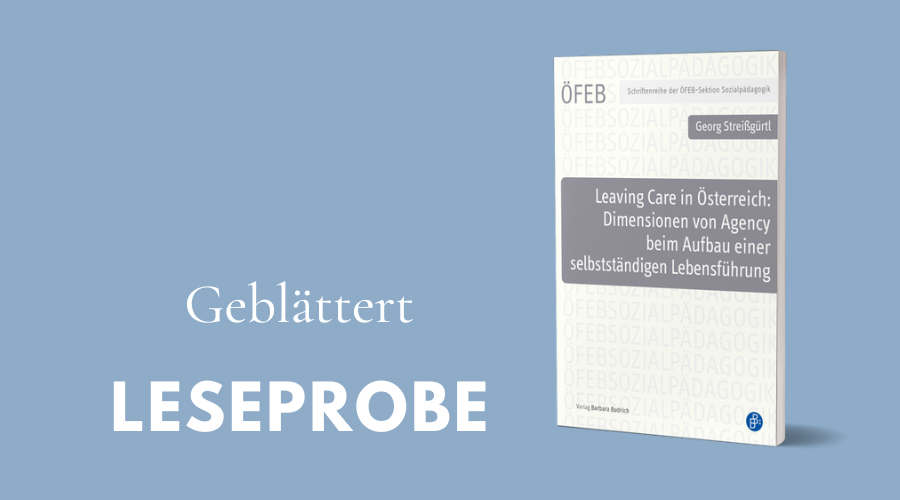Eine Leseprobe aus den Seiten 9 bis 12 aus Leaving Care in Österreich: Dimensionen von Agency beim Aufbau einer selbstständigen Lebensführung von Georg Streißgürtl, Kapitel „1 Einleitung“.
Über „Leaving Care in Österreich“
Der Prozess des Übergangs aus der Jugendhilfe ist für junge Menschen mit vielen Herausforderungen verbunden. In diesem Zusammenhang wird immer wieder ein Begriff bemüht, der wie selbsterklärend erscheint: nämlich Selbstständigkeit. Doch was ist damit gemeint? Und wie wirken hierbei einseitig orientierte Vorstellungen von Normalität? Möglichen Antworten nähert sich der Autor entlang eines qualitativ-empirischen Vorgehens.
***
1 Einleitung
Seit einigen Jahren werden international wie auch in Österreich zunehmend Projekte realisiert, die den gesellschaftlichen Auftrag zur Verbesserung der Situation der sog. Care Leavers in den Fokus rücken. Diese sollen etwa, wie das Öffentliche Gesundheitsportal Österreich des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf dessen Homepage angibt, „den Weg in die Selbstständigkeit erleichtern [Herv.] und einen Beitrag für mehr Chancengerechtigkeit leisten“ (Öffentliches Gesundheitsportal Österreich 2021: o.S.).
Die anwachsende Bereitschaft Hilfestellungen für Care Leavers zu leisten ist selbstredend zu begrüßen, doch was auf den ersten Blick wie selbsterklärend erscheint, erweist sich bei genauerer Betrachtung als höchst voraussetzungsvoll. Denn: Was ist mit dem Weg in die Selbstständigkeit eigentlich gemeint? Und: Welche Schwerpunkte können in diesem Prozess – um den Weg zu erleichtern – aus professioneller Sicht sinnvoll gesetzt werden? Diesen Fragen soll in dieser Arbeit nachgegangen und mögliche Antworten schrittweise erarbeitet werden.
Dazu erfolgt zunächst eine Heranführung an das Themenfeld: An eine Diskussion des Begriffs Leaving Care schließt die Skizzierung der rechtlich-institutionellen Rahmung an, vor deren Hintergrund diese Übergangsprozesse stattfinden. Danach wird auf die Forschungslage zur Thematik eingegangen, um darauf aufbauend das Konstrukt Agency als theoretische Rahmung einzuführen und die Fragestellungen dieser Arbeit zu entwickeln. Diese Einleitung abschließend wird schließlich eine Übersicht über die Kapitel gegeben.
Leaving Care. Der Ausdruck Care Leavers hat sich im internationalen Diskurs als Bezeichnung für junge Menschen durchgesetzt, „die Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe verlassen und somit am Übergang zur Selbständigkeit bzw. zum Erwachsenenleben stehen“ (Köngeter et al. 2012: 262). Der Begriff meint jedoch, gemäß einer erweiterten Auffassung, schlicht auch: „Any adult who spent time in care as a child“ (The Care Leavers Association 2021: o.S.). Erstere Sichtweise zielt auf den Prozess des Übergangs am Ende der Hilfemaßnahme, letztere auf biografische Erfahrungen, die mehr oder weniger lang zurückliegen können.
Der Titel dieser Arbeit verweist mit der Wortwahl Leaving Care auf eine prozesshafte Perspektive, wobei beide genannten Sichtweisen miteingeschlossen werden: Unter Care Leavers werden im weiteren junge Menschen mit Erfahrungen in unterschiedlichen Settings der Vollen Erziehung verstanden, die sich auf dem Weg zur eigenverantwortlichen Lebensführung befinden und sich dabei entweder im Prozess des Übergangs aus der Maßnahme befinden oder auf diesen zeitlich zurückblicken können.
Einige Aspekte dieser Definition sind erklärungsbedürftig und sollen in Folge differenzierter betrachtet werden:
Mit jedweder Definition von Gruppen können auch Stigmatisierungsprozesse einhergehen, doch hat die Verwendung des Begriffs, wie Sievers und Kolleg:innen (2018: 7f.) feststellen, „einen Vorteil, denn sie kann dazu beitragen, die besonderen Herausforderungen (…) besser sichtbar zu machen“. Der gesellschaftliche Diskurs um die Gruppe der Care Leavers hat jedenfalls dazu beigetragen, dass „die Bedürfnisse der jungen Menschen in dieser Lebens-phase genauer in den Blick genommen wurden“. Der Vorteil einer Benennung der Gruppe kann demnach mögliche Stigmatisierungsprozesse überwiegen, wobei letztere m.E. eher mit kategorialen Zuschreibungen innerhalb der Gruppe einhergehen (vgl. Kap. 3.2).
Auch könnte der Ausdruck euphemistisch aufgefasst werden, in der Art, als sei das Verlassen („leaving“) der Maßnahmen der Vollen Erziehung tendenziell selbstbestimmt und von einer positiven Grundstimmung getragen. Diese Übergänge können jedoch in der Praxis auf sehr unterschiedliche Weise erfolgen: Sie können von den jungen Menschen tatsächlich selbst initiiert sein und gemäß des Hilfeplans und im Einverständnis aller Beteiligten stattfinden, sie können jedoch in gleicher Weise von diesen als höchst fremdbestimmt wahrgenommen werden oder vorzeitig erfolgen, zum Beispiel im Sinne eines Abbruchs der Maßnahme.
Bei den genannten Maßnahmen ist zudem anzumerken, dass das österreichische Kinder- und Jugendhilfegesetz1 diese im Rahmen der Vollen Erziehung vorsieht, wenn – wie in der steirischen Fassung festgehalten – das Kin-deswohl gefährdet ist und „die Gefährdung nur durch Betreuung außerhalb der Familie oder des sonstigen bisherigen Wohnumfeldes abgewendet werden kann“ (§ 28 Abs. 1 St-KJHG). Dies kann prinzipiell in sozialpädagogischen Einrichtungen oder bei Pflegepersonen erfolgen.
Sozialpädagogische Einrichtungen können sein: 1) Einrichtungen zur stationären Krisenintervention, 2) Einrichtungen zur Pflege und Erziehung von Kindern und Jugendlichen, 3) Einrichtungen zur diagnostischen Abklärung, 4) Einrichtungen für das mobil betreute Wohnen für Jugendliche und 5) nicht ortsfeste Formen der Sozialpädagogik (vgl. §32 Abs. 2 St-KJHG). Aufgrund einer notwendigen Einschränkung liegt der empirische Bezug dieser Arbeit im weiteren Verlauf auf Care Leavers, die in sozialpädagogischen Einrichtungen gemäß der Punkte 2) und 4) gelebt haben.
Mit dem Ausdruck Übergänge kann die Vermutung einhergehen, es handle sich hierbei um einmalige, in sich abgeschlossene Ereignisse, doch sollen diese, wie etwa mit Welzers (1992) Terminus Transitionen, als nicht-lineare Ereignisse vor dem Hintergrund einer engen Verwobenheit von Subjekt und Struktur verstanden werden, als „sozial prozessierte, verdichtete und akzelerierte Phasen in einem in permanentem Wandel befindlichen Lebensverlauf“ (Welzer 1993: 37). Anders: Individuelle Dispositionen und strukturale Bedingungen werden nicht als statisch erachtet, sondern als in Bewegung verstanden. Mit aus diesem Grund können sich Übergänge in unterschiedlichen Be-reichen zeitlich überlagern, haben keine festgelegten Anfangs- und Endpunkte und sind nur aus den Relationen des sozialen Gefüges heraus verstehbar, die sich mit den Transitionen eben auch verändern. Walther und Stauber (2013b) ergänzen dieses Bild von Übergängen entlang der Feststellung, dass diese
prinzipiell Zonen der Ungewissheit und Verwundbarkeit [Herv.] darstellen – sowohl für die gesellschaftliche Ordnung, weil nicht sicher ist, ob die nachfolgende Generation die an-gestrebten Zielzustände erreicht und die herrschenden Normalitätsannahmen übernimmt, als auch für die Individuen, deren Lebensentwurf – im Sinne einer an die bisherige Biografie anschlussfähigen Identitätsbalance in der Zukunft – auf dem Spiel steht. (Walther und Stauber 2013b: 29f.)
Karl und Kolleg:innen (2020) konstatieren für den Prozess des Leaving Care eine Verdichtung dieser ohnehin komplexen Anforderungen an die jungen Menschen: „Leaving Care ist so gesehen eine komplexe biografisch zu bewältigende Übergangskonstellation“ (Karl et al. 2018: 9). Doch was macht diesen Prozess zur besonderen Herausforderung?
Bevor an die Beantwortung dieser Frage herangegangen werden kann, ist es notwendig, die rechtlich-institutionellen Rahmenbedingungen zu skizzieren.
Rechtlich–institutionelle Rahmung. In Österreich sieht der gesetzliche Rahmen ein Ende der Maßnahmen der Vollen Erziehung grundsätzlich mit der Vollendung des 18. Lebensjahres vor. Diese können jedoch zeitlich bis längstens zur Absolvierung des 21. Lebensjahres ausgedehnt werden, wenn – wie etwa in der steirischen Fassung zu lesen ist – „zum Zeitpunkt der Vollendung des 18. Lebensjahres bereits Erziehungshilfen gewährt werden und dies zur Erreichung der im Hilfeplan definierten Ziele dringend notwendig ist“ (§ 31 Abs. 1 St-KJHG). Dabei zeigen sich in der Praxis der Gewährung dieser Bestimmung regionale Disparitäten, da keine fachlichen Standards vorgegeben sind und die Finanzierung der Maßnahme in Folge oftmals an Bildungs- bzw. Ausbildungserfolge geknüpft wird. Im Jahr 2021 wurden jedenfalls 12.871 Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) im Rahmen der Vollen Erziehung betreut. In den sozialpädagogischen Einrichtungen haben die Unterbringungen gegenüber dem Vorjahr zugenommen (+3,9 %), die Anzahl der betreuten Kin-der und Jugendlichen in Pflegefamilien (-0,6 %) ist zurückgegangen (vgl. Bundeskanzleramt 2022: 19).
1.350 junge Menschen wurden 2021 über das 18. Lebensjahr hinaus in ambulanten Hilfen und 2.121 im stationären Bereich weiter von der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt. Damit hat die Anzahl der jungen Erwachsenen in Betreuung im Vergleich zum ersten Berichtsjahr 2015 bei ambulanten Hilfen um 47,9 % und im stationären Bereich um 22,5 % zugenommen, wobei hier regionale Unterschiede festzustellen sind (vgl. ebd.: 29).
Doch obschon die Hilfen für junge Erwachsene zunehmend in Anspruch genommen werden, enden diese dennoch spätestens mit dem 21. Geburtstag. Das europäische Durchschnittsalter junger Menschen, die ihr Elternhaus verlassen, lag 2018 jedoch bei etwa 26 Jahren; Österreich lag mit 25,6 Jahren knapp darunter (vgl. Eurostat 2019: o.S.). Care Leavers müssen die staatliche Obsorge demnach weit früher verlassen, als gleichaltrige Peers im Durch-schnitt von zuhause ausziehen. In diesem Zusammenhang muss auch ergänzt werden, dass der gesetzliche Rahmen einen Wiedereintritt in die Maßnahme nach Beendigung derselben bislang nicht vorsieht.
Vor diesem gesetzlichen Hintergrund und v.a. aufgrund einer fehlenden Rückkehroption haben die Träger der Kinder- und Jugendhilfe verschiedene Formen der Übergangsbegleitung etabliert, die im Projekt „Was kommt nach der stationären Erziehungshilfe?“ systematisch für den Raum Deutschland zusammengetragen wurden und in sehr ähnlicher Weise auch auf Österreich übertragbar sind. Die Ergebnisse des Projekts mündeten schließlich in das Arbeitsbuch „Jugendhilfe – und dann? Zur Gestaltung der Übergänge junger Erwachsener aus stationären Erziehungshilfen“ (Sievers et al. 2018), entlang dessen nachstehend die Formen der Übergangsbegleitung geschildert werden.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich die Einrichtungen um „eine pass-genaue Ausgestaltung der Angebote zur Begleitung des Übergangs in den ei-genen Wohnraum [bemühen]“ (ebd.: 92) und eine Vielzahl an Wohnformen kreiert haben. Das Ziel hierbei stellt immer die Einübung von Kompetenzen, die für ein selbstständiges Leben als wichtig erachtet werden, bei gleichzeitiger Reduzierung des Betreuungsumfangs dar. So versuchen einige Wohngruppen schon früh innerhalb der Einrichtung, die selbstredend eine hohe Betreuungs-dichte aufweist, „ein realistischeres Bild und Gefühl in Hinblick auf das Alleinsein zu vermitteln“ (ebd.: 94).
Die Wohnformen – mit unterschiedlichen Namen wie Innenbetreutes Wohnen oder Verselbstständigungs-Wohngruppe betitelt – sollen Schnittstelle sein zwischen dem vollstationären Setting und der ersten eigenen Wohnung. Diese werden meist auf dem Gelände der Einrichtung als mehr oder weniger große Wohngemeinschaften organisiert, mit der Idee der zunehmenden Übernahme von Verantwortung für den eigenen Wohnraum, wobei bei Bedarf die Unter-stützung aus der Wohngruppe jederzeit in Anspruch genommen werden kann. Auf diese Weise sind die jungen Menschen zunehmend angehalten, mit ihrem Geld selbstständig auszukommen, selbst einzukaufen, zu kochen oder den Wohnraum in Ordnung zu halten.
___
1 Seit 2020 kommt sowohl die Gesetzgebungskompetenz als auch die Ausführungsgesetzgebung allein den Bundesländern zu. Die vormalige Grundsatzkompetenz des Bundes weicht somit einer Vereinbarung, wonach sich die Länder verpflichten, Leistungen und Mindest-standards auch weiterhin wie im Bundesgesetz festgehalten, umzusetzen. Massive Kritik an dieser Verländerung der Kinder- und Jugendhilfe kommt etwa vom Dachverband der Öster-reichischen Jugendhilfeeinrichtungen (2019: 1). Befürchtet wird etwa, dass neue österreich-weite Standards nicht bundesweit umgesetzt werden (vgl. ebd.).
***
Sie möchten gern weiterlesen?
Jetzt „Leaving Care in Österreich“ versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
 Georg Streißgürtl:
Georg Streißgürtl:
Leaving Care in Österreich: Dimensionen von Agency beim Aufbau einer selbstständigen Lebensführung
Schriftenreihe der ÖFEB-Sektion Sozialpädagogik, Band 11
Mehr Leseproben …
… finden Sie auf unserem Blog.
© Titelbild: gestaltet mit canva.com