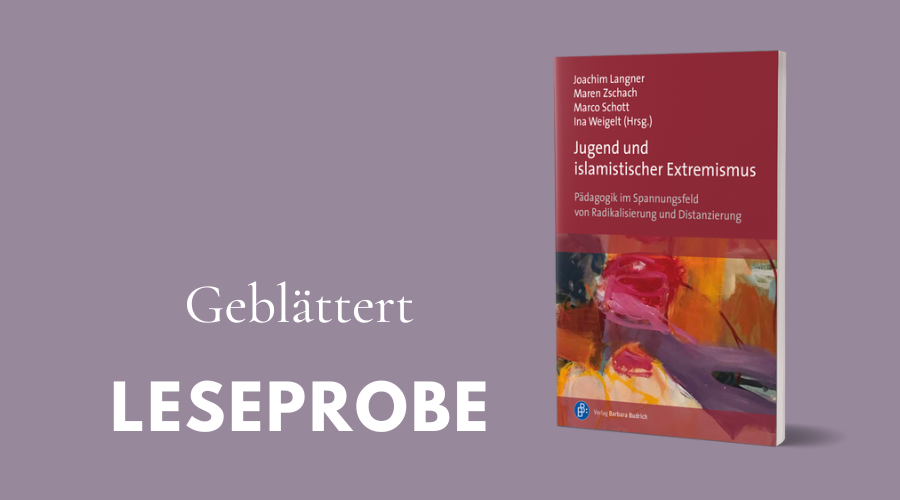Eine Leseprobe aus den Seiten 9 bis 12 aus Jugend und islamistischer Extremismus. Pädagogik im Spannungsfeld von Radikalisierung und Distanzierung von Joachim Langner, Maren Zschach, Marco Schott und Ina Weigelt (Hrsg.), Kapitel „Zum Verhältnis von Jugendlichen zu islamistischem Extremismus und dessen pädagogischer Bearbeitung“.
Über „Jugend und islamistischer Extremismus“
Warum wenden Jugendliche sich dem islamistischen Extremismus zu, wie radikalisieren sie sich – und wie können Pädagog:innen einschreiten? Der Band bietet aktuelle empirische Forschungseinblicke zu Hinwendungs- und Distanzierungsprozessen junger Menschen und kombiniert diese mit pädagogischen Ansätzen des Umgangs mit islamistischem Extremismus in der Fachpraxis. Dabei werden Zugänge von der Erziehungswissenschaft über die Soziologie, Kriminologie, Politikwissenschaft bis zur Religions- und Islamwissenschaft präsentiert.
***
Zum Verhältnis von Jugendlichen zu islamistischem Extremismus und dessen pädagogischer Bearbeitung
Joachim Langner, Maren Zschach, Ina Weigelt und Marco Schott
1 Islamistischer Extremismus als jugendbezogener Forschungsgegenstand: Begriff und Herausforderungen
Dieser Band1 versammelt aktuelle empirische Forschungsarbeiten, die islamistischen Extremismus aus einer auf Jugend oder Pädagogik bezogenen Perspektive beleuchten. Islamistischer Extremismus hat unsere Gesellschaft in den zurückliegenden Jahrzehnten immer wieder vor Herausforderungen gestellt, die zunehmend auch als jugendbezogene und pädagogische Herausforderungen diskutiert wurden. Beispiele sind junge gewaltorientierte Anhänger: innen salafistischer Netzwerke (Hummel/Logvinov 2014), ausreisende junge Kämpfer:innen (HKE 2014; Steinberg 2014) und deren Rückkehr (Dittmar 2022; Baron/Caskie 2022; Ülger/Celik 2016) sowie Debatten etwa über eine provokante Unterstützung von Anschlägen durch Schüler:innen (Nordbruch 2022; Edler 2018). In der Folge entwickelte sich vor allem in den 2010er Jahren ein breites Feld pädagogischer Angebote und Handlungspraxen (Schau/Figlestahler 2022). An sozial- und geisteswissenschaftliche Forschung richten sich in diesem Zusammenhang Fragen danach, warum (einige) junge Menschen sich islamistisch extremistischen Akteuren und Ideologien zuwenden, wie man sie dagegen stärken kann, oder welche pädagogischen, behördlichen und politischen Maßnahmen Radikalisierungsprozessen begegnen können. Die vorhandenen Wissensbestände waren jedoch erst einmal sehr begrenzt. Die Gründe dafür liegen bspw. in herausfordernden Forschungszugängen gerade zu extremistischen oder gar terroristischen Akteuren, aber auch in der dynamischen Veränderung der Herausforderungen, bspw. indem im Zusammenhang mit dem Krieg in Syrien die Zahl junger Menschen, die mit islamistisch-extremistischen Einstellungen in die Kampfgebiete ausreiste, rasant zunahm.
Die genannten Beispiele verbinden einerseits Problemdimensionen wie die Befürwortung von Gewalt, die Zurückweisung von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, sowie andererseits die Anbindung an einen auf den Islam verweisenden ideologischen Rahmen, den die Akteure selbst herstellen oder der ihnen zugeschrieben wird. Zugleich kommen die genannten Beispiele aus unterschiedlichen Kontexten und Zusammenhängen und reichen von jugendlicher Provokation bis zu schwerkriminellen Organisationen. Dieses breite Spektrum wird in diesem Band unter dem Begriff „islamistischer Extremismus“ zusammengefasst. Dieser soll einerseits offen genug sein, um an unterschiedliche Fachdiskurse mit Bezug auf islamistische (und salafistische) Diskurstraditionen anschlussfähig zu sein. Über den Extremismusbegriff soll der Begriff zugleich eine klare Eingrenzung auf „problematische“ Dimensionen vornehmen.
Die Offenheit der Definition ist relevant, da „Islamismus“ einen relativ diffusen Forschungsgegenstand darstellt (Martin/Barzegar 2009): Zum einen befassen sich damit sehr unterschiedliche Fach- und Theorietraditionen von der philologisch ausgerichteten Islamwissenschaft über die Religions- und Politikwissenschaft bis zur Soziologie und den Erziehungswissenschaften. Sie nähern sich dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven dem Phänomen, die sowohl empirisch-diskursiv und historisch-ideengeschichtlich erfolgen können. Zugleich ist den Definitionsbemühungen eine normative Dimension eingeschrieben, denn es geht zumeist auch um die Beschreibung eines „Sozialen Problems“ (Dollinger 2010; Figlestahler/Schau 2019). Entsprechend korrespondieren die Perspektiven auf islamistischen Extremismus sowohl mit politischen Setzungen, etwa in der Ausgestaltung von Förderprogrammen, als auch mit der gesellschaftlichen Positionierung der Forschenden (Frank/Scholz 2023: 10f.).
Nicht zuletzt aus den beiden genannten Aspekten folgt, dass es sich tatsächlich um ein heterogenes Phänomen handelt, dass sich weniger systematisch, als durch die Zusammenschau familienähnlicher (Wittgenstein 1984: 36ff.) Diskurse erschließt.2 So lässt sich die Frage, was islamistischer Extremismus ist, zum einen theoretisch bspw. über Ideologiefragmente, Einstellungen und Problematisierungen wie Demokratiefeindlichkeit, Antisemitismus oder Gewaltbefürwortung definieren (Biskamp/Hößl 2014). Ebenso lässt sich das Phänomen historisch-ideengeschichtlich herleiten, also bspw. entlang der Vordenker:innen der islamistischen Bewegungen und ihrer theologischen und politischen Programmatik (Steinberg/Hartung 2005). Eine davon ausgehend abstrahierende Definition bietet Seidensticker. Er definiert „Islamismus“ als „Bestrebungen zur Umgestaltung von Gesellschaft, Kultur, Staat oder Politik anhand von Werten und Normen, die als islamisch angesehen werden“ (Seidensticker 2015: 9). Damit richtet sich der Fokus auf ein deutlich breiteres Feld unterschiedlicher gesellschaftlicher Akteure und Handlungspraxen. Für den Blick auf die in diesem Band zu diskutierenden deutlich spezifischeren Herausforderungen macht das eine Eingrenzung auf bestimmte Problemdimensionen erforderlich.
Im Begriff „islamistischer Extremismus“ geschieht diese Eingrenzung über den Begriff des „Extremismus“. Dieser ist hier ausgehend von Heitmeyer (1987) als Verbindung von Ideologie der Ungleichwertigkeit und der Akzeptanz von Gewalt als ‚normaler‘ Konfliktregulierungsform verstanden. Der Extremismusbegriff wird hier in dem Wissen verwendet, dass er ebenfalls einen unspezifischen Containerbegriff darstellt (Neumann 2017: 39) und er wegen seiner normativen Implikationen kritisch diskutiert wird (Forum für kritische Rechtsextremismusforschung 2011).
Darüber hinaus ist eine Vielzahl verwendeter Begriffe wie Dschihadismus, (Dschihad-)Salafismus demokratiefeindlicher und gewaltorientierter Islamismus, religiös begründeter Extremismus etc. in der Forschungsliteratur relevant, die im Diskurs teils synonym und teils in Abgrenzung zueinander verwendet werden. Peters arbeitet ausgehend vom „Islamismus“-Begriff heraus, dass sowohl die Begriffe als auch die damit bezeichneten Gegenstände stark heterogen Verwendung finden, also sowohl derselbe Gegenstand mit unterschiedlichen Begriffen markiert werden kann, als auch derselbe Begriff zur Bezeichnung gänzlich unterschiedlicher Gegenstände herangezogen wird (Peters 2012). Mit den genannten heterogenen Perspektiven überlagern sich somit unterschiedliche Diskurse. Dies spiegelt sich in normativen Konflikten um die Grenzen des Problematischen wider, wie sie bspw. in Bezug auf die Frage des „legalistischen“ Islamismus immer wieder diskutiert werden (Schiffauer 2015).
Weitere Forschungsarbeiten verweisen auf die Korrespondenz zwischen Forschungsperspektiven zu islamistischem Extremismus und der Konstruktion von (negativen) Islambildern (Franz 2018; Amir-Moazami 2022). Forschung zu jungen Menschen, pädagogischer Praxis und islamistischem Extremismus hat somit ein Stigmatisierungspotential, das es erforderlich macht, die Individualität und Eigenperspektive der jungen Menschen vor dem Hintergrund der Zuschreibungen, die mit der großen und teils normativ aufgeladenen Klammer des islamistischen Extremismus einhergehen können, differenziert zu berücksichtigen. Gerade Akteure aus der pädagogischen Fachpraxis verweisen darauf, dass den Begriffen in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen kaum unmittelbare Relevanz zukommt, sondern stattdessen konkrete eigene Bedarfe, Handlungen und Probleme der Adressat:innen im Vordergrund stehen.
___
1 Dieser Band ist am Deutschen Jugendinstitut (DJI) im Rahmen des Projekts „Arbeitsund Forschungsstelle Demokratieförderung und Extremismusprävention“ (AFS) entstanden, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) von 2020 bis 2024 gefördert wird. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFzA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autor:innen die Verantwortung. Die Herausgeber:innen danken den Kolleg:innen der AFS, die in unterschiedlichen Phasen der Entstehung des Buches tatkräftig mitgewirkt und unterstützt haben: Josephine Garitz, Jost Eisenmenger, Janine Kirsch, Johanna Häring, Pia Sauermann, Simone Rauer, Björn Milbradt und Annika Jungmann. Besonderer Dank gilt den Gutachter:innen im Reviewverfahren der Beiträge, Janina Bartschies für das aufmerksame Schlusslektorat der Beiträge, sowie Götz Nordbruch von ufuq.de für die abschließende Begutachtung des fertigen Bandes im Rahmen der Qualitätssicherung am DJI.
2 Islamistischer Extremismus weist eine Reihe transnationaler Dimensionen auf, etwa durch die Verflechtung von Diskursen und Akteuren in den Nahen und Mittleren Osten und nach Nordafrika. Nicht zuletzt da die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in diesen Ländern sehr unterschiedlich sind, gilt es beim Heranziehen internationaler Forschungsarbeiten kritisch zu prüfen, inwiefern Ergebnisse auf Kontexte in Deutschland übertragbar sind.
***
Sie möchten gern weiterlesen?
Jetzt „Jugend und islamistischer Extremismus“ versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
 Joachim Langner, Maren Zschach, Marco Schott, Ina Weigelt (Hrsg.):
Joachim Langner, Maren Zschach, Marco Schott, Ina Weigelt (Hrsg.):
Mehr Leseproben …
… finden Sie auf unserem Blog.
© Titelbild: gestaltet mit canva.com