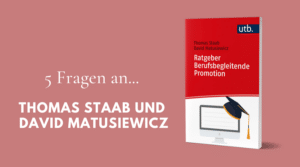Über das Buch
Soziale Arbeit lebt als Disziplin und Profession von der ständigen Weiterentwicklung des in und mit ihr geteilten Wissens. Forschung, Theoriebildung, Lehre und Praxis bilden hierbei ein komplexes Gefüge im gesellschaftlichen Kontext. Der Band nimmt die verschiedenen Relationen in den Blick: Wo, von wem und in welcher Weise wird Wissen der Sozialen Arbeit gebildet, weiterentwickelt und geteilt? Und um welche Arten von Wissen geht es dabei?
Liebe Herausgeber*innen, worum geht es in Geteiltes Wissen?
Bei der Wissenschaft Soziale Arbeit handelt es sich um eine vergleichsweise junge Wissenschaft. Wissensentwicklung in dieser Disziplin findet deshalb noch immer unter erschwerten Bedingungen statt, was beispielsweise an der kaum vorhandenen Forschungsförderung und den schwierigen Rahmenbedingungen für Forschung an den HAWen seinen Ausdruck findet. Und dennoch, oder vielleicht besser: Umso wichtiger ist es, immer wieder den gegenwärtigen Stand der Dinge zu überprüfen und zu fragen, wie Wissen im Wechselverhältnis zwischen Forschung, Lehre und Praxis – und selbstverständlich eingebettet in gesellschaftliche Rahmenbedingungen – entsteht und verhandelt wird. Mit dem vorliegenden Buch wollten wir genau dies erreichen, nämlich im Sinne einer Zwischenbilanz den Diskurs über Wissensgenerierung und Wissensverhandlung im Kontext von Sozialer Arbeit abbilden.
Wie kamen Sie auf die Idee, dieses Buch herauszugeben? Gab es einen „Stein des Anstoßes“?
Ausgangspunkt des Bandes war die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit im Jahr 2022, die am 29. und 30. April 2022 in Kooperation mit der Hochschule RheinMain durchgeführt wurde. Hier konnte ein Forum geboten werden, um die derzeitig zentralen Fragen rund um das Thema Wissensbildung und aktuelle Herausforderungen breit zu diskutieren. Mehr als 1000 Teilnehmende aus Wissenschaft und Praxis nahmen an der Tagung teil, und es wurden mehr als 170 empirische, theoretische und praxisnahe Beiträge präsentiert und diskutiert. Über ein Auswahlverfahren wurden dann Kolleg:innen von einigen der Beiträge zur Ausarbeitung aufgefordert und daraus ist das Buch dann letztendlich entstanden.
Wie funktioniert Wissensbildung in der Sozialen Arbeit: Wie und wo findet sie statt und wer ist beteiligt?
Das ist eine sehr umfassende Frage und wir könnten nun auf unterschiedlichen Ebenen darauf reagieren. Aus der Perspektive der Praxis Sozialer Arbeit ist beispielsweise grundlegend zu sagen, dass in jeder sozialen Interaktion fachliches Wissen sowohl reproduziert wird, aber gleichzeitig ist jede dieser sozialen Situationen in ihrem Verlauf einzigartig, so dass auch immer neues Wissen entsteht, oft ohne dass dies jeweils bewusst wahrgenommen und reflektiert wird. Aber erst durch die bewusste Wahrnehmung und Reflexion kann Wissen zugänglich und verhandelbar gemacht werden. Vor dem Hintergrund der komplexen und umfangreicher werdenden Aufgaben und der zunehmenden Verknappung von Ressourcen – insbesondere auch zeitlichen Ressourcen – werden gerade diese notwendigen Reflexionsräumen eingespart.
Damit verbunden bleibt auch die Wissensgenerierung auf der Strecke. Und dies obwohl wir es aufgrund der rasanten gesellschaftlichen Veränderungen in der Sozialen Arbeit gerade jetzt mit ganz neuen Wissenszuwachs zu tun haben, wie bspw. durch die Pandemie und ihre Auswirkungen, durch die verstärkte Einwanderung aufgrund von Krieg und Verfolgung, die extremen Klimaveränderungen, steigende Armut und vielem mehr. Soziale Arbeit ist in allen diesen Bereichen fachlich eingebunden, kann aber nur Bruchteile der damit verbundenen Wissensgenerierung zugänglich machen. Dies ist nur ein Beispiel.
Wir könnten allein aus der Praxis Sozialer Arbeit noch sehr viel mehr Beispiele nennen und müssten dann noch die Perspektiven Lehre und Forschung hinzu nehmen und uns die Bedingungen der Wissensgenerierung dort ansehen. Und auch damit noch nicht genug, denn Wissensgenerierung und die Weiterentwicklung von Wissen geschieht im wechselseitigen Austausch von Praxis, Lehre und Forschung. Wissen ist also ein dynamisches, relationales und oft widersprüchliches Gefüge, das von unterschiedlichen Akteur*innen eingebracht, generiert, weiterentwickelt und geteilt wird.
Welche Aspekte der Wissensbildung in der Sozialen Arbeit werden Ihrer Einschätzung nach künftig stärker in den Fokus rücken?
Mit Sicherheit Kriseninterventionen und der Umgang mit den Auswirkungen von Krisen. Aber darüber hinaus wird uns die zunehmende Technisierung und Digitalisierung beschäftigen, wie auch die weiterhin neoliberale Ausrichtung sozialer Dienstleistungen.
Darum sind wir Autor*innen bei Budrich
Wir schätzen die persönliche und verlässliche Kommunikation mit den Mitarbeiter:innen in den unterschiedlichen Abteilungen.
Kurzvitae der Herausgeber*innen
Sonja Kubisch: Ich bin Professorin für die Wissenschaft Soziale Arbeit an der TH Köln. Zuletzt war ich sechs Jahre als Beisitzerin im DGSA-Vorstand aktiv. Meine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte liegen in der rekonstruktiven Forschung zu Professionalität und Professionalisierung Sozialer Arbeit, Organisationen Sozialer Arbeit, Zivilgesellschaft und freiwilligem Engagement sowie Trauer und Sozialer Arbeit.
Christian Spatscheck: Ich bin Professor für Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit an der Hochschule Bremen. Aktuell bin ich einer der beiden Co-Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA). Inhaltlich arbeite ich weiterhin viel im Bereich der Theorieentwicklung der Sozialen Arbeit, aktuell vor allem zu sozialräumlichen, systemischen und sozialökologischen Ansätzen. In neueren Forschungsprojekten habe ich mit Kolleg:innen Alternativen zur geschlossenen Unterbringung von „Systemsprenger:innen“ in der Jugendhilfe erkundet sowie international vergleichend erforscht, welche Innovationen aus der Zeit der Covid-19-Pandemie für die Praxisphase im Studium der Sozialen Arbeit entstanden sind.
Michaela Köttig: Ich bin Professorin für Gesprächsführung, Kommunikation und Konfliktbearbeitung und Sprecherin des Kompetenzzentrums ‚Soziale Interventionsforschung‘, einem äußerst innovativen Forschungsinstitut an der Frankfurt University of Applied Sciences. Ich war die letzten Jahre eine der Vorsitzenden der DGSA und meine Forschungsschwerpunkte bewegen sich in den Bereichen Rechtsextremismus, Radikalisierungsentwicklungen und (Flucht)Migration. Momentan ist gerade ein größeres Forschungsverbundprojekt angelaufen, in dem wir uns mit Geschlecht und Rechtsextremismus beschäftigen.
Jetzt versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
Theorie, Forschung und Praxis der Sozialen Arbeit, Band 26
© Titelbild: gestaltet mit canva.com

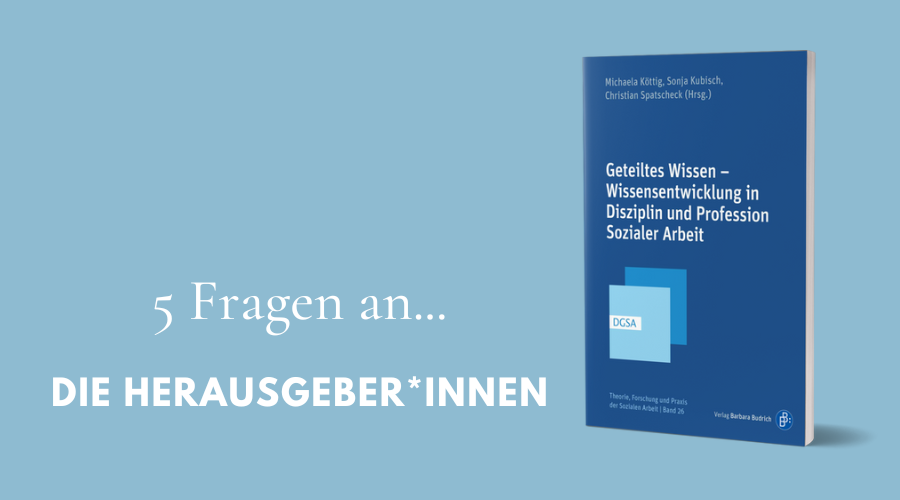
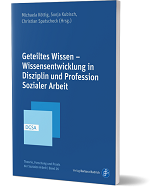 Michaela Köttig, Sonja Kubisch, Christian Spatscheck (Hrsg.):
Michaela Köttig, Sonja Kubisch, Christian Spatscheck (Hrsg.):