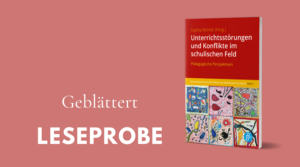***
Bearbeitungshinweise für Fälle zum Sozialrecht – Einstieg in die sozialrechtliche Fallarbeit
Wie im Vorwort bereits angeklungen, ist es gerade Intention dieser Sammlung, unterschiedliche Lehrende und damit auch Prüfende mit ihren Beiträgen in diesem Band zu versammeln. Damit einher geht die zum Teil unterschiedliche Prüfungsweise bzw. der Prüfungsstil. Dies verdeutlicht jedoch lediglich die unterschiedliche Ausführung bei einheitlicher Struktur und identischen Grundsätzen. Auch Ihr Prüfer bzw. Ihre Prüferin wird zum Teil seinen bzw. ihren eigenen Stil der Fallbearbeitung haben. Machen Sie sich mit diesem vertraut, und nutzen Sie die hier versammelten Ideen als Angebot.
Auch die Gesetzeszitation ist nicht immer einheitlich. Wir haben hier zwischen der klassischen Zitierweise (z.B. § 1 Abs. 1 S. 1 OEG) und der verkürzten Form (z. B. § 2 II 1 SGB XII) gewechselt. Sie sollten sich innerhalb einer Prüfung/Bearbeitung für eine dieser beiden Formen entscheiden.
Die Fälle sind mit Fußnoten und jeweils am Ende mit Literaturhinweisen versehen. Weitere Literaturangaben finden sich im Literaturverzeichnis. Es versteht sich von selbst, dass diese in einer Klausur – im Gegensatz dazu bei der Hausarbeit – nicht erwartet werden. Wie immer dienen diese Hinweise dem wissenschaftlichen Beleg, zudem bieten sie die Möglichkeit, sich tiefer mit den Themen auseinanderzusetzen. Nutzen Sie auch diese Möglichkeit!
Sie werden feststellen, dass die Fälle unterschiedlich lang und unterschiedlich komplex sind. Die Bearbeitung wird also unterschiedlich lang dauern und Sie vom Schwierigkeitsgrad her unterschiedlich fordern. Auch dies ist gewollt. Damit diese Sammlung zugleich auf die Prüfungen im Sozialrecht vorbereitet, haben wir diese verschiedenen Formate gewählt, da die Prüfungen – in der Regel Klausuren – nicht überall gleich lang sind, nicht immer nur aus Fallprüfungen bestehen etc.
Bei aller Sorgfalt, die wir haben walten lassen, können sich gleichwohl immer mal Fehler einschleichen. Für entsprechende Hinweise und Verbesserungsvorschläge sind wir Ihnen dankbar. Senden Sie dies gerne an: Prof. Dr. Corinna Grühn, Hochschule Bremen, Studiengang Soziale Arbeit, Neustadtswall 30, 28199 Bremen.
Fall 1: Ein Medikament für Eveline
Prof. Dr. Ingo Palsherm
Themenbereich: Gesetzliche Krankenversicherung, SGB V
Sie arbeiten als Sozialpädagogin/Sozialpädagoge in der allgemeinen Sozialberatung eines großen Trägers der freien Wohlfahrtspflege. In Ihre Beratungsstunde kommt Eveline Darmstadt (E) und schildert folgenden Sachverhalt:
Vor einiger Zeit sei bei ihr eine Brustkrebserkrankung festgestellt worden. Der Tumor sei operativ entfernt worden, und sie habe eine Chemotherapie erhalten. Ihr gehe es nun schon besser. Sie arbeite seit drei Monaten wieder in Vollzeit in ihrem Job als Verkäuferin. Ihre behandelnde Ärztin wolle eine sog. adjuvante Therapie durchführen, um die Gefahr einer Rückkehr des Krebses (sog. Rezidiv) aufgrund von unerkannten kleinen Metastasen1 zu verhindern. Sie habe ihr dazu ein anthroposophisches Mistelpräparat verordnet. Dieses habe eine das Immunsystem positiv beeinflussende Wirkung (sog. Immunmodulation) durch pharmakologisch wirksame Stoffe. Nachdem ihre gesetzliche Krankenkasse die Kosten des Medikamentes ursprünglich getragen hatte, hat E nun erfolglos einen Antrag auf Kostenübernahme für weitere fünf Jahre gestellt. Die Krankenkasse begründet die Weigerung damit, dass es sich um ein zwar apotheken-, aber nicht verschreibungspflichtiges Präparat handele (sog. OTC-Arzneimittel2). Solche Arzneimittel seien von der Verordnungsfähigkeit zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung prinzipiell ausgeschlossen (s. § 34 Abs. 1 S. 1 SGB V). Außerdem habe der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)3 in seiner Arzneimittel-Richtlinie Mistelpräparate zwar ausnahmsweise als verordnungsfähig anerkannt, wenn sie als Therapiestandard bei bestimmten schwerwiegenden Erkrankungen gälten. Dies betreffe aber nur palliative4 Therapien von malignen Tumoren zur Verbesserung der Lebensqualität und nicht – wie hier – adjuvante Therapien (s. § 34 Abs. 1 S. 2 SGB V i.V.m. § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 SGB V i.V.m. Nr. 32 der Anlage I zum Abschnitt F der Arzneimittel-Richtlinie (sog. OTC-Übersicht)).
E ist mit der Ablehnung nicht einverstanden. Denn immerhin habe ihre Ärztin das Arzneimittel verordnet. Außerdem sei es ja wohl kaum demokratisch, wenn anstatt des Gesetzgebers „irgend so ein Gremium aus Ärzten und Krankenkassen“ entscheide, welches Arzneimittel verordnungsfähig sei. Darüber hinaus müsse der Sozialstaat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG schützen. Der Staat verletze dieses Grundrecht, wenn sie in ihrer Situation, die zwar nicht mehr akut lebensbedrohlich, aber nach wie vor sehr einschränkend sei, das Mistelpräparat nicht erhalte. Da das Medikament ihr helfe, habe sie es sich nun auf eigene Kosten besorgt. Dies könne sie sich aber gar nicht leisten.
Um E unterstützen zu können, müssen Sie folgende Frage prüfen (bitte fertigen Sie ein Rechtsgutachten im Gutachtenstil an): Hat E einen Anspruch gegen ihre gesetzliche Krankenversicherung auf Erstattung der privat aufgewendeten Kosten für das verordnete „Mistelpräparat“ und zukünftig auf Leistung zu Lasten der Krankenkasse?
Lösungsskizze
Anspruch auf Kostenerstattung nach § 13 Abs. 3 S. 1 Fall 2 SGB V wegen Vorliegen eines unbefriedigten Naturalleistungsanspruchs nach §§ 27 Abs. 1 S. 1 und 2 Nr. 3, 31 SGB V
I. Krankenversicherung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V
II. Vorliegen einer Krankheit
- Regelwidriger körperlicher Zustand
- Behandlungsbedürftigkeit des Zustands
III. Besondere Voraussetzungen des Leistungsfalls
- Apothekenpflichtiges Arzneimittel nach § 31 Abs. 1 SGB V
- Ausgestaltung des Rahmenrechts auf Arzneimittel
a) Herausnahme nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel aus Leistungskatalog nach § 34 Abs. 1 SGB V
b) Ausnahmsweise kein Ausschluss nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel
c) Verfassungsmäßigkeit des Leistungsausschlusses
aa) Demokratische Legitimation des G-BA zum Richtlinienerlass
bb) Verstoß des Leistungsausschlusses gegen Grundrechte
IV. Ergebnis
___
1 Metastasen sind Absiedlungen des Tumors in weiter entferntem Gewebe (sog. Töchtergeschwulste).
2 OTC kommt von „over the counter“, also gleichsam ein „über den Apothekentresen-Arzneimittel“.
3 Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Er besteht aus Vertretern der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen. Seine hohe praktische Bedeutung folgt daraus, dass die Leistungsansprüche im SGB V nur als sog. Rahmenrecht im Gesetz konstruiert sind (vgl. dazu vertiefend Palsherm, Sozialrecht, 2. Aufl. (2015), Rz. 181). Bevor ein versicherter Mensch eine konkrete Leistung erhalten kann, muss dieses Rahmenrecht erst noch durch eine Entscheidung seines behandelnden Vertragsarztes konkretisiert werden, der seinerseits durch verbindliche Richtlinien des G-BA (s. § 91 Abs. 6 SGB V) determiniert ist. Diese Richtlinien über eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten legen den Leistungskatalog der Krankenversicherung fest (§ 92 Abs. 1 S. 1 SGB V). Letztlich entscheidet der G-BA damit, welche Leistungen von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt werden.
4 Eine palliative Therapie zielt nicht mehr auf die Heilung, sondern nur noch auf die Linderung der Symptome ab.
***
Sie möchten gern weiterlesen?
Jetzt versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
2., aktualisierte Auflage
Über „Fälle zum Sozialrecht“
Dieses Lehrbuch für den Bereich des Sozialrechts beleuchtet alle wesentlichen sozialrechtlichen Bereiche anhand von Fällen. Mit seiner klaren didaktischen Aufbereitung für die Sozialrechtslehre richtet sich das Buch insbesondere an Studierende der Sozialen Arbeit, die Anhaltspunkte für Prüfungen im Sozialrecht suchen. Die Fallgestaltungen werden analog zu den Erfordernissen in den Klausuren in gutachterlicher Form geprüft und dargestellt. Zu den für die Soziale Arbeit wesentlichen sozialrechtlichen Themen (neben der Sozialversicherung insbesondere die Grundsicherung für Arbeitssuchende und die Sozialhilfe) wird mindestens ein Fall dargestellt, der das jeweilige Gebiet illustriert und Grundlage für weitere Falllösungen sein kann.
© Titelbild gestaltet mit canva.com

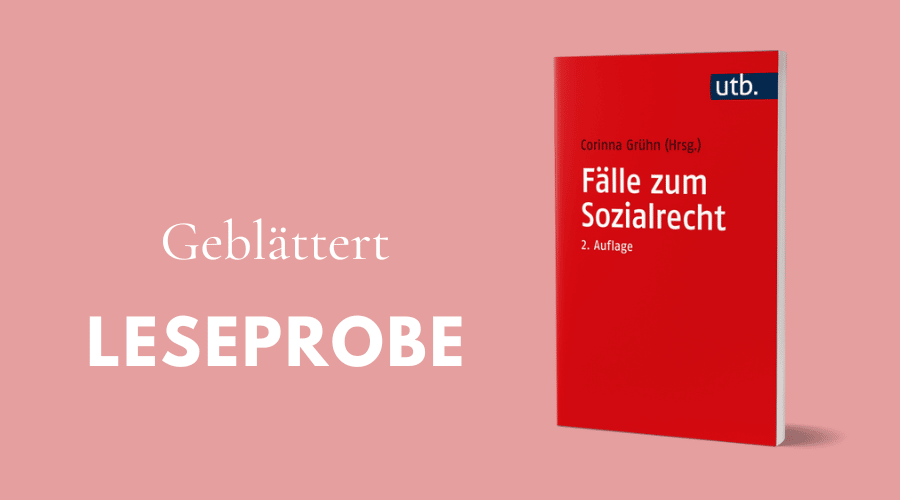
 Corinna Grühn (Hrsg.):
Corinna Grühn (Hrsg.):