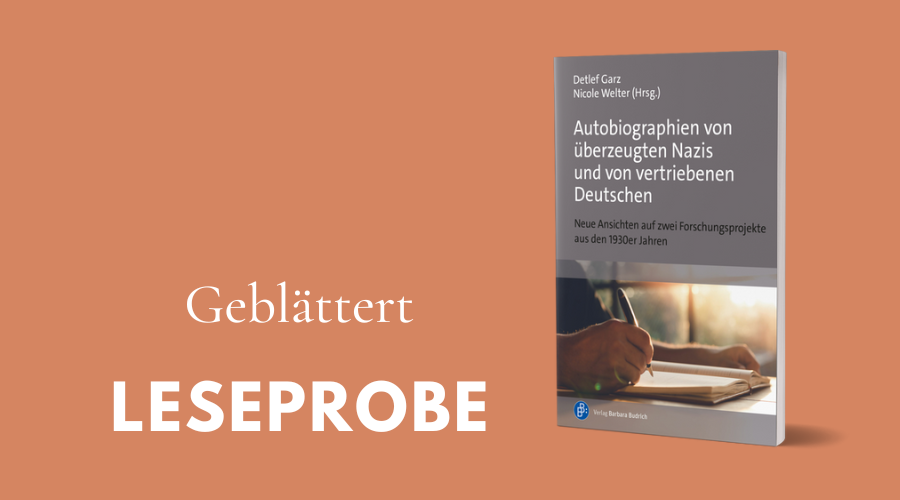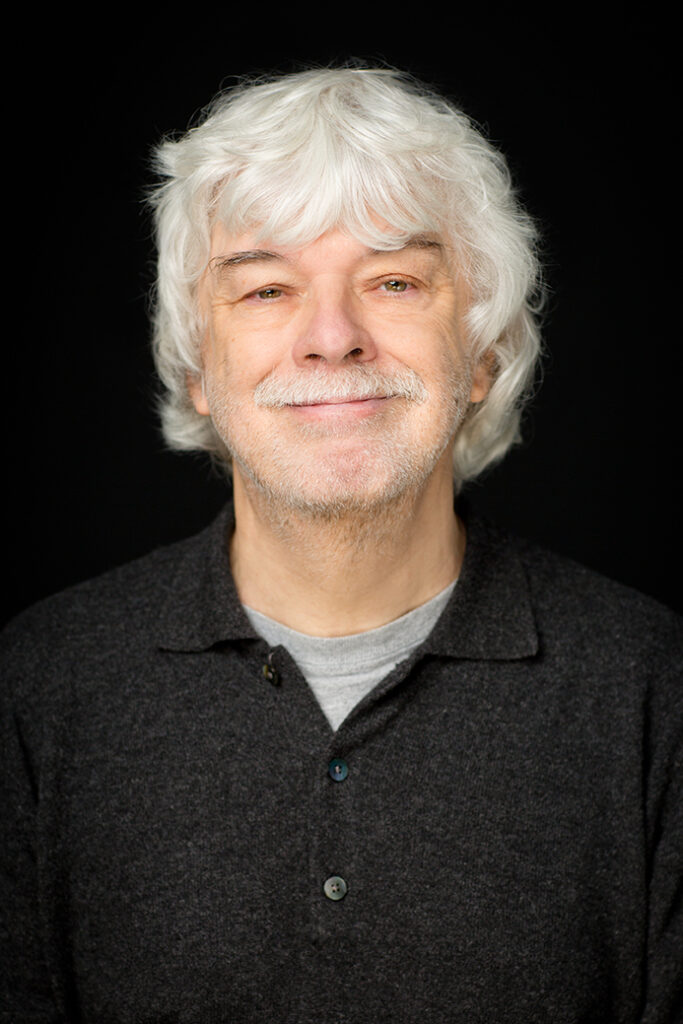Selbstzeugnisse stellen wichtige Dokumente dar, um die Zeit des Nationalsozialismus zu verstehen. In ihrem neuen Band Autobiographien von überzeugten Nazis und von vertriebenen Deutschen. Neue Ansichten auf zwei Forschungsprojekte aus den 1930er Jahren versammeln Detlef Garz und Nicole Welter Beiträge zu Autobiographien, die im Rahmen von ‚wissenschaftlichen Preisausschreiben‘ in der Zeit des Nationalsozialismus erhoben wurden.
***
Autobiographien von überzeugten Nazis und von vertriebenen Deutschen: Einleitung — „So ist das Leben, so zieht es dahin“
Detlef Garz und Nicole Welter
Dass die Vergangenheit nicht ruht, ist trivial. Dass sie sich in der gegenwärtigen Zeit in besonderem, in beunruhigendem Maße zum Ausdruck bringt, ist offensichtlich. Und dass der Umgang des Menschen mit der Natur und der Umgang der Menschen untereinander nicht folgenlos ist oder bleibt, liegt auf der Hand. Als wir unsere Tagung über „Autobiographien von überzeugten Nazis und von emigrierten Deutschen. Neue Ansichten auf zwei Forschungsprojekte aus den 1930 Jahren“ planten, breitete sich seit etwa Februar 2020 eine Infektionskrankheit namens Corona/Covid 19 aus und entwickelte sich zu einer Pandemie. Als wir die Tagung im Oktober 2022 an der Christian- Albrechts-Universität zu Kiel durchführten, war deren Höhepunkt zwar überschritten, aber Vorsichtsmaßnahmen galten noch. Und seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 überlagerte dieser Krieg das Geschehen. In dem Augenblick, in dem wir diese Einleitung schreiben, herrscht seit dem Überfall der islamistischen Organisation Hamas auf Israel ein weiterer Krieg.
Geschichte, kollektiv und individuell. Unser Interesse an den „Autobiographien von überzeugten Nazis und von emigrierten Deutschen“ war ebenso auf das Geschehen in der Vergangenheit gerichtet wie auf soziale Linien, die bis in die Gegenwart reichen, auf Vergangenes wie Gegenwärtiges, auf Gesellschaften wie auf Personen (vgl. exemplarisch Garz/Welter 2023). Am Beispiel des nationalsozialistischen Wirkens sollte während unserer Tagung einerseits herausgestellt werden, wie Ideologien in Menschen eindringen, aber auch wie sie von ihnen geschaffen werden, wie sie dann ihr Leben bestimmen und wie sie schließlich handlungswirksam und letztendlich handlungsleitend werden. Andererseits stellte sich die Frage, wie die von dieser Ideologie Betroffenen damit umgehen, dass sie Aberkennung in Form von Ausgrenzung und Entrechtung erfuhren – insofern überhaupt Möglichkeiten bestanden, damit umgehen zu können. Will man diese Fragen empirisch, d. h. durch auf Erfahrungen gestützte Belege, beantworten, gilt es, aussagekräftige Materialien heranzuziehen.
Wir beziehen uns dazu auf ein in den USA „im goldenen Zeitalter der persönlichen Dokumente“ (Wrightsman 1981, S. 377), also in den Jahren zwischen etwa 1920 und 1945, aufkommendes Forschungsprogramm, das sich explizit auf autobiographische und biographische Unterlagen stützte (vgl. Garz, in diesem Band). Ihren Ausgang nahm diese Richtung von der bahnbrechenden Studie von William Thomas und Florian Znaniecki über „The Polish Peasant in Europe and America“ (1918-1920; dazu Abbott/ Egloff 2007, Pries 2015). In Abgrenzung von einer unified science, die sich am Modell der Physik orientierte, vom Positivismus generell, suchten die beiden Wissenschaftler einen sozialwissenschaftlichen, einen verstehenden Zugang zum Gegenstand ihrer Forschung, dessen möglichen Ertrag sie wie folgt beschrieben. „Wir sind uns sicher, sagen zu können, dass persönliche Lebenserzählungen, so vollständig wie eben möglich, den perfekten Typus soziologischen Materials begründen“ (Thomas und Znaniecki 1974, S. 1832f.).
Solche lebensgeschichtlichen Unterlagen stehen für unser Vorhaben in überzeugender Weise aufgrund der Durchführung von zwei „wissenschaftlichen Preisausschreiben“ aus den Jahren 1934 und 1939 zur Verfügung. Im Mittelpunkt beider Wettbewerbe stand die Bitte an die potenziellen Teilnehmer: innen, ausführlich über ihr Leben zu berichten, d. h. autobiographische Aufzeichnungen zu erstellen. Theodore F. Abel, 1896 im polnischen Lodz geboren, 1923 in die USA eingewandert und einige Jahre später US-amerikanischer Staatsbürger geworden, war, in seiner Eigenschaft als Professor an der Columbia University in New York City, der Initiator des ersten Preisausschreibens, das auf „die beste Beschreibung des eigenen Lebenslaufs eines Hitler-Deutschen“ abzielte.1 Dazu warb er 1934 bei überzeugten und langjährigen Anhängern oder Mitgliedern der NSDAP („Alte Kämpfer“) autobiographische Manuskripte ein. Die Datenerhebung, die Auswertung und die Ergebnisse fasste er in seiner Veröffentlichung unter der Überschrift „Why Hitler came into power“ (1938) zusammen (vgl. auch Falter et al. 2022, Giebel 2018, Fehlhaber, Garz, Kirsch 2007). – Darauf wird im ersten Teil dieses Bandes Bezug genommen.
Das zweite Preisausschreiben mit dem Aufruf „An alle, die Deutschland vor und während Hitler gut kennen“, durchgeführt von drei Wissenschaftlern der Harvard University, dem Psychologen Gordon Allport, dem Historiker Sidney Fay und dem Soziologen Edward Hartshorne, zielte auf autobiographische Lebensbeschreibungen unter der Überschrift „Mein Leben in Deutschland vor und nach dem 30. Januar 1933“ ab. Angesprochen wurden Personen, die Deutschland bzw. Österreich während der Zeit des Nationalsozialismus verlassen mussten – und konnten – und die sich nun an einem Ort außerhalb Deutschlands, in den USA, in der Schweiz, in England oder weiteren Ländern, in der Emigration befanden. – Leider haben die Forscher nur wenige Ergebnisse ihrer Forschung präsentiert. Allerdings sind die eingereichten Manuskripte in der Houghton Library der Harvard Universität einsehbar. – Die Arbeiten, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, bilden den Inhalt des zweiten Teils dieses Bandes.
Betrachtet man die beiden Projekte im Hinblick auf ihre Gemeinsamkeiten, so sticht neben der Orientierung an der biographischen und der damit einhergehenden „interpretativen“ Forschungsstrategie vor allem ein Aspekt hervor: Das miteinander geteilte Forschungsverständnis in Bezug auf den Gegenstand der Untersuchungen: Das übergreifende wissenschaftliche Ziel bestand darin, einen Beitrag zum Verständnis von „sozialen bzw. revolutionären Bewegungen“ als „Formen des kollektiven oder pluralistischen Verhaltens“ (Abel 1937, S. 347) zu leisten. „Wir müssen die gemeinsamen und die besonderen Merkmale sozialer Bewegungen sowie die Faktoren oder Bedingungen kennen, die für ihre Entwicklung von Bedeutung sind“ (ebd.). Damit wurde nicht nur eine bislang sozialwissenschaftlich unbeantwortete Problemstellung angesprochen, und zwar wertfrei, sondern auch die praxisrelevante Frage, wie gesellschaftlich bzw. politisch auf solche Bewegungen, die sich einerseits gegen etwas [richten], das sie zu bekämpfen und zu beseitigen suchen, und die andererseits auf ein Ziel ausgerichtet sind, das sie zu verwirklichen suchen, reagiert werden kann (vgl. ebd., S. 348).
So stellt Abel seiner Veröffentlichung eine Reihe von Fragen voran. „Wer waren die Menschen, die sich der Hitler-Bewegung anschlossen? Durch welche früheren Erfahrungen oder durch welche Faktoren in ihrem Werdegang lässt sich die Mitgliedschaft erklären? Auf welcher Basis rechtfertigten sie ihre Teilnahme? … Wie wurde diese Bewegung gefördert? Worin bestanden die Aktivitäten des jeweiligen Mitglieds?“ (Abel 1938/1986, S. 2: Hervorhebung durch die Verf.). Und Ernest Jandorf, ein Projektmitarbeiter der Harvard- Gruppe, betont in einer 1941 eingereichten Qualifikationsarbeit. „Die vorliegende Studie ist das Resultat zweier verschiedener Gedankengänge und Interessenlagen. Die eine betrifft die Psychologie einer revolutionären sozialen Bewegung, die andere die spezifische Nutzung der Lebensgeschichte als Forschungstechnik“ (Jandorf 1941, S. 1; Hervorhebung durch die Verf.). Und nach einem Hinweis auf die Arbeit von Abel erläuterte er die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die eigene Forschung. „Da es uns […] nicht möglich war, Lebensgeschichten von Nationalsozialisten zu erhalten, enthält das Preisausschreiben, aus dem unsere Ergebnisse hervorgegangen sind, nur die Geschichte der Revolution, wie sie von ihren Opfern, den Flüchtlingen vor der nationalsozialistischen Verfolgung, erzählt wird“ (ebd., S. 3).
Was wir in den Unterlagen vorfinden, sind also einerseits autobiographische Erzählungen von Angehörigen einer sozialen Bewegung, Mitglieder eines „Kollektivs“, welche sich nach dem Erreichen ihres Ziels im Jahr 1933 als „Sieger einer sozialen Bewegung“ sahen, die sich (und ihre Ideologie) durchgesetzt hatte, andererseits handelt es sich um Lebensbeschreibungen von Personen, deren Lebensentwurf und schließlich deren Leben zwischen 1933 und dem Jahr ihrer Emigration nach und nach systematisch verfolgt und zerstört wurde und die sich nun an einem fremden Ort, in der Regel verbunden mit einem unsicheren Status sowohl im Hinblick auf die eigene Zukunft als auch die Gegenwart von in Deutschland verbliebenen Verwandten und Freunden, befanden. Während die erste Gruppe sich als relativ homogen im Hinblick auf ihre das Leben dominierende politische Ausrichtung zeigt, spiegelt sich in der zweiten Gruppe die individuelle Vielfalt des Lebens.
___
1 Aus dem deutschsprachigen Text der Ausschreibung. Wir danken Frau Claudia Thiede (M.A.), die uns auf dieses als verschollen erachtete Dokument aufmerksam gemacht hat.
***
Sie möchten gern weiterlesen?
Jetzt versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
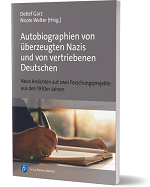 Detlef Garz, Nicole Welter (Hrsg.)
Detlef Garz, Nicole Welter (Hrsg.)