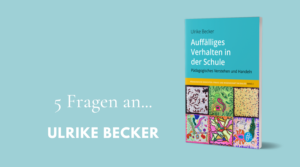Interview zum Buch „Alltag und Soziale Arbeit in der Corona-Pandemie“
Liebe Herausgeberinnen, Sie haben gerade den Sammelband Alltag und Soziale Arbeit in der Corona-Pandemie herausgegeben. Welche Themen bzw. Themenbereiche behandeln die Autor*innen?
Der Sammelband umfasst Artikel, die sich mit der Perspektive von Adressat*innen Sozialer Arbeit auf Kontaktbeschränkungen und Infektionsgefahren beschäftigen. Es stehen qualitative Studien im Vordergrund, in denen Adressat*innen selbst zu ihrem Erleben interviewt wurden. Ganz unterschiedliche Handlungsfelder werden betrachtet: Kinder- und Jugendhilfe genauso wie Wohnungslosenhilfe oder die Arbeit mit Senior*innen. Zudem beschäftigen sich drei übergreifende Artikel mit der Frage, welche Konsequenzen aus den differenzierten Einblicken für die Profession und Disziplin Sozialer Arbeit abgeleitet werden können.
Was gab den Anstoß, den Sammelband herauszugeben?
Seit Herbst 2020 haben wir uns intensiver mit dem Einfluss der Corona-Pandemie auf die Lebenswelten von Adressat*innen Sozialer Arbeit beschäftigt. Uns fiel auf, dass diese zumeist nicht selbst gefragt wurden, wie sie die Pandemie und auch die Veränderungen Sozialer Arbeit durch die Pandemie erlebt haben. Primär wurde in wissenschaftlichen oder journalistischen Veröffentlichungen vor allem die Sichtweise der professionellen Fachkräfte dargestellt, die für Ihre Adressat*innen sprachen. Wir wollten aber nicht über die Menschen reden, sondern mit ihnen. Die daraus entstehende Lücke im wissenschaftlichen Diskurs über die Corona-Pandemie wollten wir schließen und die Perspektive der Adressat*innen Sozialer Arbeit in ihren eigenen Sinngebungen sichtbar machen.
Sie schreiben, Sie möchten in diesem Sammelband diejenigen zu Wort kommen lassen, über die in der Sozialen Arbeit meist nur gesprochen wird‘ – nämlich die Adressat*innen und Nutzer*innen Sozialer Arbeit. Welche – möglicherweise überraschenden – Erkenntnisse eröffnete diese Perspektive im Besonderen?
In der Auseinandersetzung um die Corona-Pandemie wurde pauschalisierend weitgehend davon ausgegangen, dass durch die Pandemie bestehende soziale Ungleichheiten verschärft wurden. Wenn man Adressat*innen Sozialer Arbeit jedoch zuhört, dann wird deutlich, wie vielfältig und differenziert die Erfahrungen mit den pandemischen Bedingungen waren und wie unterschiedlich die Menschen, die es mit der Sozialen Arbeit in und außerhalb der Pandemie zu tun bekommen haben, mit den Veränderungen umgegangen sind. So gibt es durchaus auch Menschen, deren Lebenswelt sich nicht so stark verändert hat, wie in der Draufsicht vielleicht vermutet. So zeigen sich z.B. Menschen, die es aufgrund prekärer Lebenslagen gewohnt sind mit Krisen umzugehen, weitaus unaufgeregter im Umgang mit der pandemischen Situation als diejenigen, die sie ,die Normalen‘ nennen. Andere Adressat*innen wiederum, die beispielsweise in institutionalisierten Wohnformen bzw. Heimen leben, erfuhren noch restriktivere Freiheitseinschränkungen und Isolationsformen als die Menschen in familiären Zusammenhängen. Man kann hier durchaus von einem ,doppelten Einschluss‘ sprechen.
Zudem zeigt sich, dass Soziale Arbeit selbst ein Teil möglicher Ausschlussmechanismen ist. So wird von vielen gerade die mangelnde Partizipation an Krisenmanagement und Umsetzung an Infektionsschutzmaßnahmen kritisiert. Zumeist wurde auch durch Sozialarbeiter*innen über die Köpfe der letztlich Betroffenen hinweg entschieden.
In der Wahrnehmung vieler Menschen ist die Pandemie vorbei. Ist dies in der Praxis der Sozialen Arbeit ebenso oder gibt es anhaltende „Pandemie-Effekte“?
Da sich die erhobenen Daten vorrangig auf die Jahre 2020 und 2021 beziehen, ist diese Frage schwer zu beantworten. Zugleich lohnt aber für die kritische Professionsentwicklung ein Blick auf den Umgang mit der Krise, auch um sich kritisch zu fragen: Was hätte besser laufen können? Wo wurden Chancen der Partizipation nicht ergriffen? Aber auch wo entstanden vielleicht neue Formen Sozialer Arbeit durch den kreativen und flexiblen Umgang mit Maßnahmen. Wir können auch über die Pandemie hinaus aus den Aussagen und Erfahrungen der Adressat*innen viel über Soziale Arbeit und ihre Herstellung lernen.
Darum sind wir Herausgeberinnen bei Budrich
Wir danken dem Verlag Barbara Budrich, dass er uns damals schnell ein ‚Go‘ gegeben hat, so dass wir mit der Arbeit an dem Buch beginnen konnten. Zugleich ermöglicht uns auch die Herausgabe in der Reihe der Deutschen Gesellschaft Sozialer Arbeit, dass wir als Fachgruppe Adressat*innen, Nutzer*innen und Nicht-Nutzung Sozialer Arbeit sichtbar werden.
Jetzt versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
Theorie, Forschung und Praxis der Sozialen Arbeit, Band 24
Die Herausgeberinnen

Dr. Kathrin Aghamiri ist Professorin für Sozialpädagogik an der Fachhochschule Münster. In ihren Forschungen interessiert sie sich vor allem für die Adressat*innen- und Nutzer*innenperspektive von Kindern, Jugendlichen und Eltern. Ihr Themenschwerpunkt ist Partizipation in pädagogischen Institutionen. Als Sozialarbeiterin hat sie in der ambulanten und schulbezogenen Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet.

Dr. Rebekka Streck hat eine Professur der Sozialpädadogik an der Evangelischen Hochschule Berlin. Sie beschäftigt sich mit sozialpädagogischer Nutzer*innenforschung insbesondere bezogen auf die Handlungsfelder Drogen- und Wohnungslosenhilfe. Sie war selbst als Sozialarbeiterin im Kontext des Betreuten Wohnens in Berlin tätig.

Dr. Anne van Rießen ist Professorin für Methoden Sozialer Arbeit an der Hochschule Düsseldorf. Ihre Forschungs- und Arbeitssschwerpunkte sind Partizipation und Demokratisierung Sozialer Arbeit, Sozialraumbezogene Soziale Arbeit, interdisziplinäre Stadtentwicklung und Nutzer*innenforschung. Sie leitet die Forschungsstelle für sozialraumorientierte Praxis- und Entwicklungsforschung und ist seit Juni 2022 im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit.
Über „Alltag und Soziale Arbeit in der Corona-Pandemie“
Wie ergeht es Menschen in ohnehin schon schwierigen Lebenslagen während der Corona-Krise? Ziel des Sammelbandes ist es, die Perspektive von Adressat*innen und Nutzer*innen Sozialer Arbeit auf die durch die Corona-Krise bedingten Veränderungen ihrer Alltagswelten und die Angebote Sozialer Arbeit empirisch aufzuzeigen. Hierzu werden im Sammelband sowohl erste empirische Analysen dargestellt als auch die vorliegenden Ergebnisse übergreifend auf Theoriedebatten sowie Impulse für Praxis und Forschung Sozialer Arbeit hin diskutiert.
© Autorinnenfotos: privat


 Kathrin Aghamiri, Rebekka Streck, Anne van Rießen (Hrsg.):
Kathrin Aghamiri, Rebekka Streck, Anne van Rießen (Hrsg.):