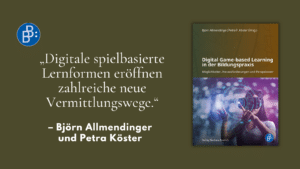Viele Autor*innen kennen die Schreibblockade in der einen oder anderen Form. Entweder erscheint das Anfangen nahezu unmöglich, oder der Schreibprozess bricht plötzlich ein, der Faden reißt ab, und es geht nicht mehr weiter.
In diesem Blogpost stellt Verlegerin und Schreibcoach Barbara Budrich die häufigsten Probleme dar und gibt Tipps für das erfolgreiche Überwinden dieses unangenehmen Phänomens.
Bei Schreibblockade vom eigenen Wissen überwältigt
Ganz häufig höre ich von jungen Wissenschaftler*innen, dass sie von der schieren Fülle des eigenen Wissens überfordert sind. Das Chaos im Kopf scheint zu dicht, die Informationen zu vielfältig, das Prioritäten setzen unmöglich. Sie stehen quasi vor einem großen Elefanten und fragen sich, wie Sie ihn essen sollen. Die Antwort ist einfach: einen Bissen nach dem anderen. Und so können Sie auch eine Schreibblockade überwinden!
Begriffe sammeln
Eine große Hilfe in diesem Durcheinander bieten Post-Its: Notieren Sie die vielen Stichworte und Themen, die Ihnen durch den Kopf sausen auf diesen Klebezetteln; jedes Thema, jedes Stichwort bekommt einen Zettel. Geben Sie sich für den Prozess des Sammelns eine beschränkte Zeit, sodass Sie gezwungen sind, unter Zeitdruck diese verschiedenen Dinge zu notieren. Sollten Ihnen später noch Ergänzungen einfallen, können Sie jederzeit weitere Begriffe hinzufügen.
Organisieren
Nun clustern Sie die Zettel auf einem großen Poster nach Themengebieten. Sie werden feststellen, dass Sie zahlreiche Begriffe für einzelne Themen notiert haben. Manche Begriffe stehen möglicherweise recht allein: Das wäre ein Indiz für einen Bereich, der nicht ganz so zentral für das aktuelle Oberthema ist.
Organisieren Sie die Begriffscluster hierarchisch: Was ist über-, was ist untergeordnet? Bedingt das eine das andere? Welche Beziehungen bestehen zwischen den verschiedenen Einzelbereichen.
Gliederung ableiten
Übertragen Sie nun, nachdem Sie geclustert und strukturiert haben, die einschlägigen Begriffsfelder in eine Gliederung. Notieren Sie in der Gliederung zum Beispiel den Oberbegriff für einen Abschnitt und darunter in Stichworten die weiteren Begriffe, die Sie hierarchisch darunter sortiert haben.
Haben Sie dabei ruhig den Mut, Bereiche auszusortieren; solche, die mit ganz wenigen Begriffen vertreten waren, oder diejenigen, die nun recht offensichtlich vom Weg wegführen. Sind Dinge dabei, die Sie sehr gern mit ausgeführt hätten? Dann notieren Sie diese separat in einem Themenspeicher. Dort können Sie all die Themen sammeln, zu denen Sie bei anderer Gelegenheit arbeiten möchten. Notieren Sie ruhig einschlägige Literatur dazu, um es sich zu ersparen, bei anderer Gelegenheit von Null anzufangen. Verwenden Sie nicht zu viel Zeit und Sorgfalt darauf, diese Dinge auszuführen: Der Fokus liegt auf dem, was Sie von den Zetteln in Ihre Gliederung übertragen haben.
Von der Gliederung in den Text
Nicht jede*r Autor*in arbeitet gern eine Gliederung aus. Manch eine*r fühlt sich dadurch eingeengt in der eigenen Schaffenskraft. Die Gliederung, die Sie aus Ihren Post-Its heraus generiert haben, können Sie als strukturierende Leitlinie nehmen. Sie soll Ihnen helfen, aus der überwältigenden Fülle in strukturiertes Arbeiten zu kommen – nicht mehr und nicht weniger.
Zu jedem Gliederungspunkt, den Sie erarbeitet haben, können Sie nun mit mehr Übersicht ins Schreiben kommen. Sollten Sie sich noch immer von der Überfülle überfordert fühlen, können Sie anhand der einzelnen Gliederungspunkte erneut sammeln und clustern.
Elefanten essen, Bissen für Bissen
Große Aufgaben wirken häufig einschüchternd. Je größer die Aufgabe, umso mehr. Deshalb ist es gut und wichtig, das Große in kleinere Schritte zu zerlegen, von denen Sie das Gefühl haben, Sie können diese bewältigen. Deshalb haben wir den großen Elefanten (Ihr Wissen) in kleine Bissen (Begriffe auf Post-It-Zetteln) zerlegt: So können Sie das Riesending verdauen und Ihre Schreibblockade überwinden.
Das weiße Blatt Papier
Kaum jemand sitzt heute vor einem weißen Blatt Papier, das einen vorwurfsvoll anzuschauen scheint. Heute sitzen wir vor dem leeren Dokument, und es ist der Cursor, der den Vorwurf im Blinken hat.
Nicht selten schaffen wir es sogar, erste Worte ins Dokument zu schreiben. Wir lesen den Satz prüfend durch – und löschen ihn rasch wieder. Manch ein*e Autor*in verbringt die gesamte Schreibzeit mit diesem wenig erquicklichen Prozess: schreiben, löschen, schreiben, löschen … Warum?
Der innere Zensor fördert die Schreibblockade
Wir alle kennen den Widerstreit verschiedener Stimmen in unserem Kopf. Und eine dieser Stimmen ist der innere Zensor: Der weiß alles (besser), zensiert und achtet darauf, dass wir nichts schreiben, was uns blamieren könnte. Er meint es also gut mit uns. Allerdings meint er es manchmal zu gut. Nämlich dann, wenn er uns dazu bringt, alles, was wir zu Papier gebracht haben, wieder zu löschen.
Was also tun?
Der Vertrag mit dem inneren Zensor
Der innere Zensor hat seine Berechtigung und eine wichtige Aufgabe: Er darf zum Ende des Schreibprozesses den Text evaluieren – am besten anhand konkreter Kriterien. Das Entscheidende Wort ist hier „Ende“. Wenn der Zensor nämlich zu früh einsteigt, blockiert er uns, verhindert Kreativität und das Entstehen des Textes selbst.
Sie können versuchen, Ihren Zensor zu befrieden, indem Sie mit ihm eine verbindliche Verabredung treffen: Er muss den Text am Ende anhand der festgelegten Kriterien abprüfen und darf Überarbeitungen verlangen. Dafür muss er aber während der Entstehung des Textes die Klappe halten. Der entstehende Text – und auch das können Sie vertraglich vereinbaren – wird erst dann Dritten vorgeführt, wenn der Zensor sein Ok dazu gegeben hat.
Voll psycho?
„Das ist doch schizophren“, sagen Sie vielleicht. Ja, kann sein. Ist aber egal: Wenn Sie einen entsprechenden Text für sich selbst aufsetzen und unterschreiben möchten, können Sie diese Vereinbarung mit sich selbst auf diesem Wege formalisieren. Letztlich ist aus meiner Sicht allemal besser, als die Schreibzeit mit unproduktivem Schreiben und Löschen zu verbringen. Dann lieber ein bisschen verrückt.
Abbruch: die Schreibblockade hat gewonnen
Bis eben lief es noch gut. Heute ist Schluss. Ihr Text floss fröhlich aus Ihrer Feder, Sie haben an Ihrer Gliederung entlanggeschrieben – doch jetzt ist irgendwie die Luft raus. Es geht einfach nicht mehr weiter. Sie sitzen mittendrin in Ihrem Text. Das war’s.
Die Persona
Wenn Sie feststecken und Ihnen nichts mehr einfällt, obwohl Ihnen klar ist, dass Sie nicht fertig sind, können Sie versuchen, sich mit Ihrer Zielgruppe zu verbünden. Die Frage lautet: Für wen schreiben Sie?
Wenn Sie eine Vorstellung haben, für wen Sie schreiben, wissen Sie, welche Aspekte jetzt wichtig sind. Sie können herausfinden, an welchen Stellen Sie sich kürzer fassen können oder weiter ausholen und vertiefen sollten.
Es ist schwierig, sich mit der „ganzen“ Zielgruppe zu unterhalten. Deshalb empfehle ich die Arbeit mit einer Persona. Eine Persona ist die ideale Vertreterin der Zielgruppe, und Sie konstruieren sie selbst.
Die Arbeit mit der Persona kommt ursprünglich aus dem Marketing. Dort wird mit viel Aufwand und entsprechenden Daten erhoben, wer ein Produkt kaufen soll. Man fragt nach dem Alter, dem Geschlecht und weiteren sozio-demografischen Eigenheiten. Bis hin zu Hobbys, Vorlieben, Schwächen, Urlaubsorten usw. wird die Zielgruppe eingekreist, um so die optimale Ansprache herauszufiltern. Aus den eruierten Daten wird dann eine typische Zielgruppen-Vertretung destilliert: die Persona.
Wir machen es uns ein wenig leichter: Sobald Sie sich mit ein paar Rahmendaten eine optimale Zielgruppenvertretung vorstellen können, haben Sie Ihre Persona erschaffen – und dafür müssen Sie keine empirischen Daten erheben, Ihre Fantasie reicht da völlig aus.
Im Gespräch mit der Persona
Geben Sie Ihrer Persona einen Namen, setzen Sie sie auf Ihre Tischkante. Wenn Sie nicht weiter kommen, gehen Sie mit ihr ins Gespräch: Die Persona kann Ihnen sagen, ob ein Bereich zu tief ausgeführt wird. Sie hilft Ihnen, zu bestimmen, auf welchen Aspekt Sie den Schwerpunkt legen sollten und an welchen Stellen Sie rasch weitergehen können.
So hilft Ihnen diese Zielgruppenvertretung, wenn Sie beim Schreiben einen plötzlichen Einbruch erleben, wenn der Textfaden reißt und Sie nicht mehr weiterkommen. So hilft die Persona bei einer Schreibblockade.
Manchmal reicht es nicht, sich die Persona nur im Kopf vorzustellen; manchmal können Sie mit zwei Stühlen arbeiten und sich in ein „echtes“ Gespräch mit der Persona begeben.
Dazu stellen Sie zwei Stühle hin: Auf dem einen Stuhl sitzen Sie als Autor*innen-Ich. Auf dem anderen Stuhl sind Sie Ihre Persona. Um zu verhindern, dass die netten Männer mit der komischen Jacke kommen, sollten Sie für Ungestörtheit sorgen. Es fällt schwer, sich auf derartige Spiele einzulassen, wenn man Sorge haben muss, dass der eigene Wahnsinn von anderen beobachtet wird … Stellen Sie also von Ihrem Autor*innenstuhl aus eine Frage. Setzen Sie sich auf den anderen Stuhl und warten Sie ab, welche Antwort Sie als Persona geben werden.
Es mag Ihnen merkwürdige vorkommen, doch diese Methode kann helfen. Wenn Sie aus der Perspektive der Persona auf Ihr Schreibproblem schauen, kommen Sie auf andere Antworten und Lösungen, als wenn Sie ausschließlich aus Ihrer Autor*innenperspektive darauf blicken. Es ist eine sehr machtvolle Methode, die noch dazu großen Spaß machen kann, wenn man sich darauf einlassen mag.
Neuer Text – neue Persona
Schreiben Sie an einem neuen Text, kann es sein, dass Sie eine neue Persona brauchen. Es handelt sich um eine Zielgruppenvertretung – wenn Sie an einem neuen Text arbeiten, ist es möglich, dass Sie eine neue Zielgruppe bedienen. Vielleicht schreiben Sie zunächst für den Inner Circle der Scientific Community. Und der nächste Text ist für das Feuilleton einer Tageszeitung. Gut möglich, dass auch Ihre Peers den Feuilleton-Artikel lesen werden – doch die Hauptzielgruppe ist eine „interessierte Öffentlichkeit“, durchaus akademisch vorgebildet, aber nicht in den Tiefen Ihres Faches zu Hause. Dementsprechend ist es sinnvoll, eine andere Persona für das Feuilleton zu wählen als für den Fachtext.
Sinnvolles Schreiben
Wenn Sie im stillen Kämmerlein allein vor sich hin schreiben, kann es sein, dass Sie vergessen, für wen Sie schreiben. Dadurch kann es passieren, dass Sie den Sinn Ihres Schaffens aus dem Blick verlieren. Mit der Persona haben Sie Ihr Publikum im Blick und wissen, für wen Sie Ihren Text verfassen. Das verleiht Ihrem Tun einen Sinn und gibt Ihnen ein konkretes Ziel – und beides ist hilfreich für einen gelingenden Schreibprozess.
Schreibblockade: die Autorin

Barbara Budrich arbeitete über zehn Jahre im Verlag Leske + Budrich ihres Vaters, bevor sie 2004 den Verlag Barbara Budrich gründete. Sie hat zahlreiche Bücher und Aufsätze publiziert, übersetzt und geschrieben. Seit 2012 geben sie und ihr Team im von ihr etablierten Unternehmen budrich training ihr Know-how zum wissenschaftlichen Publizieren und Schreiben systematisch in Vorträgen, Workshops und Coachings weiter.
Mehr zum Thema Schreibblockade …
… finden Sie in unserer Blog-Kategorie Wissenschaftskommunikation.
© Foto Barbara Budrich: privat | Titelbild: pexels.com ; Karolina Grabowska