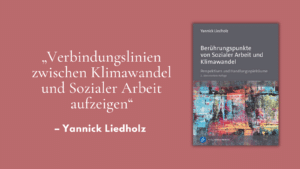„Sie müssen bereit sein, Freunde zu verlieren!“, sage ich oft – nur ein wenig scherzhaft –, wenn ich nach den Voraussetzungen gefragt werde, einen Sammelband herauszugeben.
Viele Herausgeber*innen von Sammelbänden kennen das Phänomen: Autor*innen bekommen Vorgaben zur formalen Vorbereitung des Textes. Es gibt Hinweise zur inhaltlichen Ausrichtung. Und es gibt Verabredungen zum Umfang des Texts, Art und Beschaffenheit von Abbildungen sowie einen Zeitplan. Also kann nichts mehr schiefgehen …
In der Theorie reichen diese ganzen Vorgaben aus, um die größtmögliche Einheitlichkeit eines Sammelbands zu organisieren. In der Praxis stößt dies jedoch an Grenzen. Wenn das „Handbuch“ für die Vorgaben des Sammelbands zu umfangreich wird, und daraus eine Fülle unterschiedlicher Regeln resultiert, dann wird oft alles in Bausch und Bogen ignoriert. Noch dazu ist es nicht selten, dass Abgabetermine wenig Eindruck zu machen scheinen.
Der Zusammenbruch der Zeitplanung ist besonders ärgerlich: Die Zuverlässigen werden bestraft. Denn bis die Letzten abgegeben haben, müssen die Ersten beinahe schon wieder überarbeiten. Was also tun?
So wenig wie möglich regeln
Es klingt merkwürdig, aber im ersten Schritt ist es wichtig, so wenig wie möglich zu regeln. Und nur so viel, wie nötig. Was aber ist nötig?
Der rote Faden
Aus meiner Verlegerinnen-Sicht sind die Dinge am wichtigsten, die sich direkt auf die Zielgruppe auswirken. Das Inhaltliche muss stimmig sein, die Beiträge müssen einen durchgehenden roten Faden spinnen und auch sprachlich bzw. stilistisch eine gewisse Einheitlichkeit vorweisen. Und zwar derart, dass ein und dieselbe Leser*innengruppe im Idealfall mit jedem der Beiträge etwas anfangen kann.
Das ist der Grund, dass ich bei Sammelbänden davon abrate, einzelne Beiträge in einer anderen Sprache aufzunehmen oder doch sehr behutsam damit zu sein. Ein deutscher Band kann vielleicht ein oder zwei englische Beiträge verkraften. Ein englischsprachiger Band hat aber in der Regel wenig Vergnügen an deutschen Einsprengseln. Weitere Sprachen – Französisch, Spanisch, Italienisch – zusätzlich aufzunehmen, macht den Band umfangreicher und für ein immer kleiner werdendes Publikum interessant.
Auch stilistisch muss das Ganze „stimmen“. Wir kennen z.B. aus der Sozialen Arbeit die Schwierigkeit, dass die Praxis der Sozialen Arbeit häufig eine andere Sprache spricht, als deren wissenschaftliche Vertreter*innen. Es ist in solchen Fällen nicht einfach, eine gemeinsame Ebene zu finden, die das Wissenschaftliche ein wenig abfängt und das Praktische etwas theoretisch anreichert.
Wenn wir uns die Monografie als „Buch-Ideal“ denken, ist dies besonders gelungen, wenn das Buch aus einem Guss ist und die Leitfragen quasi wie Leitsterne die Ideenentwicklung oder Darstellung der Ergebnisse und Erkenntnisse führen. In einem Sammelband ist dies zwangsläufig ein wenig anders. Für gewöhnlich hat jeder Beitrag eine eigene (Unter)Fragestellung, die vom Beginn bis zum Ende des Beitrags führt. Abhängig von der Art des Sammelbands ist es eine mehr oder minder große Herausforderung für die Herausgeber*innen, hier für einen guten Gleichklang zu sorgen. Wenn es gelingt, sind beispielsweise gleichartige Beiträge parallel strukturiert und weisen ähnliche Unterüberschriften auf.
Es ist nicht leicht bei einem Band die Richtung vorzugeben, dessen Gemeinsamkeit sich vor allem aus ähnlichen Forschungsinteressen seiner Autor*innen speist. Einige Autor*innen werden die Tendenz haben, ihr eigenes Steckenpferd zu satteln und, wann immer sich eine entsprechende Lücke bietet, in die ihnen eigene Richtung reiten. Dies zu vereiteln und die „Flüchtigen“ wieder einzufangen, ist Ihre Aufgabe als Herausgeber*in.
Die Konferenz zum Fadenspinnen
Nicht selten werden für größere Sammelband-Projekte eigene Treffen organisiert oder Konferenzen veranstaltet. Und zwar gern einmal zu Beginn und einmal gegen Ende der Manuskriptarbeit. Das ist aus meiner Sicht die optimale Möglichkeit, die größtmögliche Homogenität für einen Sammelband zu erzielen: Zu Beginn haben dadurch alle die Chance, ihre je eigene Perspektive in den roten Inhaltsfaden des Bandes mit einzuknüpfen. Und jede*r hört die Perspektiven der anderen. Auf diesem Wege kommen die unterschiedlichen Autor*innen am besten auf eine gemeinsame Ebene.
Vor dem ersten Treffen werden die thematischen Rollen bereits zugewiesen und das Oberthema fixiert: Man möchte sich nicht im luftleeren Raum ohne jede Festlegung zusammensetzen; das verschwendet erfahrungsgemäß zu viel Zeit.
Im Anschluss an das Treffen gehen alle wieder heim zum Schreiben und geben den jeweiligen Beitrag selbstverständlich zur verabredeten Zeit an die Herausgeber*innen. Nach einer Rückmeldung und ggf. Überarbeitung der Texte treffen sich die Autor*innen ein zweites Mal zur finalen Abstimmung der Texte miteinander. Gut möglich, dass im Anschluss eine weitere – kleine – Überarbeitung erfolgt, um Querverweise einzuarbeiten oder Redundanzen zu streichen: Kein*e Leser*in möchte die Einführung in den gleichen Bereich in drei verschiedenen Beiträge lesen; das reicht im ersten der Beiträge zu diesem Themenkomplex.
Wenn das Treffen an einem gemeinsamen Ort schwierig ist, lassen sich mit weniger Aufwand Online- bzw. Telefonkonferenzen organisieren.
Inhaltsverzeichnis und Abstracts als Alternative
Nicht immer ist für einen Sammelband ein Treffen möglich. Dann ist es aber unumgänglich, den Autor*innen ein (vorläufiges) Inhaltsverzeichnis des Bandes zur Verfügung zu stellen. Abstracts zu den einzelnen Beiträgen helfen den Einzelnen zudem, sich im Gesamtwerk einzuordnen. Als Herausgeber*in können Sie besprechen und festlegen, wer in welchen Teilbereich einführt und dies allen mitteilen, die es angeht, um auf diesem Wege die Redundanzen auf das nützliche Maß zu reduzieren.
Beitragende, die thematisch sehr eng beieinander liegen, könnten Sie bitten, sich miteinander auszutauschen. Das spart Ihnen als Herausgeber*in die Mühe, die Texte hinterher selbst zu entflechten und abzugrenzen.
Einen Sammelband herausgeben: Qualitätssicherung
Die ultimative Qualitätssicherung wird heutzutage im Peer Review gesucht – gern double-blind. Ob Sie dieses Prozedere durchspielen oder sich darauf beschränken, mit Editorial Reviews als Herausgeber*innen Rückmeldung zur Qualität zu geben, liegt an verschiedenen Faktoren.
Im internationalen Kontext sind Peer Reviews unerlässlich. Eine Universität oder Forschungseinrichtung verlangt mit Sicherheit entsprechende Nachweise, die notwendig sind, um die Publikation für ihre Autor*innen anzuerkennen. Im deutschsprachigen Kontext sind die Regeln in den Geistes- und Sozialwissenschaften (noch) nicht ganz so rigide auf double-blind Peer Reviews ausgerichtet.
Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Verlag, wie er die Notwendigkeit des Peer Reviews einschätzt. Vielleicht kann er Sie beim Review-Prozess unterstützen, sofern er notwendig ist.
Diese Art der Qualitätssicherung verlängert den gesamten Publikationsprozess um einige Monate. Durch Terminschwierigkeiten einzelner Reviewer und nicht eingehaltene Zusagen potenzieren sich Verzögerungen an diesem Punkt des Publikationsprozesses. Es ist gut, das im Kopf zu behalten, wenn Sie Ihre Zeitplanung vornehmen.
Letztlich müssen Sie den Autor*innen die Rückmeldungen der Reviewer zurückspielen. Mir ist es bei uns im Verlag schon passiert, dass im Reviewprozess bereits von den Herausgeber*innen akzeptierte Beiträge rausgeflogen sind: Mehrere Kolleg*innen, die tiefer in die Thematik eingearbeitet waren, wiesen auf große Mängel hin, die sich nicht heilen ließen. Das ist für alle Beteiligten unangenehm – aber genau für solche Fälle ist ein Peer Review eine sehr gute Rückversicherung.
Die Rückmeldungen der Reviewer bedeuten für die Autor*innen nicht selten erneute Überarbeitungsschleifen – noch mehr Zeitaufwand, für den Sie als Herausgeber*in in der Gesamtplanung einen entsprechenden Puffer vorsehen sollten.
Der ganze Formalkram beim Sammelband …
Ohne weitere Vereinheitlichungen sieht der Sammelband nicht aus wie ein homogenes Ganzes. Es ist also über die thematische, inhaltliche und Zielgruppen-Orientierung hinaus noch mehr Herausgeber*innen-Arbeit zu leisten.
Sie können Ihren Autor*innen zwei (knappe und übersichtliche) Informationsblätter mit auf den Weg geben:
- eines zu den Zitationsregeln,
- eines zu weiteren Formalitäten (z.B. Formatierungen).
Natürlich könnten Sie ihnen noch viel mehr mit an die Hand geben. Je mehr Material Sie Ihren Autor*innen jedoch zumuten, desto größer die Gefahr, dass vieles – oder gar alles – ignoriert wird.
Zitationsregeln
Sollten Sie das Vergnügen haben, einen interdisziplinären Sammelband herausgeben zu dürfen, dann finden Sie sich damit ab, dass Sie u.U. keine einheitliche Zitation schaffen werden. Wenn Sie Naturwissenschaftler*innen (amerikanische Zitation oder gar mit Ziffern) mit Jurist*innen (Fußnotenzitation) zusammenspannen, treffen zwei Welten aufeinander, die Sie nur schwer homogenisieren können – und wegen der entsprechend notwendigen Auseinandersetzungen vielleicht gar nicht möchten. Da haben Sie schon viel erreicht, wenn Sie es schaffen, inhaltliche und stilistische Kohärenz für Ihre Zielgruppe herzustellen …
Wenn wir aber von derartigen Schwierigkeiten absehen und uns innerhalb einer Disziplin bewegen oder in Disziplinen, die sich leichter zusammenbringen lassen, dann ist es gut, Zitationsregeln vorzugeben. Sollte Ihr Verlag Ihnen Regeln vorgeben, ist Ihr Spielraum geringer. Häufig ist es aber so, dass Sie sich die Regeln selbst aussuchen können, solange der Band insgesamt homogen gestaltet wird. Literaturverwaltungsprogramme sind eine große Erleichterung, doch verwenden nicht alle Autor*innen das gleiche Programm, sodass sie keine Garantie für Einheitlichkeit darstellen.
Sie können um Nachbesserung bitten, wenn die Zitation stark von Ihren Vorgaben abweicht – aber zumeist resignieren Herausgeber*innen (und Verlage) vor der kleinteiligen Mammutaufgabe wirklich jeden Punkt, Doppelpunkt und jedes Komma an die richtige Stelle zu bringen. „Weitestgehend einheitlich“ ist oft ein ausreichend ehrgeiziges Ziel.
Weitere Formalitäten
Der Versuch, die einheitliche Formatierung von Sammelbänden auf mehrere Schultern bzw. Hände zu verteilen, ist bislang eher selten erfolgreich verlaufen. Viele Autor*innen haben Eigenheiten im Layout ihrer Texte, die sie ungern lassen. Und das Einarbeiten in die „Generelle Satzanweisung“ bzw. Formatierungsvorgaben eines Verlages ist nicht ohne.
Einfacher ist es natürlich, wenn Sie in eine entsprechende Browser-Umgebung hineinarbeiten können. Dann ist es auch möglich, dass jede*r Autor*in den je eigenen Beitrag selbst bearbeitet. Die Formatierung erfolgt zentral von Verlagsseite, gestützt durch ein halbautomatisiertes System. (Manchmal auch unterstützt von billigen Arbeitskräften am anderen Ende der Welt. Wenn deutschsprachige Wissenschaftstexte, die für nicht-akademische Muttersprachler*innen schon eine Herausforderung sein können, von Menschen bearbeitet werden, die des Deutschen nicht mächtig sind, wird es spannend.)
Wenn die Druckvorlage ohnehin von Verlagsseite erstellt wird, ist es gut, etwaige wiederkehrende Elemente – Textkästen, Abbildungen, Tabellen usw. – einheitlich von den Autor*innen vorformatieren zu lassen. Je eindeutiger diese Dinge im Vorfeld gekennzeichnet werden, desto weniger Aufwand ist die anschließende Formatierung durch die Profis und desto weniger fehleranfällig ist das Ganze.
Die Sache mit der Deadline
Bei Ihrer eigenen Planung als Herausgeber*in dürfen Sie für sich selbst und Ihre Arbeitsabläufe Puffer einkalkulieren. Verzögerungen haben leider die Angewohnheit, sich zu potenzieren, je mehr Leute daran beteiligt sind (schön zu beobachten z.B. bei Großprojekten im Baubereich). So ist ein Sammelband umso anfälliger für Verzögerungen, je mehr Leute involviert sind.
Ihre Aufgabe als Herausgeber*in ist es, die Autor*innen freundlich auf heraufziehende Deadlines aufmerksam zu machen. Und hier kommt der Punkt, wo es sein kann, dass Sie Freunde verlieren: Sie müssen diejenigen, die das Projekt über Gebühr verzögern, von der Aufgabe des Beitragens entbinden.
Vor vielen, vielen Jahren ist es mehr als einmal vorgekommen, dass ein Herausgeber mir gegenüber beteuerte, es seien alle Beiträge da, wir könnten die auch schon bekommen und mit dem Satz beginnen. Nur der „Star“ ließe noch auf sich warten. Der namhafte Wissenschaftler, um den es bei mehreren Projekten ging, verzögerte diese Bücher immer um Monate. Am Schluss bekamen wir seinen Beitrag nicht, und die Bücher erschienen ohne seinen Input. Ärgerlich für alle Beteiligten.
Namhaften Wissenschaftler*innen sind nicht automatisch unzuverlässig – und Unzuverlässigkeit ist kein Privileg der Namhaften. Die Konsequenz sollte jedoch klar sein: Wer nicht abgibt und Deadlines verstreichen lässt, bekommt einmal eine Nachfrist. Wer dann nicht abgegeben hat, ist raus. Alles andere ist unfair allen Beteiligten gegenüber, vor allem gegenüber jenen, die ihren Beitrag pünktlich abgegeben haben.
Es kann immer Umstände geben, die dazu führen, dass man selbst eine Deadline trotz Zusage nicht einhalten kann. Sobald man das feststellt, sollte man sich mit jenen in Verbindung setzen, denen gegenüber man wortbrüchig wird. So haben dann die Herausgeber*innen die Wahl, ob Sie Ihren Beitrag zu einem späteren Zeitpunkt einreichen dürften oder ob Sie für diesen Band keinen Beitrag verfassen werden.
Manche Autor*innen gehen sehr raschen Schrittes an den Verlagsständen auf Konferenzen vorbei: Sie haben bei einem oder mehreren Verlagen Projekte im Verzug und möchten sich der Auseinandersetzung nicht stellen. An der Stelle kann ich Sie beruhigen: Natürlich freuen wir Verlage uns, wenn Termine eingehalten werden. Wir sind es andererseits gewohnt, dass Zeitpläne nicht wie gewünscht aufgehen. Und dann sind wir dankbar, wenn wir mit Ihnen eine (realistische) Neuplanung besprechen können!
Als Herausgeber*in sind Sie mit Ihren Beitragenden in dauerndem Kontakt, sodass Sie frühzeitig mitbekommen, falls es bei jemandem eng wird. Möglicherweise bekommen Sie für den wegfallenden Beitrag sogar noch einen Ersatz, wenn Sie früh genug gewarnt sind.
Die Sache mit dem Umfang
Um keinen Raum für Missverständnisse mit Blick auf die Umfangsfestlegung zu lassen, geben Sie den Umfang nicht in einer Seitenzahl vor. Sie nutzen entweder Zeichen inklusive Leerzeichen (die brauchen auch Platz) oder Sie geben die Wörterzahl vor. In beiden Fällen sind Abbildungen und Tabellen nicht im Umfang enthalten. In den Verlagsverträgen ist oft vom Raum die Rede, den diese Darstellungsformen einnehmen. Eine halbe Seite ist bei einer Abbildung eine konkrete Angabe. Wenn man weiß, dass eine Druckseite (A5) zum Beispiel 400 Wörter hat, dann würde eine halbseitige Abbildung 200 Wörter „kosten“. Legen Sie daher auch Zahl und Größe von Abbildungen oder Tabellen fest, um Ihren Autor*innen einen genauen Rahmen zu geben.
Und natürlich werden Sie feststellen, dass auch in diesem Bereich Wunsch und Wirklichkeit gelegentlich auseinanderklaffen. Selten bekommen Sie weniger Zeichen oder Wörter, als Sie vorgegeben hatten. Auf Nachfrage bekommen Sie im Zweifel zu hören, dass kürzen unmöglich ist, denn „da kann man nichts weglassen“.
Oft ist das vollkommen korrekt, wobei noch ein Nachsatz fehlt: Man kann nichts weglassen, es sei denn, man lässt etwas weg. Um einen Text zu kürzen, ist häufig angesagt, die Fragestellung enger zu führen und einzelne Aspekte wegzulassen – ein einfaches Streichen etwaiger Füllwörter reicht nicht aus. Kürzen gehört zu den schwierigeren Übungen – und doch profitieren die meisten Texte enorm davon, da das Thema stärker verdichtet wird. Helfen Sie Ihren Autor*innen beim Kürzen und seien Sie mitfühlend: Man mag es nicht auf den ersten Blick sehen, doch die meisten Texte sind mit Herzblut geschrieben.
Fazit
Wenn Sie einen Sammelband herausgeben möchten, ist Führungsstärke eine hilfreiche Eigenschaft. Das bedeutet nicht etwa, dass Sie laufend die Peitsche schwingen. Sie sind vielmehr aufgerufen, den Beitragenden im beständigen Austausch mit klaren Regeln Orientierung zu geben und die Unternehmung Sammelband auf einem guten Kurs zu halten. Im schlimmsten Fall dürfen Sie sich darauf einstellen, Freunde zu verlieren …
Die Autorin

Barbara Budrich arbeitete über zehn Jahre im Verlag Leske + Budrich ihres Vaters, bevor sie 2004 den Verlag Barbara Budrich gründete. Sie hat zahlreiche Bücher und Aufsätze publiziert, übersetzt und geschrieben. Seit 2012 geben sie und ihr Team im von ihr etablierten Unternehmen budrich training ihr Know-how zum wissenschaftlichen Publizieren und Schreiben systematisch in Vorträgen, Workshops und Coachings weiter.
© Foto Barbara Budrich: privat | Titelbild: unsplash.com ; Jackalope West