Eine Leseprobe aus Methoden struktureller Veränderung in der Sozialen Arbeit von Nivedita Prasad, Kapitel „Methoden struktureller Veränderungen (in der Sozialen Arbeit)“.
***
Methoden struktureller Veränderungen (in der Sozialen Arbeit)1
Nivedita Prasad
Es gibt keine einheitliche Bezeichnung für sozialarbeiterisches Handeln, das neben individueller Unterstützung auch auf strukturelle Veränderung bzw. Wandel abzielt. Entsprechendes Handeln wird manchmal beschrieben als Soziale Arbeit jenseits des Einzelfalls, Soziale Arbeit, die sich auf strukturelle Veränderungen bzw. Wandel fokussiert oder auch als Soziale Arbeit auf der Makroebene2 (Netting et al. 2017, DZI 2022), Policy Practice (Burzlaff 2022), Politik Sozialer Arbeit (Benz/Többe-Schukalla 2013, 2014); Sozialarbeitspolitik (Rieger/Wurtzbacher 2020), politische Praxis Sozialer Arbeit (Dischler/Kulke 2021), Einmischung (Bitzan/Daigler 2004, Munsch 2017, Leiber et al. i. E.), kritische Soziale Arbeit (Fook 2002, Anhorn et al. 2012, Wendt 2022), anti-oppressive social work (Dominelli 2002, Morgaine/Capous-Desyllas 2015), emanzipatorische Soziale Arbeit (Otto/Ziegler 2015, Butterfield 2018, Kappeler 2020), Social Action (Vinik/Lewin 1991, Mohinuddin 2018, https://www.socialworkin.com/), Radical Social Work (Ferguson/Woodward 2009) oder advokatorische bzw. anwaltschaftliche Soziale Arbeit (Rieger 2003, Dalrymple/Boylan 2013, Cox et al. 2019, Jansson 2018, Hoefer 2019) bezeichnet. Auch wenn manche dieser Begrifflichkeiten auch konzeptionell unterlegt sind, sind sie nicht immer deutlich voneinander abgrenzbar. Ihnen allen ist aber gemeinsam, dass sie Probleme von Adressat_innen nicht als individuelle Probleme betrachten, deren Ursache bei den Einzelnen zu suchen sei, sondern auch die strukturelle/gesellschaftliche Komponente in den Blick nehmen. Sie haben den Anspruch, sich nicht nur auf Symptome zu konzentrieren, sondern auch auf die Ursachen sozialer Probleme und damit nicht auf eine Veränderung des Verhaltens, sondern der Verhältnisse (vgl. Rieger 2014: 329, Burzlaff 2022: 45) abzielen. Sozialarbeitende, die auf der Makroebene tätig sind, streben zudem eine kritische Analyse nach innen an, indem sie auch die problematischen (mitunter menschenrechtsverletzenden) Praxen Sozialer erkennen, benennen, thematisieren analysieren und bearbeiten3 mit dem Ziel, solchem Verhalten künftig vorzubeugen.
Im Folgenden wird zunächst der Einsatz für strukturellen Wandel als ein Auftrag Sozialer Arbeit vorgestellt. Da einige Felder Sozialer Arbeit historisch und aktuell eine große Nähe zu sozialen Bewegungen aufweisen, wird dieses Verhältnis kritisch diskutiert. Einige Traditionen Sozialer Arbeit, die sich auf strukturellen Wandel fokussieren, werden dargestellt und die Frage der Inklusion von Methoden struktureller Veränderung in den Methodendiskurs Sozialer Arbeit diskutiert. Es wird dafür plädiert, sich verlorengegangene Methoden Sozialer Arbeit wieder anzueignen bzw. auch künftig zu prüfen, ob sich Methoden aus sozialen Bewegungen auf die Soziale Arbeit übertragen lassen. Schließlich wird ein Gedankenspiel vorgestellt, anhand dessen Debatten um strukturelle Ursachen sozialer Probleme beginnen können, um eine Adaption von Aus- und Weiterbildung von Sozialarbeitenden zur Stärkung von sozialarbeiterischem Handeln auf der Makroebene zu thematisieren.
Einsatz für strukturellen Wandel als Auftrag Sozialer Arbeit
Die globale Definition Sozialer Arbeit (IASSW/IFSW 2014) verdeutlicht zum wiederholten Male, dass der Auftrag Sozialer Arbeit auch darin besteht, soziale Gerechtigkeit zu fördern, Diskriminierungen und ungerechten Politiken und Praxen entgegenzuwirken und sich für den Zugang zu einer gerechten Verteilung von Ressourcen einzusetzen. Ähnliche Aussagen trafen bereits die Definitionen von 2004, 2000 und 1982. In der Tradition dieser Definitionen fordert auch der Deutsche Berufsverband Sozialer Arbeit (DBSH) in seinem Ethikkodex Sozialarbeitende auf, „menschengerechte und sozialverträgliche Strukturen einzufordern“ (DBSH 2014: 27) und erinnert an die Verpflichtung, soziale Gerechtigkeit zu fördern (ebd.: 30), bzw. daran, dass Professionsangehörige Ausgrenzung und Abwertung von Menschen entgegenzutreten haben (ebd.: 34). Die Ethikkodizes anderer Länder äußern sich ähnlich – zum Teil sogar expliziter. Es scheint, dass es zumindest auf der appellativen Ebene viel Bekenntnis zu struktureller Veränderung gibt. Auch wenn sich einzelne Praxisfelder immer wieder auch sehr erfolgreich für strukturelle Veränderungen eingesetzt haben, ist eine durchgängige systematische Übertragung in allen Praxisfeldern der Sozialen Arbeit nicht erkennbar.
Jansson argumentiert gar, dass Sozialarbeitende Grundwerte der Profession wie Soziale Gerechtigkeit und Fairness vernachlässigten, wenn sie die gesellschaftlichen Faktoren, die zu Unrecht führen, unbeachtet ließen (vgl. Jansson 2018: 22). Auch befürchtet er, dass Sozialarbeitende, wenn sie das politische Feld anderen überlassen, es zulassen, dass andere Gruppen mit Werten und Perspektiven, die den Bedürfnissen von Klient_innen, Verbraucher_innen und Bürger_innen entgegenstehen können, dominieren“ (vgl. ebd.). All dies ist folgerichtig, denn es steht in der Tradition vieler Pionier_innen Sozialer Arbeit wie Jane Addams, Mary Richmond, Alice Salomon (vgl. Braches-Chyrek 2013, Staub-Bernasconi 2018, 2019) Mary Parker Follett, Ilse Arlt, Sattareh Farman Farmaian, Whitney Young (vgl. Staub-Bernasconi 2019) aber auch Dorothy Height, Florence Kelley und Porter Raymond Lee. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie nicht nur Einzelfälle bearbeitet, sondern sich auch für den sozialen Wandel eingesetzt haben, indem sie für ihre Themen sensibilisierten, diese öffentlich skandalisierten, Evidenzen durch Sozialforschung produzierten und Gesetzesinitiativen initiierten und begleiteten.
___
1 Ich danke Miriam Burzlaff für die sehr hilfreichen kritischen Anmerkungen und Ergänzungen zu diesem Artikel.
2 Eine Zeitlang auch „indirekte“ Soziale Arbeit genannt (vgl. Tice et al. 2020: 3).
3 So nennen Ferguson et al. neben den bekannten Kollaborationen von Sozialarbeitenden in Deutschland mit dem Naziregime oder in Südafrika mit dem Apartheidsregime auch weniger bekannte, wie die Zusammenarbeit der Greek Association of Social Workers mit der Militärjunta (1967 bis 1974), die Verquickung mit dem Franco-Regime in Spanien und koloniale Praxen Sozialer Arbeit mit indigenen Kindern in Kanada, Australien und Dänemark (Ferguson et al. 2018).
***
Sie möchten gern weiterlesen?
Jetzt versandkostenfrei im Budrich-Shop bestellen
Die Herausgeberin
Prof. Dr. Nivedita Prasad, Professur für Handlungsmethoden Sozialer Arbeit und genderspezifische Soziale Arbeit, Studiengangsleitung: MRMA:Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession, SAGE! Schwerpunktprofessur für Gleichstellung, Diversität und Antidiskriminierung, Alice Salomon Hochschule Berlin
Über das Buch
Es wird viel über strukturellen Wandel in der Sozialen Arbeit gesprochen, aber selten über die Umsetzung solcher Veränderungen. Dieses Buch verdeutlicht, dass strukturelle Veränderungen Kern Sozialer Arbeit sind und unternimmt den Versuch, diese Haltung methodisch umzusetzen. Dabei geben bereits in anderen Disziplinen und Arbeitsbereichen erprobte Methoden wichtige Impulse.
Mehr Leseproben …
… finden Sie auf unserem Blog.


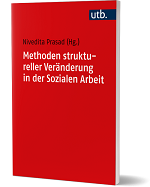 Nivedita Prasad (Hrsg.):
Nivedita Prasad (Hrsg.):